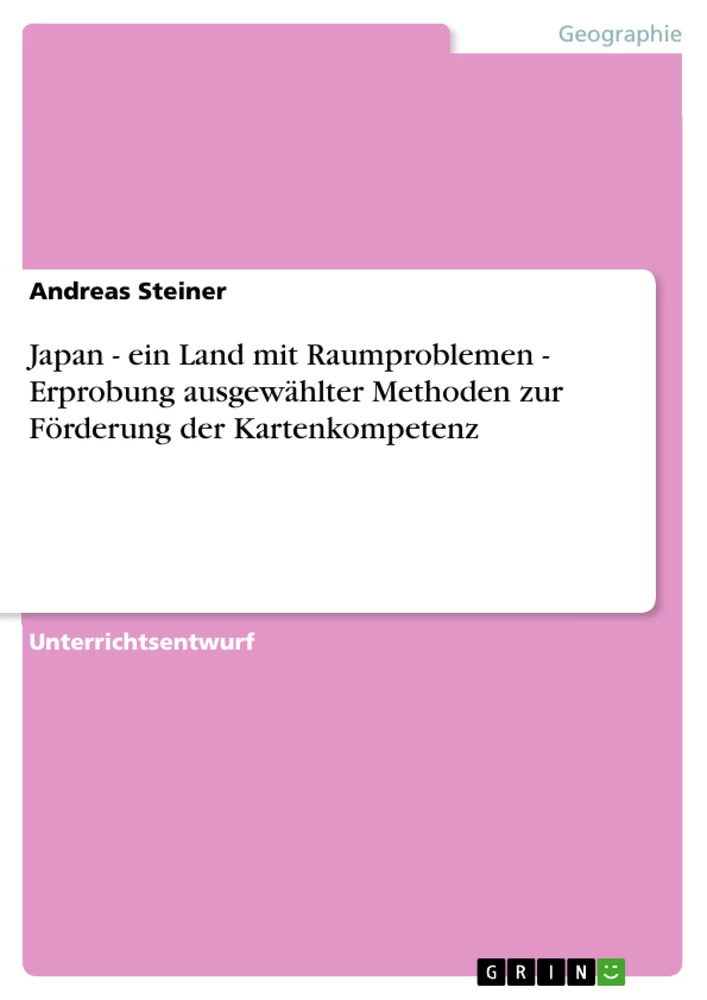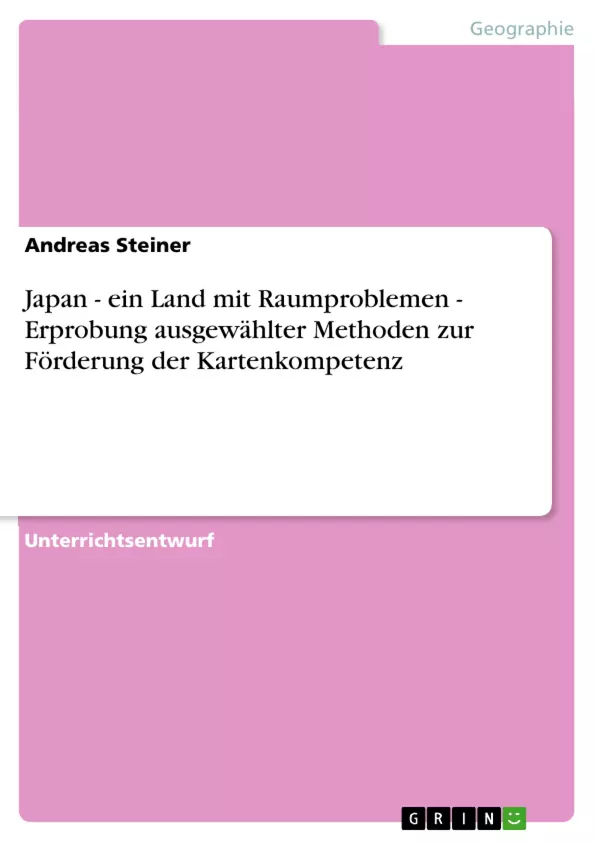Kartendarstellungen nehmen einen wichtigen Stellenwert in unserem Leben ein. Wer sich in einer fremden Umgebung orientieren möchte, wird dabei in aller Regel auf Landkarten, Straßenkarten, Stadtpläne oder U-Bahnpläne zurückgreifen.
Zunehmend bedienen sich außerdem die modernen Massenmedien kartographischer Darstellungen, um Sachinformationen mit topographischen Informationen zu verknüpfen.
In der Fachliteratur zum Einsatz von Karten in der Schule besteht Einigkeit über die Bedeutung von Karten: SPERLING (1982) verdeutlicht den Wert der Karte als Kultur- und Bildungsgut, LENZ(2005)hebt mit Blick auf die Schule hervor, dass die Karte ein für die geographische Ausbildung unverzichtbares fachtypisches Arbeitsmittel darstellt, ohne das die Raumbewertung, der Aufbau von Orientierungsfähigkeit und die Entwicklung der raumbezogenen Handlungskompetenz nicht vorstellbar sei.
Folgt man dem Konzept von Erziehung in der Schule als „Lebensvorbereitung von Jugendlichen“, muss Unterricht dem Stellenwert von Karten sowie den im Umgang mit Karten entstehenden Problemen Rechnung tragen und den Schülern die Fähigkeit zum Umgang mit Karten, kartographische Kompetenz oder verkürzt: Kartenkompetenz vermitteln.
HÜTTERMANN 1992 betont, dass es einer Didaktik der Schulkartographie nicht lediglich um methodische Kniffe, sondern „um die sinnvolle Einbindung von Karten in einen Fragehorizont des Unterrichts“ gehe.
Das zentrale Anliegen des Unterrichtsvorhabens besteht darin zu prüfen, ob und inwieweit die im Rahmen eines integrativen Ansatzes erprobten Methoden (Lupenmethode,additive Schichtenmethode, Entwicklung eines Auswertungsverfahrens) dazu beitragen, die Kartenkompetenz der Schüler zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begründung der Themenstellung
- 1.2 Das Problem der Komplexität von Karten
- 1.3 Zielsetzung des Unterrichtsvorhabens
- 2. Kartenkompetenz im Erdkundeunterricht
- 2.1 Was ist Kartenkompetenz?
- 2.2 Methoden zur Förderung von Kartenkompetenz
- 2.2.1 Reduktion von Komplexität durch den Lehrer
- 2.2.2 Reduktion von Komplexität durch den Schüler
- 3. Planung der Unterrichtsreihe
- 3.1 Bezüge zum Rahmenlehrplan
- 3.2 Lernvoraussetzungen
- 3.3 Sachanalyse
- 3.4 Didaktische und methodische Entscheidungen
- 3.4.1 Zur Frage nach der Progression
- 3.4.2 Transparenz
- 3.4.3 Überlegungen zum Auswertungsverfahren
- 3.4.4 „Additive Schichtenmethode“
- 3.4.5 Versprachlichungskompetenz
- 3.5 Erkenntnisabsicht und Indikatoren
- 4. Durchführung und Reflexion ausgewählter Aspekte
- 4.1 Synoptische Darstellung der Unterrichtsreihe
- 4.2 Warum haben die Japaner ein Raumproblem? (Stunde 1)
- 4.2.1 Zielsetzung
- 4.2.2 Auswahl der Karte
- 4.2.3 Einbindung in die Fragestellung
- 4.2.4 Arbeit mit Karte 1
- 4.2.5 Fazit der 1. Stunde
- 4.3 Entwicklung eines Auswertungsverfahrens (Stunde 2)
- 4.3.1 Zielsetzung
- 4.3.2 Durchführung und Analyse
- 4.3.3 Fazit der 2. Stunde
- 4.4 Auf welche Weise wird Neuland gewonnen und wie wird es genutzt? (Stunde 3)
- 4.4.1 Zielsetzung
- 4.4.2 Auswahl der Karte
- 4.4.3 Einbindung in die Fragestellung
- 4.4.4 Arbeit mit Karte 2
- 4.4.5 Fazit der 3. Stunde
- 5. Gesamtreflexion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung von Kartenkompetenz im Erdkundeunterricht einer 7. Klasse. Ziel ist es, zu überprüfen, ob und inwieweit ausgewählte Methoden die Kartenkompetenz der Schüler verbessern. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung und Reflexion der Methoden im Unterricht.
- Förderung der Kartenkompetenz
- Methoden zur Reduktion von Kartenkomplexität
- Integration von Karten in konkrete Fragestellungen
- Entwicklung und Anwendung von Auswertungsverfahren
- Didaktische und methodische Entscheidungen im Geographieunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung von Karten in unserer Gesellschaft und im Bildungskontext. Sie beleuchtet die Herausforderung der Komplexität von Karten für Schüler und führt in die Zielsetzung des Unterrichtsvorhabens ein, nämlich die Vermittlung von Kartenkompetenz durch die sinnvolle Einbindung von Karten in einen konkreten Fragehorizont und die Vermeidung isolierter Einführungslehrgänge. Die Arbeit von verschiedenen Autoren wie Sperling, Altemüller, Hüttermann und Lenz wird zitiert, um die Bedeutung und Herausforderungen der Kartenarbeit im Unterricht zu untermauern.
2. Kartenkompetenz im Erdkundeunterricht: Dieses Kapitel definiert Kartenkompetenz und diskutiert verschiedene Methoden zur Förderung dieser Kompetenz. Es werden Strategien sowohl für Lehrkräfte (Reduktion der Komplexität) als auch für Schüler (selbstständige Reduktion) vorgestellt. Das Kapitel legt den Grundstein für die methodischen Entscheidungen in der folgenden Planungsphase. Es wird der Unterschied zwischen aktiven und passiven Lernmethoden hervorgehoben und die Notwendigkeit eines selbständigen und aktiven Umgangs mit Karten betont.
3. Planung der Unterrichtsreihe: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert die Planung der Unterrichtsreihe zur Förderung der Kartenkompetenz. Es werden Bezüge zum Rahmenlehrplan hergestellt, die Lernvoraussetzungen der Schüler analysiert und eine Sachanalyse des inhaltlichen Schwerpunkts vorgenommen. Die didaktischen und methodischen Entscheidungen, einschließlich der Progression, Transparenz und des gewählten Auswertungsverfahrens, werden ausführlich dargelegt. Die „additive Schichtenmethode“ und die Bedeutung der Versprachlichungskompetenz werden als wichtige methodische Aspekte hervorgehoben. Hier wird die Grundlage für die Umsetzung im Unterricht gelegt, mit klaren Zielen und methodischen Ansätzen.
4. Durchführung und Reflexion ausgewählter Aspekte: Dieser Teil präsentiert und reflektiert ausgewählte Aspekte der Durchführung der Unterrichtsreihe. Die einzelnen Stunden werden analysiert und deren Ergebnisse diskutiert. Der Fokus liegt auf der Anwendung und Reflexion der gewählten Methoden. Das Kapitel beleuchtet die praktische Umsetzung und die gewonnenen Erkenntnisse im Unterricht.
Schlüsselwörter
Kartenkompetenz, Erdkundeunterricht, Karteninterpretation, Komplexitätsreduktion, Didaktik, Methodik, additive Schichtenmethode, Raumproblem Japan, Auswertungsverfahren, Lernprozess, Kompetenzorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsreihe: Förderung von Kartenkompetenz im Erdkundeunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Förderung von Kartenkompetenz im Erdkundeunterricht der 7. Klasse. Sie untersucht, ob und wie ausgewählte Methoden die Kartenkompetenz der Schüler verbessern. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Anwendung und Reflexion dieser Methoden im Unterricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Förderung der Kartenkompetenz, Methoden zur Reduktion von Kartenkomplexität, Integration von Karten in konkrete Fragestellungen, Entwicklung und Anwendung von Auswertungsverfahren und didaktische sowie methodische Entscheidungen im Geographieunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Kartenkompetenz im Erdkundeunterricht, Planung der Unterrichtsreihe, Durchführung und Reflexion ausgewählter Aspekte und Gesamtreflexion und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Kartenkompetenzförderung, von der theoretischen Fundierung bis zur praktischen Umsetzung und Reflexion.
Welche Methoden zur Komplexitätsreduktion werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt Methoden zur Komplexitätsreduktion sowohl für Lehrkräfte (z.B. selektive Informationsauswahl) als auch für Schüler (z.B. selbstständige Strukturierung) vor. Ein besonderer Fokus liegt auf der "additiven Schichtenmethode".
Wie wird die Kartenkompetenz gefördert?
Die Kartenkompetenz wird durch die sinnvolle Einbindung von Karten in einen konkreten Fragehorizont gefördert. Isolierte Einführungslehrgänge werden vermieden. Aktive und selbstständige Auseinandersetzung mit Karten steht im Vordergrund.
Welche Rolle spielt die "additive Schichtenmethode"?
Die "additive Schichtenmethode" ist eine wichtige methodische Grundlage der Unterrichtsreihe. Sie ermöglicht ein schrittweises Vorgehen beim Kartenverständnis und -interpretation.
Wie werden die Ergebnisse der Unterrichtsreihe evaluiert?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung und Anwendung eines Auswertungsverfahrens zur Evaluation der Unterrichtsreihe und der damit verbundenen Methoden. Die Reflexion der einzelnen Unterrichtsstunden liefert Erkenntnisse über die Wirksamkeit des gewählten Ansatzes.
Welche konkreten Beispiele werden im Kapitel "Durchführung und Reflexion" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert exemplarisch drei Unterrichtsstunden. Es werden die Zielsetzungen, die Kartenwahl, die Einbindung in die Fragestellung und die Arbeit mit den Karten detailliert beschrieben und reflektiert. Beispiele sind die Analyse des Raumproblems in Japan und die Untersuchung der Gewinnung und Nutzung von Neuland.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kartenkompetenz, Erdkundeunterricht, Karteninterpretation, Komplexitätsreduktion, Didaktik, Methodik, additive Schichtenmethode, Raumproblem Japan, Auswertungsverfahren, Lernprozess, Kompetenzorientierung.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit zitiert verschiedene Autoren wie Sperling, Altemüller, Hüttermann und Lenz, um die Bedeutung und Herausforderungen der Kartenarbeit im Unterricht zu untermauern.
- Citar trabajo
- Andreas Steiner (Autor), 2008, Japan - ein Land mit Raumproblemen - Erprobung ausgewählter Methoden zur Förderung der Kartenkompetenz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114816