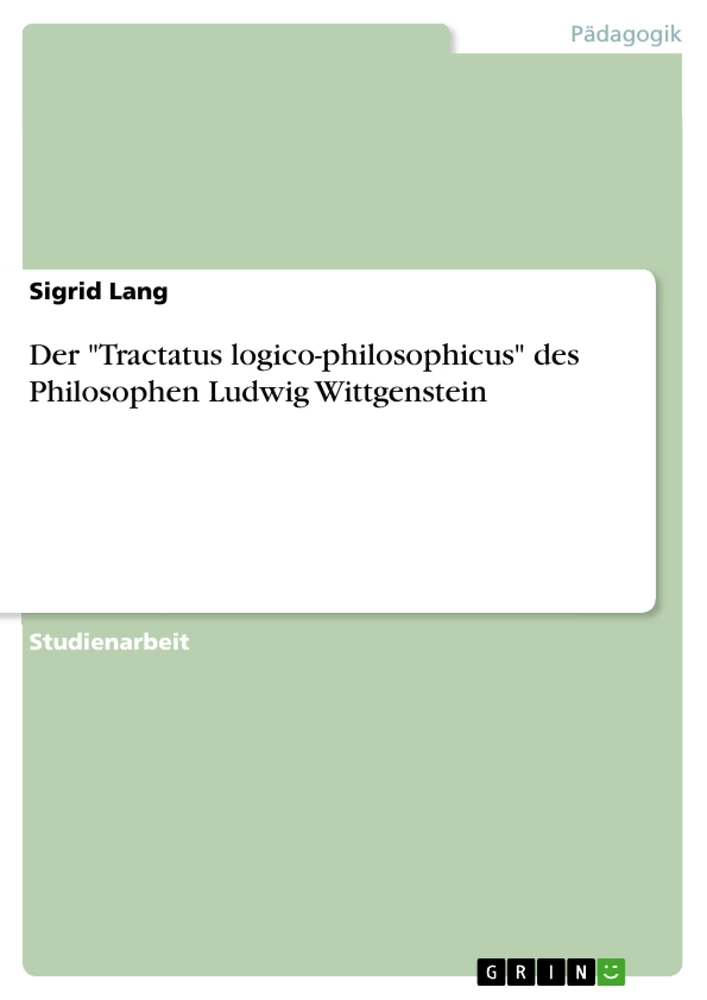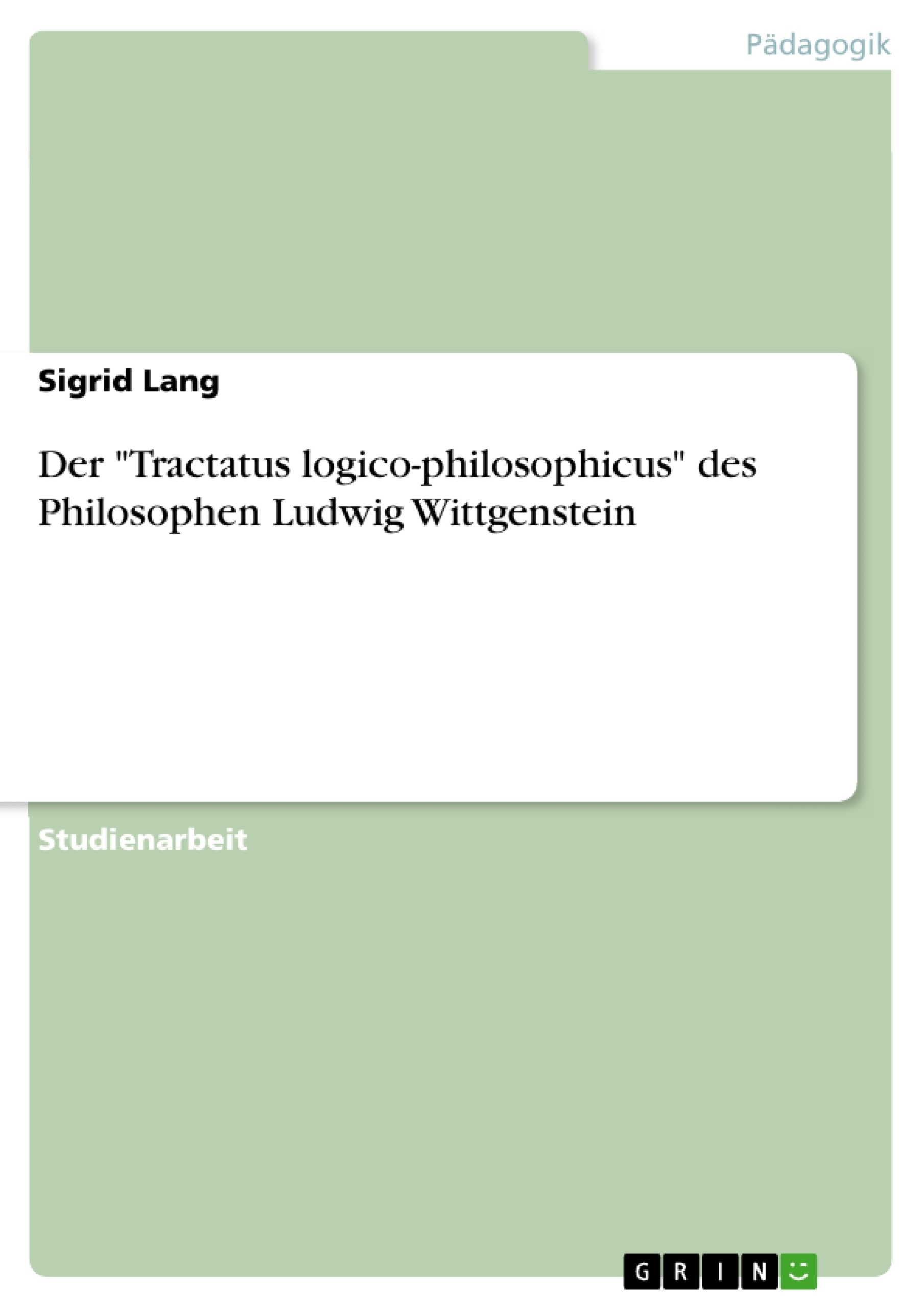Der Tractatus logico-philosophicus ist das wohl bedeutendste und größte Werk des Philosophen Ludwig Wittgenstein. Durch dieses Werk war er von großer Bedeutung für den logischen Positivismus oder logischen Empirismus. Diese Denkrichtung war eine von zweien, zu denen er den Anstoß gegeben hatte. (vgl. Wright 1986, S. 23)
Begonnen hatte Wittgenstein sein Werk bereits vor 1914, vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges und vor seinem 26. Lebensjahr. Der älteste Teil ist der der Logik. Dann, an der Ostfront im Herbst 1914, beschäftigte er sich mit dem Wesen eines sinnvollen Satzes. Auf die Idee dazu kam Ludwig Wittgenstein durch einen Zeitungsartikel über einen Autounfall, wo vor Gericht ein Miniaturmodell des Unfalls gezeigt wurde. Dadurch kam er darauf, den Satz als Modell oder Bild zu sehen. Seine Struktur ist Wittgensteins Ansicht nach ein Bild einer möglichen Verbindung von Elementen der Wirklichkeit. Während er im August 1918 auf Heimaturlaub war, vollendete er das Werk. Als er im Oktober 1918 gefangen genommen wurde und in ein italienisches Lager kam, hatte er sein Manuskript bei sich. Noch während er dort war, setzte er sich in Verbindung mit Russell, einem Freund und ließ ihm die Seiten zu kommen.
Gewidmet ist der Text David Pinsents, einem Freund Wittgensteins, der im Krieg gefallen ist. (vgl. ebd., S. 29 f.)
Der Titel des Tractatus war ursprünglich Logisch-philosophische Abhandlung. Wittgenstein selbst hatte seinem Manuskript diesen Namen gegeben. Erst durch die zweisprachige Ausgabe wurde der lateinische Titel bekannt. Vorgeschlagen hatte ihn G.E. Moore. Ludwig Wittgenstein benutzte ihn nie, sondern sprach immer nur von der Logisch-philosophischen Abhandlung. Trotzdem etablierte sich der fremdsprachige Name und wurde beibehalten (vgl. Vossenkuhl 2001, S. 2)
Bis heute ist der Tractatus das bekannteste der Werke Ludwig Wittgensteins. Auch weil es das einzige Buch ist, das er selbst veröffentlicht hat. Heute gilt der Tractatus als wichtigster Text zur philosophischen Logik.
Die Veröffentlichung dieser Abhandlung gestaltete sich als schwierig. Bereits kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begann Wittgenstein das Manuskript mehreren Verlagen anzubieten.
(...)
Inhaltsverzeichnis
- Der Tractatus logico-philosophicus
- Die Veröffentlichung des Tractatus
- Sprache und Aufbau der Werke Ludwig Wittgensteins
- Die Synthese des Tractatus
- Sagen und Zeigen
- Sagbares und Unsagbares
- Denken und Sprache
- Philosophie und Sprache
- Die philosophischen Probleme
- Die Störungen der Sprache
- Die Grundaussagen des Tractatus
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Tractatus logico-philosophicus von Ludwig Wittgenstein ist eine bedeutende philosophische Abhandlung, die sich mit den Grenzen der Sprache und des Denkens auseinandersetzt. Das Werk zielt darauf ab, die Beziehung zwischen Sprache, Wirklichkeit und Philosophie zu erforschen und die Grenzen des Sagbaren und des Denkbaren zu definieren.
- Die Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit
- Die Grenzen des Sagbaren und des Denkbaren
- Die Rolle der Philosophie in der Sprache
- Die Kritik an der traditionellen Metaphysik
- Die Bedeutung der Logik für das Verständnis der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Tractatus logico-philosophicus: In diesem Kapitel wird die Entstehung und Bedeutung des Tractatus logico-philosophicus beleuchtet. Es wird auf die Entstehungsgeschichte des Werkes eingegangen, die Herausforderungen bei der Veröffentlichung sowie die Bedeutung des Tractatus für die Philosophie und den logischen Positivismus.
- Die Veröffentlichung des Tractatus: Dieses Kapitel behandelt die Schwierigkeiten, die Wittgenstein bei der Veröffentlichung seines Werkes erlebte. Es werden die verschiedenen Verlage und die Gründe für die Ablehnung oder die gescheiterten Verhandlungen beschrieben.
- Sprache und Aufbau der Werke Ludwig Wittgensteins: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Stil und der Struktur der Werke Ludwig Wittgensteins. Es wird auf seine einfache und klare Sprache, die Verwendung von Aphorismen und die besondere Struktur seiner Werke eingegangen.
- Die Synthese des Tractatus: Dieses Kapitel erklärt die Synthese, die Wittgenstein im Tractatus vornimmt. Es wird auf die Theorie der Wahrheitsfunktionen und die Annahme, dass Sprache ein Bild der Wirklichkeit ist, eingegangen.
- Sagen und Zeigen: Dieses Kapitel behandelt die zentrale Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen im Tractatus. Es wird auf die Bedeutung dieser Unterscheidung für Wittgenstein und die Aufteilung des Tractatus in drei Teile eingegangen.
- Sagbares und Unsagbares: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Unterscheidung zwischen Sagbarem und Unsagbarem, die Wittgenstein im Tractatus vornimmt. Es wird auf die Frage nach dem Sinnvollen und Wissenschaftlichen Sprechens und die Einordnung der Metaphysik in den Bereich des Unsagbaren eingegangen.
- Denken und Sprache: Dieses Kapitel behandelt die enge Verbindung zwischen Denken und Sprache, die Wittgenstein im Tractatus postuliert. Es wird auf die Unzertrennlichkeit von Denken und Sprache und die Bedeutung dieser Verbindung für die Philosophie eingegangen.
- Philosophie und Sprache: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Sprache. Es wird auf die Rolle der Sprache in der Philosophie und die philosophischen Probleme, die aus einem Missverständnis der Logik unserer Sprache entstehen, eingegangen.
- Die philosophischen Probleme: Dieses Kapitel behandelt die philosophischen Probleme, die Wittgenstein im Tractatus untersucht. Es wird auf die Entstehung dieser Probleme aus Störungen der Sprache und falschen Denkgewohnheiten eingegangen.
- Die Störungen der Sprache: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Störungen der Sprache, die Wittgenstein als Ursache für philosophische Probleme ansieht. Es wird auf die Kritik an der menschlichen Zivilisation und die Hoffnung auf eine Veränderung der Kultur eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Tractatus logico-philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Sprache, Denken, Sagbares, Unsagbares, Philosophie, Logik, Wirklichkeit, Metaphysik, Denkgewohnheiten, Kultur und Zivilisation.
- Citar trabajo
- Sigrid Lang (Autor), 2005, Der "Tractatus logico-philosophicus" des Philosophen Ludwig Wittgenstein, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114825