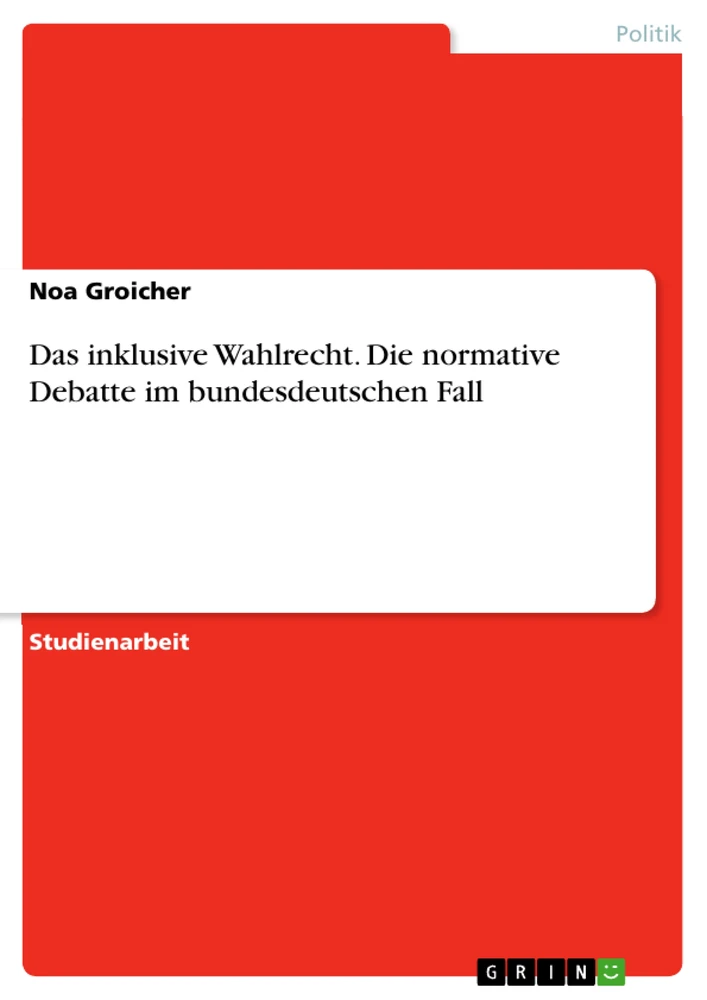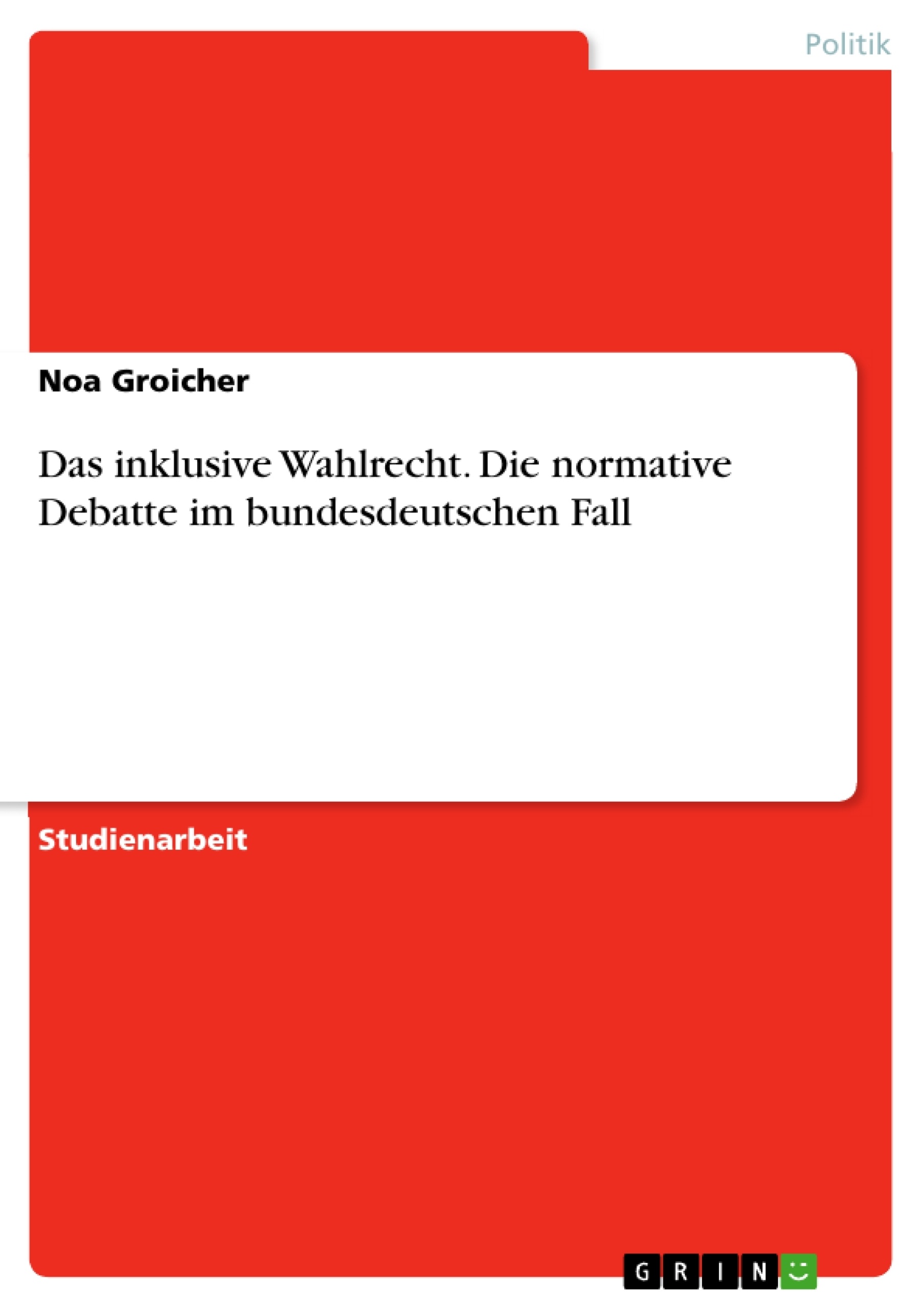Welcher Prozess führte zur Abschaffung von § 13 Nr. 2 BWG und ermöglichte ein inklusiveres Wahlrecht?
Zunächst einmal werden wichtige begriffliche Grundlagen (Wahlrecht, Inklusion, Betreuung in allen Angelegenheiten) geklärt. Anschließend wird auf die Geschichte der Wahlrechtsausschlüsse eingegangen und ein Überblick über aktuelle Ausschlüsse gegeben. Daran anschließend wird der Reformweg von § 13 Nr. 2 BWG näher beleuchtet. Es wird auf Landesebene begonnen, da hier bereits 2016 erste Reformen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erfolgten. Danach wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aufgegriffen, welche schließlich den Anstoß für die Abschaffung des Paragraphen auf Bundesebene gab. Die in den einzelnen Debatten verwendeten Argumente sollen anschließend sortiert und eingeordnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Grundlagen
- Wahlrecht und Wahlsystem
- Inklusion
- Vollbetreuung
- Ausschlüsse vom Wahlrecht
- Historische Entwicklung
- Aktuelle Ausschlüsse in Deutschland
- Staatsbürgerschaft
- Alter
- Straftäter
- Ausschluss aufgrund geistiger Behinderung
- Die Ausschlüsse vom Wahlrecht nach §13 Nr.2 BWG vor Mai 2019
- Nordrhein-Westfalen
- Schleswig-Holstein
- Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- Bundesebene
- Zusammenfassung der Argumente
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess der Abschaffung von § 13 Nr. 2 BWG, der bis 2019 Personen mit einem Betreuer in allen Angelegenheiten vom Wahlrecht ausschloss. Ziel ist es, die normative Debatte um ein inklusives Wahlrecht in Deutschland zu analysieren und die Schritte zur Erreichung eines inklusiveren Wahlrechts nachzuvollziehen.
- Begriffliche Klärung von Wahlrecht, Inklusion und Vollbetreuung
- Historische Entwicklung von Wahlrechtsausschlüssen in Deutschland
- Analyse der aktuellen Ausschlüsse vom Wahlrecht
- Detaillierte Betrachtung des Reformwegs von § 13 Nr. 2 BWG auf Landes- und Bundesebene
- Einordnung und Systematisierung der Argumente in der Debatte um das inklusive Wahlrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des inklusiven Wahlrechts in Deutschland ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Prozess der Abschaffung von § 13 Nr. 2 BWG in den Mittelpunkt. Sie verweist auf den Widerspruch zwischen dem im Grundgesetz verankerten Grundsatz der Allgemeinheit des Wahlrechts und dem Ausschluss bestimmter Gruppen, wie Personen unter Vollbetreuung. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die Fokussierung auf die Debatte um den Paragraphen und nicht nur auf die juristische Perspektive.
Begriffliche Grundlagen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe „Wahlrecht“ und „Wahlsystem“, die oft synonym verwendet werden, aber deutlich voneinander zu unterscheiden sind. Das Wahlrecht umfasst alle Aspekte der Wahlorganisation und -durchführung, während das Wahlsystem sich auf die Verwertung der abgegebenen Stimmen konzentriert. Weiterhin werden die Begriffe „Inklusion“ und „Vollbetreuung“ definiert und in Bezug zur Forschungsfrage gesetzt. Die klare Abgrenzung der Begriffe bildet die Grundlage für das weitere Verständnis der Arbeit.
Ausschlüsse vom Wahlrecht: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Wahlrechtsausschlüssen und gibt einen Überblick über aktuelle Ausschlüsse in Deutschland, darunter die Kriterien Staatsbürgerschaft, Alter und Straftaten. Die Einordnung dieser Ausschlüsse in den historischen und gesellschaftlichen Kontext liefert einen wichtigen Hintergrund für die spätere Diskussion um den Ausschluss von Menschen unter Vollbetreuung.
Ausschluss aufgrund geistiger Behinderung: Dieser Kapitelteil fokussiert sich auf den Ausschluss von Personen mit einem Betreuer in allen Angelegenheiten gemäß § 13 Nr. 2 BWG. Es werden die Entwicklungen auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein detailliert dargestellt, die bereits vor der bundesweiten Entscheidung Reformen einleiteten. Die entscheidende Rolle des Bundesverfassungsgerichts und die darauffolgende Abschaffung des Paragraphen auf Bundesebene wird hier ebenfalls erläutert. Die verschiedenen Argumente in der politischen Debatte werden zusammenfassend dargestellt, bevor sie im folgenden Kapitel weiter eingeordnet werden.
Schlüsselwörter
Inklusives Wahlrecht, § 13 Nr. 2 BWG, Vollbetreuung, Bundesverfassungsgericht, Wahlrecht, Inklusion, Demokratie, politische Teilhabe, normative Debatte, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Inklusives Wahlrecht in Deutschland - Die Abschaffung von § 13 Nr. 2 BWG
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert die Abschaffung von § 13 Nr. 2 BWG, der bis 2019 Personen mit einem Betreuer in allen Angelegenheiten vom Wahlrecht ausschloss. Es untersucht die normative Debatte um ein inklusives Wahlrecht in Deutschland und die Schritte zur Erreichung eines inklusiveren Wahlrechts.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Begriffliche Klärung von Wahlrecht und Inklusion, historische Entwicklung von Wahlrechtsausschlüssen in Deutschland, Analyse aktueller Ausschlüsse (Staatsbürgerschaft, Alter, Straftaten), detaillierte Betrachtung des Reformwegs von § 13 Nr. 2 BWG auf Landes- und Bundesebene, und eine Einordnung der Argumente in der Debatte um das inklusive Wahlrecht.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält folgende Kapitel: Einleitung, Begriffliche Grundlagen (Wahlrecht, Wahlsystem, Inklusion, Vollbetreuung), Ausschlüsse vom Wahlrecht (historische Entwicklung und aktuelle Ausschlüsse in Deutschland), Ausschluss aufgrund geistiger Behinderung (§ 13 Nr. 2 BWG, Entwicklungen in NRW und Schleswig-Holstein, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts), und Fazit/Ausblick.
Welche Rolle spielte das Bundesverfassungsgericht?
Das Bundesverfassungsgericht spielte eine entscheidende Rolle bei der Abschaffung von § 13 Nr. 2 BWG. Seine Entscheidung hatte weitreichende Folgen auf Bundesebene und beeinflusste die Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern.
Welche Entwicklungen gab es auf Landesebene?
Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein führten bereits vor der bundesweiten Entscheidung Reformen ein, die den Ausschluss von Menschen mit Betreuern vom Wahlrecht einschränkten. Diese Entwicklungen werden im Dokument detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Inklusives Wahlrecht, § 13 Nr. 2 BWG, Vollbetreuung, Bundesverfassungsgericht, Wahlrecht, Inklusion, Demokratie, politische Teilhabe, normative Debatte, Deutschland.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Ziel des Dokuments ist es, die normative Debatte um ein inklusives Wahlrecht in Deutschland zu analysieren und die Schritte zur Erreichung eines inklusiveren Wahlrechts nachzuvollziehen. Es konzentriert sich auf den Prozess der Abschaffung von § 13 Nr. 2 BWG.
Wie werden die Begriffe "Wahlrecht" und "Wahlsystem" definiert?
Das Wahlrecht umfasst alle Aspekte der Wahlorganisation und -durchführung, während das Wahlsystem sich auf die Verwertung der abgegebenen Stimmen konzentriert. Diese Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis des Dokuments.
Welche Argumente wurden in der Debatte um das inklusive Wahlrecht diskutiert?
Das Dokument fasst die verschiedenen Argumente in der politischen Debatte um den Ausschluss von Menschen mit Betreuern vom Wahlrecht zusammen und ordnet sie systematisch ein.
- Citation du texte
- Noa Groicher (Auteur), 2020, Das inklusive Wahlrecht. Die normative Debatte im bundesdeutschen Fall, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149703