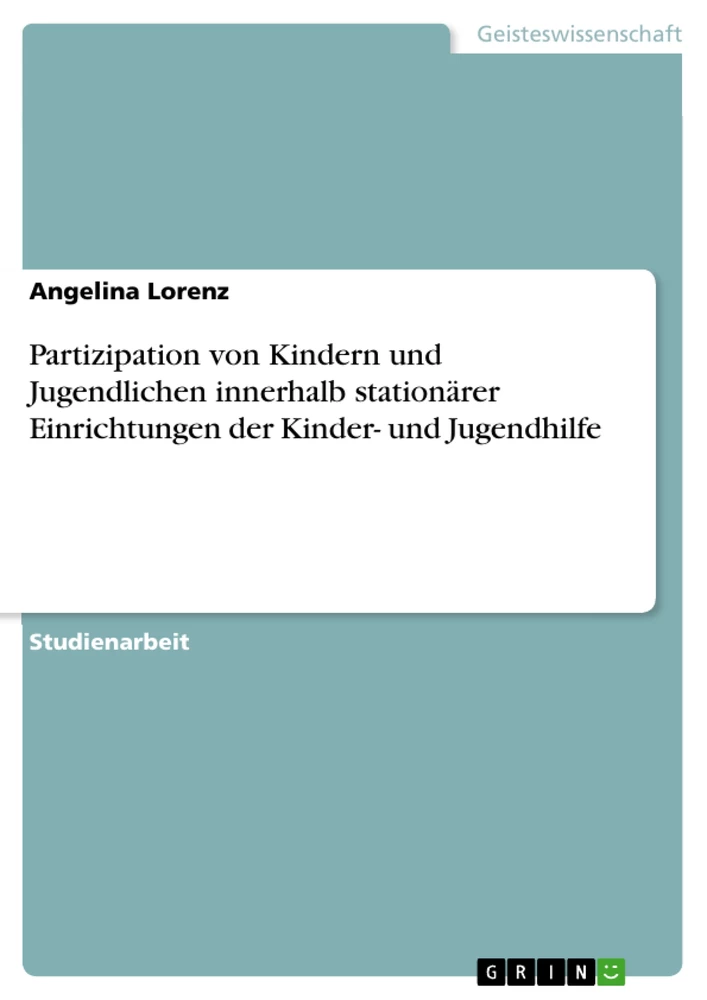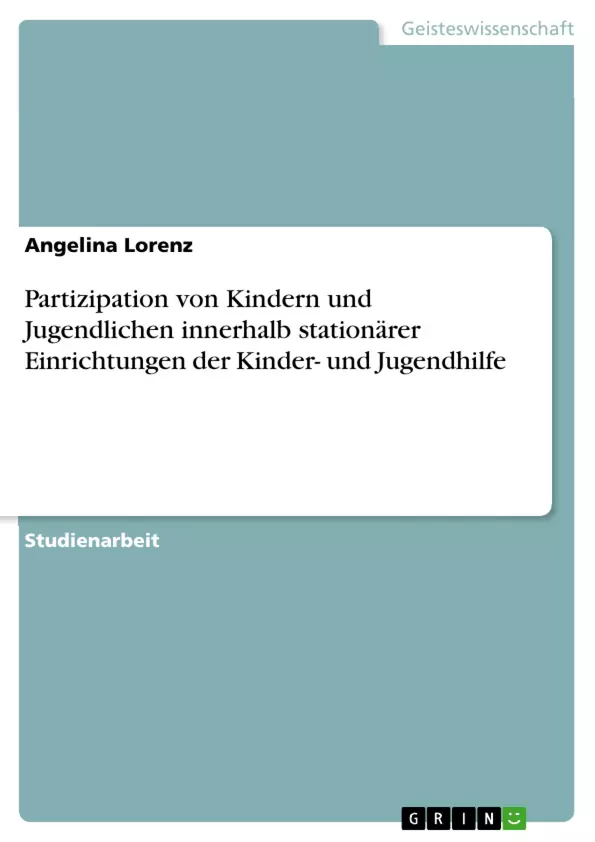Wie gestaltet sich die aktuelle Situation der Partizipation, wenn man auf die Jüngsten unserer heutigen Gesellschaft schaut? Bietet sich Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu partizipieren? Die Frage dient als Ausgangspunkt der Arbeit. Sie führt zu der Überlegung, wie genau partizipatorische Prozesse eigentlich ausgestaltet werden können und damit zum maßgebenden Thema der Arbeit – Empowerment.
Das Thema der Arbeit wird unter dem Aspekt der „Partizipation von Kindern und Jugendlichen innerhalb stationärer Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ eingegrenzt. Das Ziel der Seminararbeit ist es, herauszufinden, welche Beteiligungsformen innerhalb stationärer Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe anwendbar sind. Weiterhin soll geprüft werden, ob und wie die Partizipation Kinder und Jugendlicher nach momentanem Stand in den Kinder- und Jugendheimen Deutschlands gelingt oder inwieweit die bisher praktizierten Methoden ausbaufähig sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärungen
- Empowerment
- Partizipation
- Rechtliche Grundlagen
- UN-Kinderrechtskonvention
- SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe
- Inhalt und Reichweite von Partizipation
- Stufen der Beteiligung nach Schröder (1995)
- Beteiligungsformen
- Beteiligung im Heimalltag - Praxisbausteine nach Wolff und Hartig
- Zusammenfassung
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie untersucht, welche Beteiligungsformen anwendbar sind und ob die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Praxis gelingt.
- Der Begriff Empowerment und seine Relevanz im Kontext von Partizipation.
- Rechtliche Grundlagen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
- Stufen und Formen der Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe.
- Praxisbausteine für die Förderung von Partizipation im Heimalltag.
- Potenziale und Herausforderungen für die Umsetzung von Partizipation.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Partizipation im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
Das Kapitel "Begriffserklärungen" definiert die zentralen Begriffe Empowerment und Partizipation, wobei verschiedene Zugänge zu einer Definition von Empowerment vorgestellt werden.
Das Kapitel "Rechtliche Grundlagen" beleuchtet die UN-Kinderrechtskonvention und das SGB VIII als maßgebliche rechtliche Rahmenbedingungen für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
Im Kapitel "Inhalt und Reichweite von Partizipation" werden Stufen der Beteiligung nach Schröder (1995) und verschiedene Beteiligungsformen in der Praxis vorgestellt.
Das Kapitel "Beteiligung im Heimalltag - Praxisbausteine nach Wolff und Hartig" zeigt konkrete Ansätze für die Förderung von Partizipation im alltäglichen Leben von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen.
Schlüsselwörter
Partizipation, Empowerment, Kinder- und Jugendhilfe, stationäre Einrichtungen, Beteiligungsformen, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Selbstständigkeitserziehung, Rechtliche Grundlagen, UN-Kinderrechtskonvention, SGB VIII.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Empowerment im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe?
Empowerment beschreibt den Prozess, durch den Kinder und Jugendliche befähigt werden, ihre eigenen Interessen selbstbestimmt zu vertreten und Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen. Es ist die Grundlage für echte Partizipation.
Welche rechtlichen Grundlagen garantieren die Beteiligung von Kindern?
Die wichtigsten Grundlagen sind die UN-Kinderrechtskonvention und das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Diese verpflichten Einrichtungen dazu, Kinder und Jugendliche an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, zu beteiligen.
Welche Stufen der Beteiligung gibt es nach Schröder?
Das Modell nach Schröder (1995) unterscheidet verschiedene Stufen der Beteiligung, die von bloßer Information über Mitwirkung bis hin zur vollständigen Mitbestimmung und Selbstverwaltung reichen.
Wie kann Partizipation im Heimalltag praktisch umgesetzt werden?
Praxisbausteine nach Wolff und Hartig schlagen konkrete Ansätze vor, wie z.B. Gruppenabende, Beschwerdemanagement, Mitbestimmung bei der Zimmergestaltung oder die Wahl von Gruppensprechern.
Gelingt die Partizipation in deutschen Kinderheimen aktuell gut?
Die Seminararbeit untersucht kritisch den aktuellen Stand und kommt zu dem Schluss, dass zwar viele Ansätze existieren, die praktizierten Methoden jedoch oft noch ausbaufähig sind, um eine echte Selbstständigkeitserziehung zu gewährleisten.
- Arbeit zitieren
- Angelina Lorenz (Autor:in), 2021, Partizipation von Kindern und Jugendlichen innerhalb stationärer Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151188