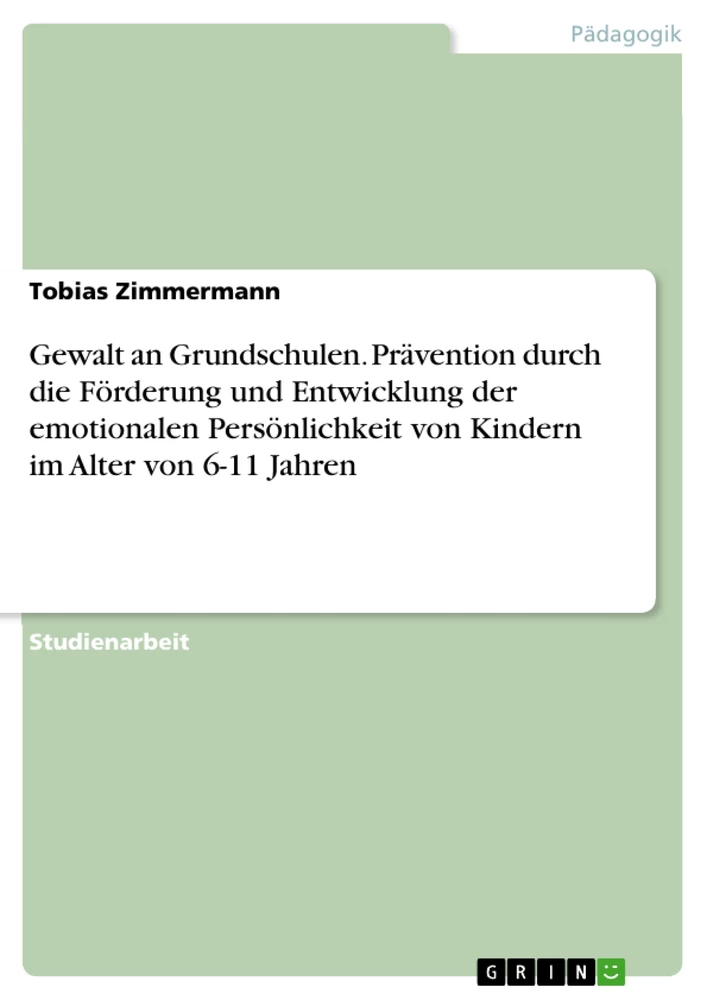Wo liegt die Ursache für gewalttätiges Verhalten? Welchen Teil kann die Schule oder KiTa dazu beitragen, die Gewalt in der Schule und letztendlich auch in der Gesellschaft zu minimieren?
Für diese Arbeit stelle ich folgende These: Könnte die Stärkung der emotionalen Persönlichkeit (emotionales Verständnis, emotionale Regulierung) beziehungsweise die Förderung der emotionalen oder sozialen Kompetenzen die Gewaltprävention in Schulen positiv beeinflussen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wird in dieser Arbeit der "Emotional literacy" Ansatz erläutert. Dafür wird erst die Gewalt in (Grund-) Schulen betrachtet und zwischen Aggression und Gewalt differenziert, um ein genaueres Bild der Gewalt in Schulen zu bekommen. In der Betrachtung der emotionalen Persönlichkeitsentwicklung werden die Grundlagen von Emotionen erarbeitet und anschießend wird ein Projekt von Petermann et al., "Emotionstraining in der Schule", vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewalt an (Grund-)Schulen
- Forschung über Gewalt an Schulen
- Definition von Gewalt und Aggression
- Formen von Gewalt
- Mögliche Ursachen von Gewalt
- Emotionen von der Entwicklung bis zu Forschung
- Grundverständnis von Emotionen
- Die Entwicklung der emotionalen Persönlichkeit
- Grundzüge der Emotionsentwicklung von Grundschulkindern
- Prävention negativer Entwicklung bei der Förderung von sozialer Kompetenz
- Emotional literacy
- Emotionstraining in der Schule
- Empirische Fundierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Förderung der emotionalen Persönlichkeit und der Prävention von Gewalt an Grundschulen. Das Hauptziel ist es, die These zu überprüfen, ob die Stärkung emotionaler und sozialer Kompetenzen einen positiven Einfluss auf die Gewaltprävention hat.
- Gewalt an Grundschulen: Ausmaß, Formen und Ursachen
- Definition und Differenzierung von Gewalt und Aggression
- Entwicklung der emotionalen Persönlichkeit bei Grundschulkindern
- Ansätze zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen (z.B. Emotional Literacy)
- Empirische Fundierung von Präventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Gewaltprävention an Grundschulen ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss der emotionalen Persönlichkeitsentwicklung auf die Reduktion von Gewalt dar. Sie verweist auf die hohe Relevanz des Themas im Kontext gesellschaftlicher Gewalt und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf den „Emotional literacy“ Ansatz konzentriert und die Gewalt an Grundschulen, die Definition von Gewalt und Aggression sowie die emotionale Persönlichkeitsentwicklung beleuchtet. Die These der Arbeit ist, dass die Stärkung der emotionalen Persönlichkeit die Gewaltprävention positiv beeinflussen kann.
Gewalt an (Grund-)Schulen: Dieses Kapitel beleuchtet das Ausmaß von Gewalt an Grundschulen anhand von Statistiken und aktuellen Beispielen. Es zeigt, dass Gewalt in Schulen ein relevantes Problem darstellt, obwohl genaue Statistiken zum Ausmaß und den Formen der Gewalt fehlen. Das Kapitel verweist auf die Notwendigkeit, Gewalt an Grundschulen ernst zu nehmen und präventive Maßnahmen zu entwickeln.
Emotionen von der Entwicklung bis zu Forschung: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der emotionalen Persönlichkeit von Grundschulkindern. Es liefert ein Grundverständnis von Emotionen und deren Entwicklung, um die Grundlage für ein Verständnis der Bedeutung emotionaler Kompetenz im Kontext der Gewaltprävention zu schaffen. Der Fokus liegt auf der emotionalen Entwicklung von Kindern im Grundschulalter und legt damit den theoretischen Rahmen für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen emotionaler Kompetenz und Gewaltprävention.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Grundschule, Emotionale Kompetenz, Soziale Kompetenz, Emotional Literacy, Aggression, Gewalt, Emotionsentwicklung, Prävention, Soziales Lernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewaltprävention an Grundschulen durch Förderung emotionaler Kompetenz
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Förderung der emotionalen Persönlichkeit und der Prävention von Gewalt an Grundschulen. Das Hauptziel ist es, zu überprüfen, ob die Stärkung emotionaler und sozialer Kompetenzen einen positiven Einfluss auf die Gewaltprävention hat.
Welche Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte, darunter das Ausmaß und die Formen von Gewalt an Grundschulen, die Definition und Differenzierung von Gewalt und Aggression, die Entwicklung der emotionalen Persönlichkeit bei Grundschulkindern, Ansätze zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen (wie z.B. Emotional Literacy) und die empirische Fundierung von Präventionsmaßnahmen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Gewalt an Grundschulen, Emotionen und deren Entwicklung, Prävention durch Förderung sozialer Kompetenz und ein Fazit. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Hat die Stärkung emotionaler und sozialer Kompetenzen einen positiven Einfluss auf die Gewaltprävention an Grundschulen?
Welche Rolle spielt "Emotional Literacy"?
"Emotional Literacy" spielt eine zentrale Rolle als Ansatz zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen in der Prävention von Gewalt an Grundschulen. Die Arbeit konzentriert sich auf diesen Ansatz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewaltprävention, Grundschule, Emotionale Kompetenz, Soziale Kompetenz, Emotional Literacy, Aggression, Gewalt, Emotionsentwicklung, Prävention, Soziales Lernen.
Was ist das Fazit der Arbeit (vorläufig)?
Das vorläufige Fazit wird im letzten Kapitel präsentiert und fasst die Ergebnisse der Untersuchung zum Zusammenhang zwischen emotionaler Persönlichkeitsentwicklung und Gewaltprävention zusammen. Die These der Arbeit ist, dass die Stärkung der emotionalen Persönlichkeit die Gewaltprävention positiv beeinflussen kann.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit skizziert einen methodischen Ansatz, der sich auf den "Emotional literacy" Ansatz konzentriert und die Gewalt an Grundschulen, die Definition von Gewalt und Aggression sowie die emotionale Persönlichkeitsentwicklung beleuchtet. Die genaue Methodik wird im Detail im Haupttext der Arbeit beschrieben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Schulpsychologen, Sozialarbeiter und alle, die sich mit Gewaltprävention an Grundschulen auseinandersetzen. Sie bietet Erkenntnisse und Ansätze zur Verbesserung der emotionalen und sozialen Kompetenz von Kindern.
- Quote paper
- Tobias Zimmermann (Author), 2019, Gewalt an Grundschulen. Prävention durch die Förderung und Entwicklung der emotionalen Persönlichkeit von Kindern im Alter von 6-11 Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1153874