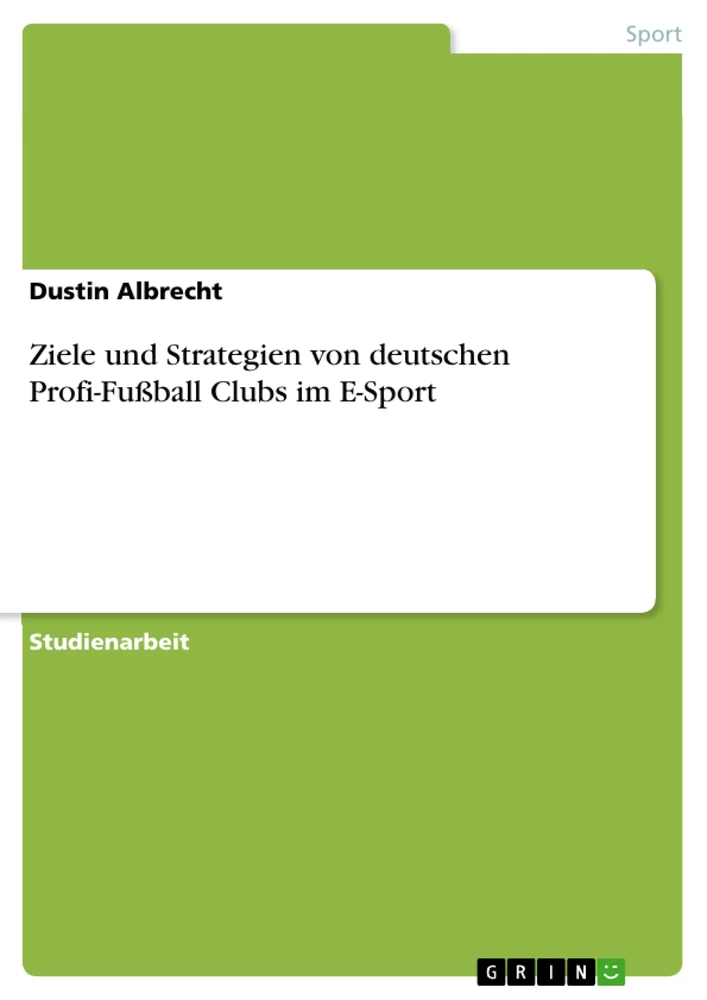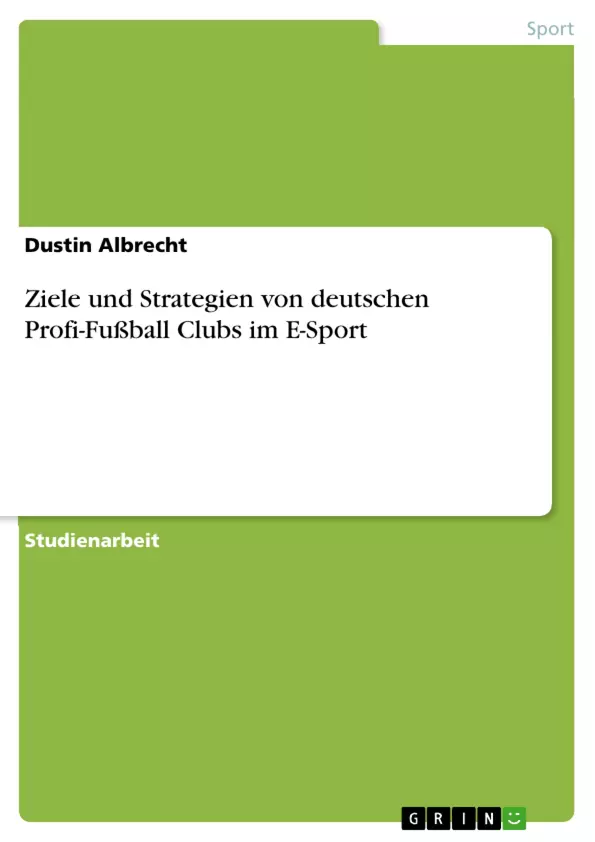Die folgende Hausarbeit beschäftigt sich im Kern mit den Zielen und Strategien von deutschen Profi-Fußball Clubs im eSport.
Einleitend stehen die Grundlagen des eSports im Mittelpunkt der Betrachtung. Im ersten Abschnitt erfolgt die Darstellung der Virtual Bundesliga, indessen ein kurzer Überblick über die Wettkampfstruktur verdeutlicht wird. Zentrum des zweiten Abschnittes sind die Stakeholder des eSports. Im vordergründigen Interesse stehen hier die Vereine, Fans, Sponsoren, eSportler, Publisher und eSport-Agenturen. Das dritte Kapitel umfasst anschließend die Ziele und Motive der Vereine. In diesem Zusammenhang ist allerdings festzuhalten, dass aufgrund des Umfangs der Hausarbeit keine Aufschlüsselung der individuellen Absichten eines jeden einzelnen Vereins gegeben werden kann. Vielmehr wird eine Übersicht über zentral benannte Zielformulierungen gegeben. Die Strategien der Clubs bilden nachfolgend das Hauptaugenmerk des 4. Kapitels. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Darstellung hinsichtlich des Aufbaus der Teams, sowie der strukturellen Eingliederung des eSports in den Verein. Aufgrund der Vielzahl an Vereinen im deutschen Profi-Fußball wird das Kapitel auf die 1. und 2. Bundesliga begrenzt. Mögliche Risiken eines eSport-Engagements kennzeichnen anschließend den vorletzten Abschnitt der wissenschaftlichen Ausarbeitung. Letztlich bildet in Kapitel 6 die Zusammenfassung den Abschluss der Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen des eSports im deutschen Profi-Fußball
- 2.1 Die Virtual Bundesliga
- 2.2 Stakeholder
- 2.2.1 Vereine
- 2.2.2 Fans
- 2.2.3 eSportler
- 2.2.4 Publisher
- 2.2.5 Sponsoren
- 2.2.6 eSport-Agenturen
- 3. Ziele und Motive
- 3.1 Zielgruppe
- 3.2 Markeneffekte
- 3.3 Umsatzströme
- 3.4 Sponsoren und Kooperationen
- 3.5 Digitale Transformation
- 3.6 Internationalisierung
- 4. eSport im deutschen Profi-Fußball - Strategien
- 4.1 Erste Fußballbundesliga
- 4.2 Zweite Fußballbundesliga
- 4.3 Kategorisierung
- 5. Risiken
- 6. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Zielen und Strategien von deutschen Profi-Fußball Clubs im E-Sport. Sie analysiert die Grundlagen des E-Sports im deutschen Profi-Fußball, insbesondere die Virtual Bundesliga und die relevanten Stakeholder wie Vereine, Fans, Sponsoren, eSportler, Publisher und eSport-Agenturen. Anschließend werden die Ziele und Motive der Vereine im Bereich des E-Sports beleuchtet, gefolgt von einer Darstellung der Strategien und der Risikofaktoren, die mit einem Engagement im E-Sport verbunden sind.
- Grundlagen des E-Sports im deutschen Profi-Fußball
- Ziele und Motive der Vereine
- Strategien der Vereine im E-Sport
- Risikofaktoren eines E-Sport-Engagements
- Zusammenfassung und Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz eines Engagements im E-Sport für den deutschen Profi-Fußball dar, beleuchtet den wachsenden Markt und die bisherigen Schritte von Vereinen wie dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04. Außerdem wird der Fokus der Hausarbeit auf die Ziele und Strategien von Vereinen im E-Sport definiert.
- Kapitel 2: Grundlagen des eSports im deutschen Profi-Fußball: Dieses Kapitel behandelt die Virtual Bundesliga als Plattform für E-Sport im Fußball, erläutert die Struktur des Wettkampfs und stellt die wichtigsten Stakeholder des E-Sports vor, darunter Vereine, Fans, Sponsoren, eSportler, Publisher und eSport-Agenturen.
- Kapitel 3: Ziele und Motive: In diesem Kapitel werden die Ziele und Motive der Vereine im E-Sport beleuchtet. Es geht um die Zielgruppe, die Markeneffekte, die Umsatzströme, die Möglichkeiten von Sponsoren und Kooperationen, die digitale Transformation und die Internationalisierung, die durch den E-Sport ermöglicht werden.
- Kapitel 4: eSport im deutschen Profi-Fußball - Strategien: Dieses Kapitel fokussiert auf die Strategien der Vereine im E-Sport. Es wird untersucht, wie Teams aufgebaut werden, der E-Sport in den Verein integriert wird und welche Strategien in der 1. und 2. Bundesliga verfolgt werden.
- Kapitel 5: Risiken: Das Kapitel widmet sich den möglichen Risiken eines Engagements im E-Sport.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen E-Sport im deutschen Profi-Fußball, Virtual Bundesliga, Stakeholder, Ziele und Motive von Vereinen, Strategien im E-Sport, Risiken des Engagements im E-Sport, digitale Transformation, Internationalisierung, Sponsoren und Kooperationen.
Häufig gestellte Fragen
Warum engagieren sich Profi-Fußballclubs im E-Sport?
Clubs nutzen E-Sport, um jüngere Zielgruppen zu erreichen, ihre Marke digital zu transformieren, neue Umsatzströme durch Sponsoren zu generieren und ihre Internationalisierung voranzutreiben.
Was ist die Virtual Bundesliga (VBL)?
Die VBL ist ein von der DFL organisierter E-Sport-Wettbewerb, in dem Spieler für die Vereine der 1. und 2. Bundesliga in der Fußballsimulation FIFA (jetzt EA Sports FC) antreten.
Welche Stakeholder sind im E-Sport relevant?
Wichtige Akteure sind die Vereine selbst, die Fans, die professionellen E-Sportler, Spiele-Publisher (wie EA), Sponsoren und spezialisierte E-Sport-Agenturen.
Welche Strategien verfolgen die Clubs beim Teamaufbau?
Einige Vereine gründen eigene Abteilungen und stellen E-Sportler direkt an, während andere mit bestehenden E-Sport-Organisationen kooperieren oder sich zunächst auf Marketing-Events beschränken.
Gibt es Risiken beim E-Sport-Engagement für Fußballvereine?
Ja, Risiken bestehen in einer möglichen Image-Verwässerung, finanziellen Fehlinvestitionen oder Vorbehalten der traditionellen Fanbasis gegenüber dem digitalen Sport.
- Arbeit zitieren
- Dustin Albrecht (Autor:in), 2020, Ziele und Strategien von deutschen Profi-Fußball Clubs im E-Sport, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1157554