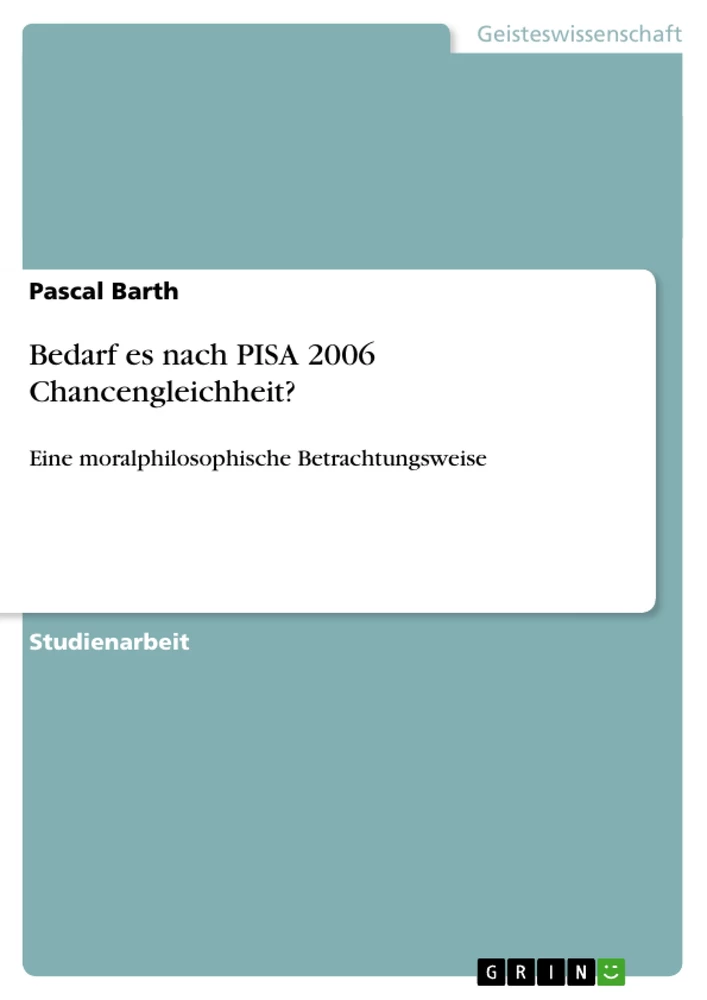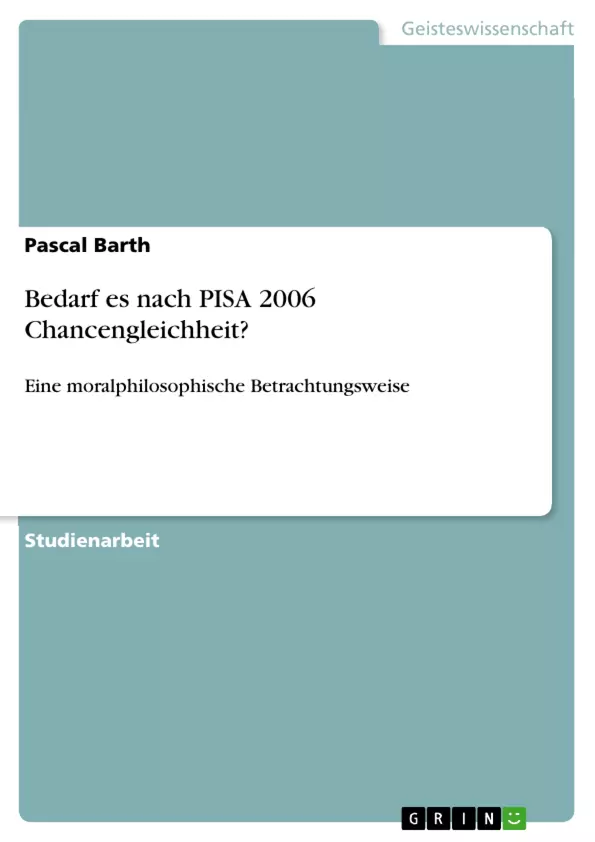Durch eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der 3. PISA-Studie, PISA-2006, wird aufgezeigt, dass sozialschichtspezifische Disparitäten keine rein statistischen Ungleichheiten sind. Sozial ungleicher Kompetenzerwerb und ungleiche Bildungsbeteiligung sind auf konkrete Mechanismen zurückzuführen, welche die Manifestation bildungsrelevanter Fähigkeiten depravierter Bevölkerungsgruppen wirksam unterbinden. Tatsächlich gleiche Chancen auf eine
höhere Bildung ließen sich nur durch gentechnische Manipulation am Menschen sowie eine egalitäre und zugleich rigorose Sozialisation durch den Staat verwirklichen.
Beides kann jedoch nicht gleicher Chancen wegen in Kauf genommen werden. Somit stellt sich die Frage, weshalb es Chancengleichheit überhaupt geben soll. Durch eine differenzierte Be-trachtung des Chancengleichheitsbegriffes wird aufgezeigt, dass „Chancengleichheit“ unabdingbar mit dem Grundwert der „Gerechtigkeit“ verbunden ist. Dieser Umstand eröffnet eine Diskussion auf moralphilosophischer Ebene. Anhand zeitgenössischer Gerechtigkeitstheorien sucht
der Autor die Frage zu klären, ob es nach PISA 2006 Chancengleichheit bedarf. Er zeigt dabei auf, dass John Rawls, Robert Nozick und Michel Walzer in Hinblick auf Notwendigkeit und Ausgestaltung von Chancengleichheit zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Die ethische Fragestellung ist von hoher sozialarbeiterischer Relevanz, als Sozialarbeit eine Profession ist, die sich dem Grundwert der Gerechtigkeit verpflichtet. Zeitgenössische Gerechtigkeitstheorien beanspruchen für sich, konkrete Aussagen zu formulieren welche Verhältnisse als
gerecht und welche als ungerecht zu bewerten sind. Die vorliegende Arbeit ermöglicht eine um-fassende Reflexion der Gerechtigkeitsfrage, da die Essenz von Rawls, Nozicks und Walzers Gerechtigkeitstheorien wiedergegeben und zu einander in Beziehung gesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialschichtspezifische Disparitäten nach PISA 2006
- Verwendete Indizes
- Soziale Herkunft und Kompetenzerwerb
- Sozialer Gradient der naturwissenschaftlichen Kompetenz
- Naturwissenschaftliche Kompetenz und Varianzaufklärung durch den sozioökonomischen Status
- Lesekompetenz nach EGP-Klassenzugehörigkeit
- Bildungsbeteiligung nach sozialer Herkunft
- Zusammenfassung
- Schichtspezifische Disparitäten gleich ungleiche Bildungschancen?
- Entstehung und Reproduktion sozialer Ungleichheit der Bildungschancen
- Faktische Ungleichheit von Bildungschancen und hypothetische Konsequenzen
- Definitionen
- Chancengleichheit und das Verhältnis zur Gerechtigkeit
- Gebrauchsvarianten und Systematisierung
- Primärobjekt der Gerechtigkeit
- Unterschiedliche Gestalten von Gerechtigkeitstheorien
- Egalisierungsoptionen und Chancengleichheit
- Chancengleichheit unter Betrachtung zeitgenössischer Gerechtigkeitstheorien
- John Rawls Theorie der Gerechtigkeit
- Das Prinzip der fairen Chancengleichheit
- Die endgültigen Gerechtigkeitsgrundsätze und Vorrangregeln
- Robert Nozicks Anspruchstheorie
- Chancengleichheit aus anspruchstheoretischer Perspektive
- Michael Walzers Sphärentheorie der Gerechtigkeit
- Walzers Gütertheorie
- Der Pascal'sche Gedanke
- Komplexe Gleichheit als Metaprinzip der Sphärenautonomie
- Drei Distributionsprinzipien
- Die Sphäre der Bildung und Erziehung
- Ergebnisegalitarismus im Elementarbereich
- Höhere Bildung
- John Rawls Theorie der Gerechtigkeit
- Resümee
- Quellenangaben
- Literaturverzeichnis
- Internetquellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es nach den Ergebnissen der PISA-Studie 2006 Chancengleichheit bedarf. Sie analysiert die sozialschichtspezifischen Disparitäten im Bildungssystem, die durch die PISA-Studie aufgezeigt wurden, und untersucht die Ursachen und Folgen dieser Ungleichheiten. Die Arbeit setzt sich mit dem Begriff der Chancengleichheit auseinander und betrachtet ihn im Kontext verschiedener Gerechtigkeitstheorien. Ziel ist es, die ethische Dimension der Chancengleichheitsdebatte zu beleuchten und die Frage zu beantworten, ob und in welcher Form Chancengleichheit im Bildungssystem notwendig ist.
- Sozialschichtspezifische Disparitäten im Bildungssystem
- Ursachen und Folgen sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich
- Der Begriff der Chancengleichheit und seine ethische Dimension
- Gerechtigkeitstheorien und ihre Implikationen für die Chancengleichheitsdebatte
- Notwendigkeit und Ausgestaltung von Chancengleichheit im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Leitfragen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die mediale Rezeption der PISA-Studie 2006 und zeigt auf, dass die Forderung nach Chancengleichheit in einem normativen Kontext steht.
Kapitel 2 analysiert die sozialschichtspezifischen Disparitäten im Bildungssystem anhand der Ergebnisse der PISA-Studie 2006. Es werden die verwendeten Indizes vorgestellt und die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb untersucht. Die Kapitel beleuchtet den sozialen Gradienten der naturwissenschaftlichen Kompetenz, die Varianzaufklärung durch den sozioökonomischen Status und die Lesekompetenz nach EGP-Klassenzugehörigkeit.
Kapitel 3 setzt sich mit der Frage auseinander, ob schichtspezifische Disparitäten gleich ungleiche Bildungschancen bedeuten. Es wird die Entstehung und Reproduktion sozialer Ungleichheit der Bildungschancen analysiert.
Kapitel 4 beleuchtet die faktische Ungleichheit von Bildungschancen und diskutiert hypothetische Konsequenzen dieser Ungleichheit.
Kapitel 5 definiert den Begriff der Chancengleichheit.
Kapitel 6 untersucht das Verhältnis von Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Es werden verschiedene Gebrauchsvarianten des Chancengleichheitsbegriffs vorgestellt und das Primärobjekt der Gerechtigkeit diskutiert.
Kapitel 7 stellt verschiedene Gerechtigkeitstheorien vor und analysiert ihre unterschiedlichen Gestalten. Es werden verschiedene Egalisierungsoptionen und ihre Beziehung zur Chancengleichheit betrachtet.
Kapitel 8 untersucht die Frage, ob es nach PISA 2006 Chancengleichheit bedarf, anhand der Gerechtigkeitstheorien von John Rawls, Robert Nozick und Michel Walzer. Es werden die jeweiligen Positionen dieser Denker in Bezug auf die Notwendigkeit und Ausgestaltung von Chancengleichheit dargestellt.
Kapitel 9 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Resümee.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die PISA-Studie 2006, sozialschichtspezifische Disparitäten, Chancengleichheit, Gerechtigkeit, Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Kompetenzerwerb, Bildungsbeteiligung, Gerechtigkeitstheorien, John Rawls, Robert Nozick, Michael Walzer.
Häufig gestellte Fragen
Was zeigte die PISA-Studie 2006 bezüglich der Chancengleichheit?
PISA 2006 verdeutlichte starke sozialschichtspezifische Disparitäten: Der Kompetenzerwerb und die Bildungsbeteiligung in Deutschland hängen massiv von der sozialen Herkunft ab.
Was versteht John Rawls unter fairer Chancengleichheit?
Rawls fordert, dass Menschen mit gleichen Talenten und gleicher Bereitschaft dieselben Erfolgschancen haben müssen, unabhängig von ihrer sozialen Klasse.
Welche Position vertritt Robert Nozick zur Gerechtigkeit?
Nozick lehnt staatliche Umverteilung zur Herstellung von Chancengleichheit ab und betont stattdessen die individuelle Freiheit und den rechtmäßigen Anspruch auf Eigentum.
Was ist Michael Walzers Konzept der "komplexen Gleichheit"?
Walzer argumentiert, dass verschiedene Lebensbereiche (Sphären) ihre eigenen Verteilungsregeln haben sollten und dass Vorteile in einer Sphäre (z.B. Geld) nicht automatisch Vorteile in einer anderen (z.B. Bildung) kaufen dürfen.
Warum ist die Gerechtigkeitsfrage für die Sozialarbeit wichtig?
Sozialarbeit ist eine Profession, die sich dem Grundwert der Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Gerechtigkeitstheorien bieten den ethischen Rahmen, um ungerechte Verhältnisse zu bewerten und zu verändern.
- Citar trabajo
- Pascal Barth (Autor), 2008, Bedarf es nach PISA 2006 Chancengleichheit?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115905