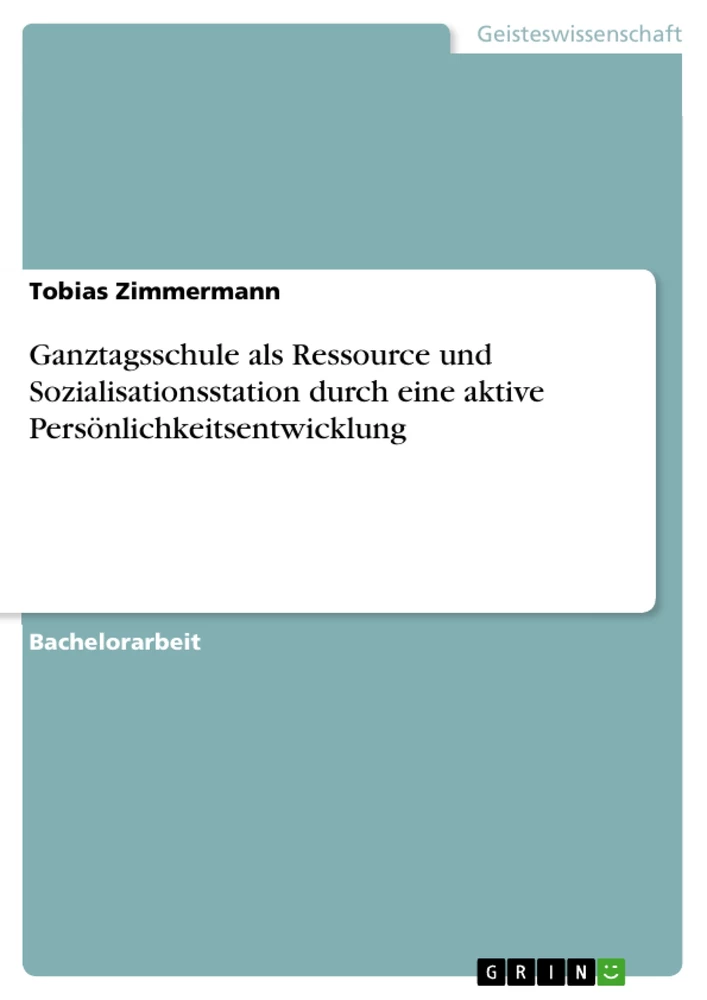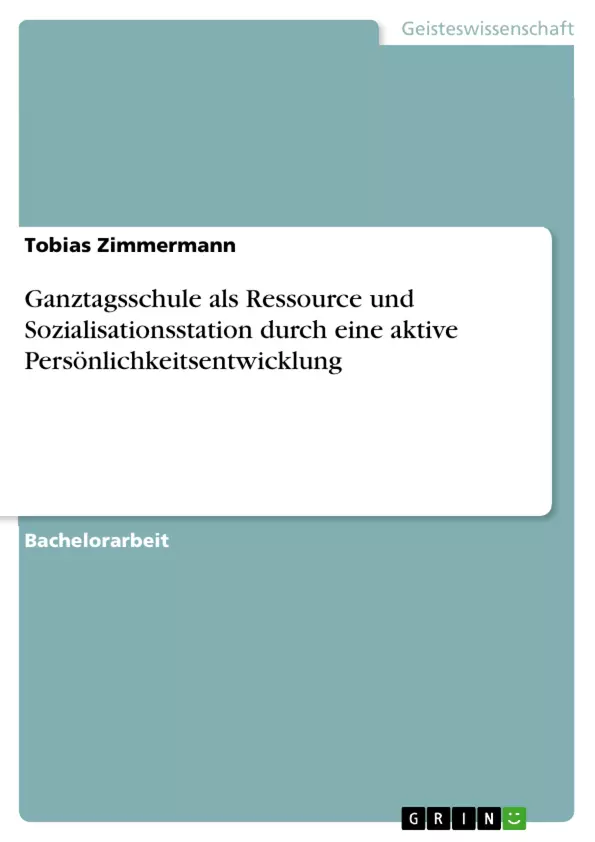Das Ziel dieser Forschung ist zu bestimmen, ob die Ganztagsschule als Ressource für Multiproblemfamilien dienlich ist. Dabei entsteht im Laufe der Arbeit der Schwerpunkt, welcher sich auf den Zugang zu außerschulischen und ganztags Angeboten richtet. Da ohne einen Zugang eine Ressource nutzlos ist. Sind Zugänge zu non-formalen und informellen Bildungsangeboten selektiv?
Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden zunächst Einflussfaktoren der sozialen Herkunft bezogen auf die kindliche Entwicklung und dem Bildungserfolg, durch eine Literaturrecherche beschrieben und mithilfe von Persönlichkeitstheorien erklärt. Anschließend wurde eine quantitative Umfrage an zwei Schulen mit unterschiedlichen sozialen Schichten durchgeführt und durch bestehende Forschungsergebnisse auf der StEG-Studie ergänzt.
Die Ergebnisse lassen die Frage nach der Ganztagsschule als Ressource offen, jedoch verdeutlichen sie den selektiven Zugang zu non-formalen und informellen Bildungsangeboten für untere soziale Schichten. Dies zeigt eine doppelte Bildungsbenachteiligung von Kindern aus sozial schwachen Familien. Auf dieser Grundlage ist es empfehlenswert, Hürden zu non-formalen und informellen Bildungsangeboten abzubauen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition der zentralen Begriffe
- 2.1. Soziale Schichten
- 2.2. Formale, Non-formale und Informelle Bildung
- 2.3. Die Ganztagsschule
- 3. Theoretische Fundierung
- 3.1. Familien in Multiproblemlagen
- 3.1.1. Definition des Begriffs Multiproblemfamilie
- 3.1.2. Merkmale von Multiproblemfamilie
- 3.1.3. Risikofaktoren von Multiproblemfamilie
- 3.1.4. Einfluss sozialer Ungleichheit auf die Entwicklung der Kinder
- 3.2. Abhängigkeit der sozialen Herkunft vom Bildungssystem
- 3.3. Persönlichkeitsentwicklung
- 3.3.1. Maslow Bedürfnispyramide
- 3.3.2. Ressourcentheorie
- 3.4. Zwischenfazit
- 4. Methodik/ Forschungsdesign
- 5. Präsentation und Analyse der Forschungsergebnisse
- 5.1. Ergebnisse zur sozialen Schicht
- 5.2. Ergebnisse zur Aktivität in Verbindung mit der sozialen Schicht
- 5.3. Mögliche Hürden der Inanspruchnahme von Angeboten
- 6. Diskussion
- 7. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Forschungsarbeit zielt darauf ab, die Rolle der Ganztagsschule als Ressource für Familien mit Mehrfachbelastungen zu untersuchen. Im Zentrum der Betrachtung steht dabei der Zugang zu außerschulischen und ganztägigen Angeboten, da ohne diesen eine Ressource nutzlos ist. Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, ob der Zugang zu non-formalen und informellen Bildungsangeboten selektiv ist und wie sich die soziale Herkunft auf die Teilnahme an solchen Angeboten auswirkt.
- Einflussfaktoren der sozialen Herkunft auf die kindliche Entwicklung und den Bildungserfolg
- Selektivität des Zugangs zu non-formalen und informellen Bildungsangeboten
- Die Ganztagsschule als Ressource für Multiproblemfamilien
- Doppelte Bildungsbenachteiligung von Kindern aus sozial schwachen Familien
- Abbau von Hürden zu non-formalen und informellen Bildungsangeboten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Einleitung in die Thematik und Vorstellung der Forschungsfrage.
- Kapitel 2: Definition der zentralen Begriffe
Definition wichtiger Begriffe wie soziale Schichten, formale, non-formale und informelle Bildung sowie die Ganztagsschule.
- Kapitel 3: Theoretische Fundierung
Behandlung relevanter Theorien zu Familien in Multiproblemlagen, sozialer Ungleichheit und Persönlichkeitsentwicklung. Darstellung von Modellen wie der Maslow Bedürfnispyramide und der Ressourcentheorie.
- Kapitel 4: Methodik/ Forschungsdesign
Beschreibung der Forschungsmethodik und des Forschungsdesigns der Studie.
- Kapitel 5: Präsentation und Analyse der Forschungsergebnisse
Präsentation und Analyse der Ergebnisse der quantitativen Umfrage an zwei Schulen mit unterschiedlichen sozialen Schichten. Betrachtung der Ergebnisse zur sozialen Schicht, der Aktivität in Verbindung mit der sozialen Schicht und möglichen Hürden der Inanspruchnahme von Angeboten.
- Kapitel 6: Diskussion
Diskussion der Ergebnisse und deren Bedeutung im Kontext der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Bildungsbenachteiligung, Selektion von sozialen Schichten, non-formale und informelle Bildungsangebote, Ganztagsschule, Persönlichkeitsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Ganztagsschule eine Ressource für Multiproblemfamilien?
Die Forschung untersucht, ob sie als Unterstützung dienen kann, stellt jedoch fest, dass der Zugang zu den Angeboten oft selektiv ist.
Was bedeutet „doppelte Bildungsbenachteiligung“?
Es beschreibt, dass Kinder aus sozial schwachen Familien sowohl im formalen Schulsystem als auch beim Zugang zu außerschulischen Bildungsangeboten benachteiligt sind.
Was ist der Unterschied zwischen formaler und non-formaler Bildung?
Formale Bildung findet in staatlichen Institutionen (Schule) statt, während non-formale Bildung freiwillige, organisierte Angebote außerhalb des Lehrplans umfasst.
Welche Rolle spielt die soziale Herkunft beim Bildungserfolg?
Die soziale Herkunft beeinflusst massiv die kindliche Entwicklung und die Wahrscheinlichkeit, an förderlichen Freizeitangeboten teilzunehmen.
Wie kann der Zugang zu Bildungsangeboten gerechter gestaltet werden?
Empfohlen wird der Abbau von Hürden (finanziell, organisatorisch) zu non-formalen und informellen Angeboten, um eine breitere Teilhabe zu ermöglichen.
- Quote paper
- Tobias Zimmermann (Author), 2021, Ganztagsschule als Ressource und Sozialisationsstation durch eine aktive Persönlichkeitsentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159902