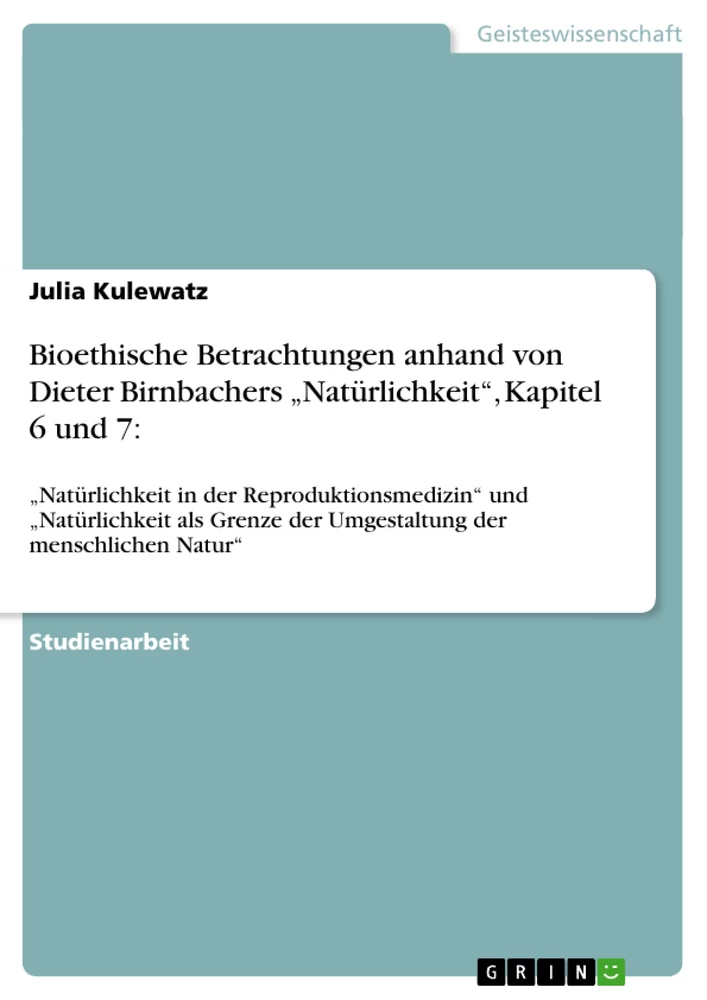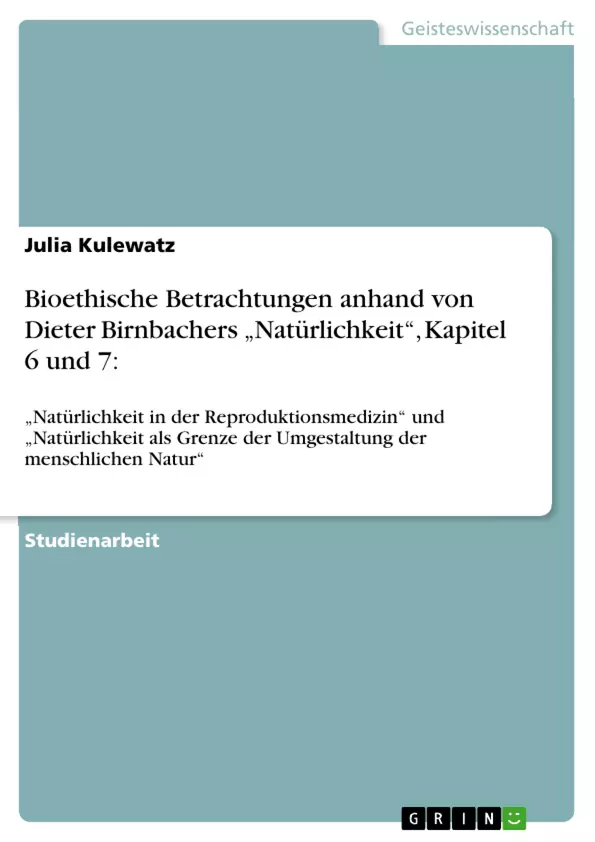Heute sind dem Menschen neue Gestaltungsräume auch innerhalb seiner eigenen Gattung möglich. Humangenetik und Reproduktionsmedizin eröffnen ihm diese. Die Grenze verschiebt sich merklich, doch welche Grenzbereiche sind betroffen? Ist es noch möglich, tatsächlich zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit zu unterscheiden, welche Methoden sind moralisch verwerflich und warum? Ab wann greift die Künstlichkeit in die Fortpflanzung des Menschen ein? Ist es moralisch richtig, allein der Natur die Entscheidung über Leben und Sterben zu überlassen? Fragen die der Philosoph Dieter Birnbacher in den Kapiteln 6 und 7 seiner „Natürlichkeit“ klären will.
Inhaltsverzeichnis
- Einführend
- Abstufungen der Künstlichkeit
- Bioethische Kritik
- „Natürlichkeitsargumente in der Reproduktionsmedizin“
- „Natürlichkeitspräferenzen versus Natürlichkeitsprinzipien“
- Bevorzugung des Natürlichen?
- Die Geschlechtswahl: biopolitische Aspekte
- Reproduktives Klonen im Rahmen der Natürlichkeitsprinzipien
- Von den Grenzen der Gattungswürde
- Gattungsethische Aspekte
- Die menschliche Natur
- Menschenbilder
- Über den Posthumanismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit den ethischen Implikationen von Fortschritten in der Humangenetik und Reproduktionsmedizin. Er analysiert, wie diese Entwicklungen die Grenze zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit verschieben und welche moralischen Fragen sich daraus ergeben.
- Abstufungen der Künstlichkeit in der Reproduktionsmedizin
- Bioethische Kritik an der „Industriealisierung“ der Reproduktion
- Natürlichkeitsprinzipien und ihre Anwendung auf die Geschlechtswahl und das reproduktive Klonen
- Die Rolle der Gattungswürde im Kontext von Eingriffen in die menschliche Natur
- Philosophische Überlegungen zum Posthumanismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführend: Der Text stellt die Frage, wie die neuen Gestaltungsräume in der Humangenetik und Reproduktionsmedizin die Grenze zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit verschieben und welche moralischen Fragen sich daraus ergeben.
- Abstufungen der Künstlichkeit: Der Text analysiert verschiedene Grade der Künstlichkeit in der Reproduktionsmedizin, angefangen bei der Verhütung bis hin zur In-vitro-Fertilisation und dem Klonen. Er diskutiert die Kriterien des technischen Aufwands, der Nachahmung natürlicher Vorgänge und der Ausschaltung natürlicher Variabilität.
- Bioethische Kritik: Der Text beleuchtet die bioethische Kritik an der „Industriealisierung“ der Reproduktion und der möglichen Ablösung der menschlichen Sexualität durch künstliche Methoden. Er diskutiert auch die Kritik an der „Eigenmächtigkeit“ des Menschen im Hinblick auf die Schöpfung.
- „Natürlichkeitsargumente in der Reproduktionsmedizin“: Der Text untersucht die Anwendung von Natürlichkeitsprinzipien auf die Reproduktionsmedizin, insbesondere im Hinblick auf die Geschlechtswahl und das reproduktive Klonen. Er fragt, ob und inwieweit die menschliche Natur durch diese Eingriffe verändert werden darf.
- „Natürlichkeitspräferenzen versus Natürlichkeitsprinzipien“: Der Text diskutiert die Frage, ob und inwieweit es eine moralische Verpflichtung gibt, das Natürliche zu bevorzugen. Er analysiert die Bedeutung von Natürlichkeitspräferenzen und Natürlichkeitsprinzipien im Kontext der Reproduktionsmedizin.
- Bevorzugung des Natürlichen?: Der Text befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit wir das Natürliche in der Reproduktionsmedizin bevorzugen sollten. Er diskutiert die Risiken und Vorteile von künstlichen Reproduktionsmethoden und die Rolle des Embryonenschutzgesetzes.
- Die Geschlechtswahl: biopolitische Aspekte: Der Text analysiert die biopolitischen Aspekte der Geschlechtswahl in der Reproduktionsmedizin. Er diskutiert die ethischen Implikationen dieser Möglichkeit und die Frage, ob und inwieweit die Gesellschaft in diese Entscheidungen eingreifen darf.
- Reproduktives Klonen im Rahmen der Natürlichkeitsprinzipien: Der Text untersucht die ethischen Fragen, die sich aus dem reproduktiven Klonen ergeben. Er diskutiert, ob und inwieweit diese Technik mit Natürlichkeitsprinzipien vereinbar ist.
- Von den Grenzen der Gattungswürde: Der Text befasst sich mit der Frage, welche Grenzen für Eingriffe in die menschliche Natur durch die Gattungswürde gesetzt werden sollten. Er diskutiert die ethischen Implikationen von Technologien, die das menschliche Wesen verändern könnten.
- Gattungsethische Aspekte: Der Text analysiert die ethischen Fragen, die sich aus der Veränderung der menschlichen Natur ergeben. Er diskutiert, ob und inwieweit wir für zukünftige Generationen verantwortlich sind und welche ethischen Prinzipien bei Eingriffen in die menschliche Keimbahn gelten sollten.
- Die menschliche Natur: Der Text befasst sich mit dem Konzept der menschlichen Natur und den verschiedenen Menschenbildern, die in der Geschichte existiert haben. Er diskutiert, wie sich unser Verständnis der menschlichen Natur durch die Fortschritte in der Biologie und Genetik verändert hat.
- Menschenbilder: Der Text präsentiert verschiedene Menschenbilder und diskutiert ihre Bedeutung für die ethische Bewertung von Eingriffen in die menschliche Natur. Er untersucht, wie sich unser Verständnis des Menschen durch die neuen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin verändert hat.
- Über den Posthumanismus: Der Text befasst sich mit dem Posthumanismus und seinen ethischen Implikationen. Er diskutiert, welche Herausforderungen sich aus der Möglichkeit ergeben, das menschliche Wesen zu verändern und wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen sollten.
Schlüsselwörter
Der Text behandelt zentrale Themen wie Natürlichkeit, Künstlichkeit, Reproduktionsmedizin, Humangenetik, Bioethik, Gattungswürde, Menschenbilder, Posthumanismus, Geschlechtswahl, reproduktives Klonen, Embryonenschutzgesetz, In-vitro-Fertilisation, Leihmutterschaft und die ethische Bewertung von Eingriffen in die menschliche Natur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Dieter Birnbachers Werk "Natürlichkeit"?
Birnbacher untersucht die moralische Bedeutung des Begriffs "Natürlichkeit", besonders im Kontext der Humangenetik und Reproduktionsmedizin.
Ist künstliche Befruchtung moralisch verwerflich?
Der Text diskutiert bioethische Kritiken an der "Industrialisierung" der Fortpflanzung und hinterfragt, ob die Abkehr von natürlichen Vorgängen die Menschenwürde berührt.
Was bedeutet "Gattungswürde" in der Bioethik?
Gattungswürde bezieht sich auf den Schutz der menschlichen Natur vor radikalen technischen Veränderungen, die das Wesen des Menschen verändern könnten.
Was ist Posthumanismus?
Eine philosophische Strömung, die die Überwindung biologischer Grenzen des Menschen durch Technologie (z. B. Gentechnik) thematisiert.
Warum ist die Geschlechtswahl ethisch umstritten?
Sie wirft biopolitische Fragen auf, inwieweit Eltern oder der Staat in die natürliche Variabilität der menschlichen Fortpflanzung eingreifen dürfen.
- Citar trabajo
- Julia Kulewatz (Autor), 2008, Bioethische Betrachtungen anhand von Dieter Birnbachers „Natürlichkeit“, Kapitel 6 und 7: , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116099