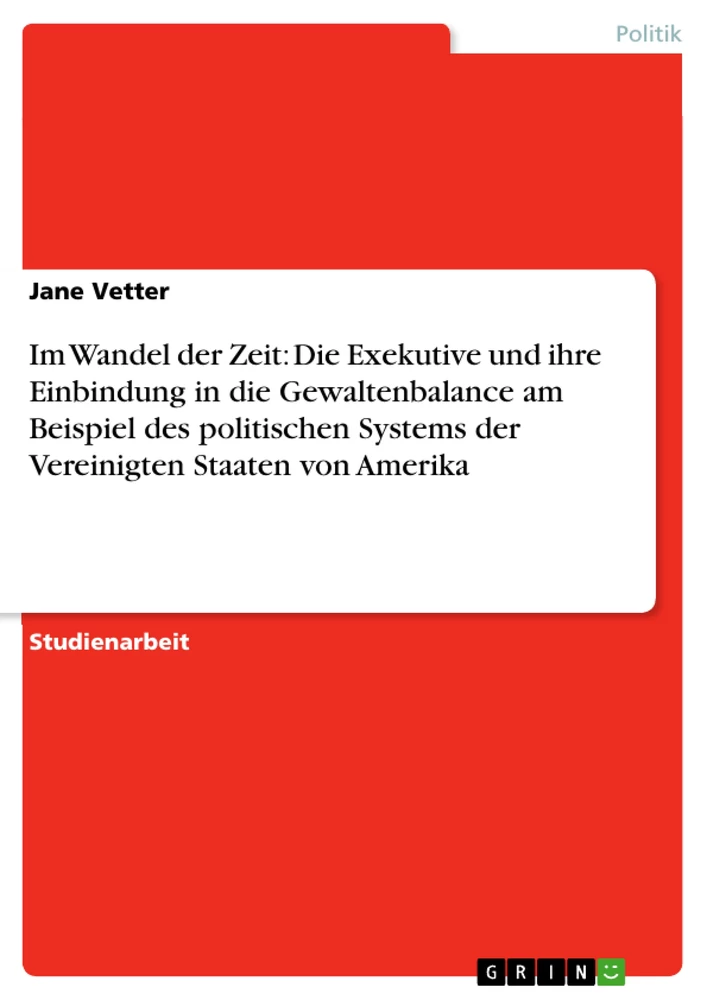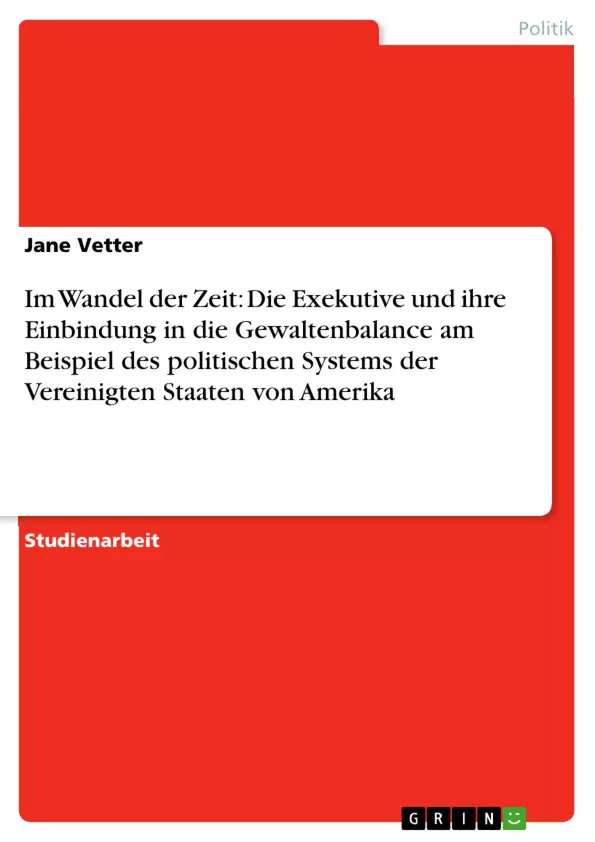Am 20. Januar 2004 hielt der amerikanische Präsident George W. Bush seine Rede zur Lage
der Nation vor dem Kongreß und betonte dabei die hohe Verantwortung, das amerikanische
Volk aktiv zu verteidigen. Er forderte unter anderem die Erneuerung des Patriot Act, ein
Gesetz, welches beispielsweise erlaubt, Ausländer auf eine unbestimmte Zeit zu inhaftieren,
sollten sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Der Patriot Act fand
zur Zeit seiner Annahme im Oktober des Jahres 2001, also kurz nach den terroristischen
Anschlägen auf das World Trade Center in New York City als auch auf das Pentagon in
Washington D.C., kaum Widerstand in den Reihen des Kongresses; die parlamentarische
Diskussion war gering.
Damit geht er konform mit seiner Aussage aus der Rede zur Lage der Nation aus dem Jahre
2003:
„Whatever action is required, whenever action is necessary, I will defend the freedom and
security of the American people.” Mit der Hervorhebung seiner Person im Kampf gegen den Terrorismus und der
widerstandslosen Durchsetzung von einem Gesetz, welches die persönlichen Freiheitsrechte
des einzelnen einschränkt, zeigt Bush, daß er nach den Terroranschlägen des 11. September
2001 einen „immensen Machtgewinn und Vertrauensvorschuß“ erhält. Die nationale
Sicherheit gewinnt an Dominanz und untermauert die Rolle des Präsidenten als Oberster
Befehlshaber nach außen und einem Schutzpatron nach innen.
Braml sagte dies mit den folgenden Worten: „Der Kongreß hat in einer solchen
Ausnahmesituation nicht das politische Gewicht, den Präsidenten im Kampf gegen den
Terrorismus herauszufordern, würde er doch damit den Garanten der nationalen Einheit und
Handlungsfähigkeit in Frage stellen.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik
- Die Lage der Nation
- Die wichtige Frage der Gewaltenbalance
- Bericht und Auswertung der angewandten Literatur
- Die Exekutive
- Wahl des Präsidenten
- Mitarbeiter
- Aufgaben
- Die Gewaltenbalance
- Definition
- Verhältnisse in den Anfängen der Vereinigten Staaten
- Gewaltenbalance in der Verfassung und den Federalist Papers
- Neue Herausforderungen
- Entwicklungen in der Innenpolitik und deren Wirkung auf die Gewaltenbalance
- Entwicklungen in der Außenpolitik und deren Wirkung auf die Gewaltenbalance
- Auswertung und Zukunftsaussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Gewaltenbalance im politischen System der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere die Rolle der Exekutive im Wandel der Zeit. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich veränderte Anforderungen, besonders im Kontext von Terrorismus und außenpolitischen Herausforderungen, auf die Gewaltenteilung und die Machtverteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative ausgewirkt haben.
- Die Rolle des Präsidenten im Kontext nationaler Sicherheit
- Die Entwicklung der Gewaltenbalance seit der Gründung der USA
- Der Einfluss von innen- und außenpolitischen Ereignissen auf die Machtverhältnisse
- Die Bedeutung der checks and balances im amerikanischen politischen System
- Die aktuelle Debatte um die Gewaltenteilung in den USA
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in die Thematik: Dieses einführende Kapitel analysiert die Rede zur Lage der Nation von Präsident George W. Bush im Jahr 2004 und beleuchtet den Kontext des Patriot Acts. Es wird die These aufgestellt, dass Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einen immensen Machtgewinn erfuhr und die nationale Sicherheit an Dominanz gewann. Der scheinbare Machtzuwachs der Exekutive wirft die Frage nach der Entwicklung der Gewaltenbalance im Laufe der Zeit auf und betont die Bedeutung einer ausgewogenen Machtverteilung in einem demokratischen System, insbesondere für eine Weltmacht wie die USA. Die einführende Literaturrecherche skizziert die verwendeten Quellen, die von grundlegenden Einführungen bis hin zu aktuellen Artikeln und Analysen zur politischen Entwicklung reichen.
Die Exekutive: Dieses Kapitel wird sich vermutlich mit der Struktur und den Funktionen der amerikanischen Exekutive befassen, einschließlich der Wahl des Präsidenten, seiner Mitarbeiter und seiner Aufgaben und Befugnisse. Es wird analysieren, wie diese Aspekte zur Machtfülle der Exekutive beitragen und inwiefern sie mit den Prinzipien der Gewaltenteilung zusammenhängen. Die Diskussion wird wahrscheinlich die institutionellen Mechanismen untersuchen, die die Exekutive ausüben kann und wie diese im Kontext der Gewaltenbalance funktionieren.
Die Gewaltenbalance: Dieser Abschnitt wird voraussichtlich eine Definition der Gewaltenbalance im amerikanischen Kontext liefern. Es ist zu erwarten, dass er die historische Entwicklung der Gewaltenteilung seit den Anfängen der Vereinigten Staaten beleuchtet und die Rolle der Verfassung und der Federalist Papers in der Etablierung dieses Systems beschreibt. Die Analyse wird sich vermutlich mit der ursprünglichen Intention von „checks and balances“ befassen und deren Umsetzung in der Praxis untersuchen.
Neue Herausforderungen: Dieses Kapitel wird vermutlich die Auswirkungen von innen- und außenpolitischen Entwicklungen auf die Gewaltenbalance analysieren. Es wird wahrscheinlich die Rolle von Ereignissen wie Terroranschlägen oder Kriegen auf die Machtverteilung untersuchen und analysieren, wie sich diese Entwicklungen auf die Exekutive und ihre Beziehungen zu den anderen Gewalten auswirken. Die Analyse wird sich wahrscheinlich auf die veränderte Bedeutung und den Umfang der Exekutivgewalt in Krisenzeiten konzentrieren.
Schlüsselwörter
Gewaltenbalance, Exekutive, Präsident, USA, checks and balances, nationale Sicherheit, Terrorismus, Verfassung, Federalist Papers, Innenpolitik, Außenpolitik, Machtverteilung, demokratisches System.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Gewaltenbalance in den USA
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der Gewaltenbalance im politischen System der Vereinigten Staaten von Amerika, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Exekutive im Wandel der Zeit. Sie untersucht, wie sich veränderte Anforderungen, insbesondere im Kontext von Terrorismus und außenpolitischen Herausforderungen, auf die Gewaltenteilung und die Machtverteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative ausgewirkt haben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Rolle des Präsidenten im Kontext nationaler Sicherheit, die Entwicklung der Gewaltenbalance seit der Gründung der USA, den Einfluss von innen- und außenpolitischen Ereignissen auf die Machtverhältnisse, die Bedeutung von „checks and balances“ im amerikanischen System und die aktuelle Debatte um die Gewaltenteilung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einführung in die Thematik (mit Analyse der Lage der Nation und des Patriot Acts), die Exekutive (Struktur, Funktionen und Machtbefugnisse), die Gewaltenbalance (Definition, historische Entwicklung und Rolle der Verfassung/Federalist Papers), und neue Herausforderungen (Auswirkungen von innen- und außenpolitischen Entwicklungen auf die Gewaltenbalance).
Wie wird die Rolle der Exekutive behandelt?
Die Arbeit untersucht die Struktur und Funktionen der amerikanischen Exekutive, einschließlich der Wahl des Präsidenten, seiner Mitarbeiter und seiner Aufgaben. Es wird analysiert, wie diese Aspekte zur Machtfülle der Exekutive beitragen und inwiefern sie mit den Prinzipien der Gewaltenteilung zusammenhängen. Der Fokus liegt insbesondere auf der Machtfülle der Exekutive nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
Welche Rolle spielen die Verfassung und die Federalist Papers?
Die Verfassung und die Federalist Papers werden im Kontext der historischen Entwicklung der Gewaltenteilung und der ursprünglichen Intention von „checks and balances“ analysiert. Die Arbeit untersucht, wie diese Konzepte in der Praxis umgesetzt wurden und sich im Laufe der Zeit entwickelt haben.
Wie werden innen- und außenpolitische Entwicklungen berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von innen- und außenpolitischen Entwicklungen, wie Terroranschlägen oder Kriegen, auf die Machtverteilung und die Beziehungen zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Der Schwerpunkt liegt auf der veränderten Bedeutung und dem Umfang der Exekutivgewalt in Krisenzeiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewaltenbalance, Exekutive, Präsident, USA, checks and balances, nationale Sicherheit, Terrorismus, Verfassung, Federalist Papers, Innenpolitik, Außenpolitik, Machtverteilung, demokratisches System.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine breite Palette an Quellen, von grundlegenden Einführungen bis hin zu aktuellen Artikeln und Analysen zur politischen Entwicklung. Die einführende Literaturrecherche skizziert die verwendeten Quellen im Detail.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Entwicklung der Gewaltenbalance in den USA und die Herausforderungen, die sich aus innen- und außenpolitischen Entwicklungen ergeben. Die Schlussfolgerungen werden in einem separaten Kapitel „Auswertung und Zukunftsaussichten“ dargestellt.
- Citar trabajo
- Jane Vetter (Autor), 2004, Im Wandel der Zeit: Die Exekutive und ihre Einbindung in die Gewaltenbalance am Beispiel des politischen Systems der Vereinigten Staaten von Amerika, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116460