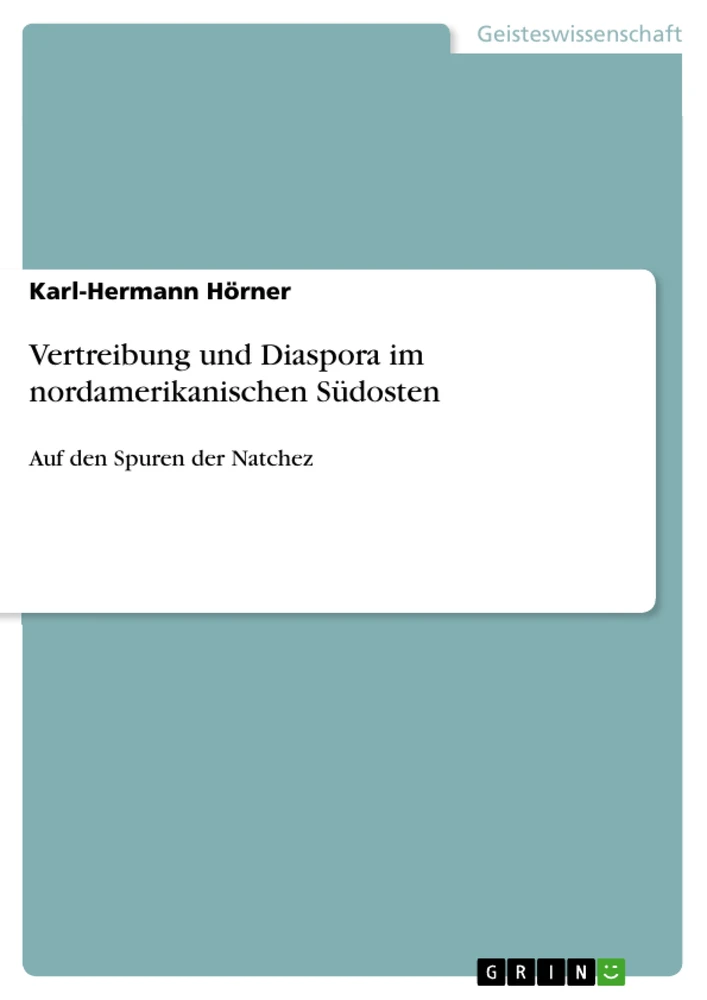Je länger und je häufiger man sich mit den Natchez, die ursprünglich am Unterlauf des Mississippi lebten, beschäftigt, umso deutlicher wird der Kontrast zwischen den in der Literatur immer wieder auftauchenden Hinweisen auf das Ende der Natchez, die Zerstörung und das Auseinanderfallen ihrer Gesellschaft einerseits und der Tatsache, dass sich auch heute immer noch oder wieder Menschen auf ihre Natchez-Herkunft berufen. Die "Vertreibung und Diaspora im nordamerikanischen Südosten" geht diesem Zwiespalt nach und versucht Wege aufzuzeichnen, auf denen Spuren der Natchez über die drei Jahrhunderte seit ihrem letzten Aufstand gegen die französische Kolonialmacht bis heute entdeckt werden können.
Zunächst suchten die meisten überlebenden Natchez im Nordosten des heutigen Staates Mississippi bei den Chickasaw Zuflucht. Mit Teilen der Chickasaw zogen sie weiter nach Osten zu den in den südlichen Appalachen und den angrenzenden Gebieten lebenden Cherokee. In dieser Region schien eine größere Sicherheit vor Übergriffen durch das französischen Militärs gegeben. Von hier aus kamen einige Familien der Natchez mit den im heutigen Alabama und Georgia siedelnden Creek in Kontakt. In den 30er Jahren erlitten die geflohenen Natchez das gleiche Schicksal wie die Creek und Cherokee, bei denen sie Aufnahme gefunden hatten. Gemeinsam mit diesen wurden sie von den euroamerikanischen Siedlern mit Unterstützung der nordamerikanischen Regierung nach Oklahoma westlich des Mississippis vertrieben.
Auf der als "Pfad der Tränen" ("Trail of Tears") beschriebenen Zwangsdeportation erlitten sie durch Krankheiten, Hunger und ungünstige Witterungsbedingungen unbeschreibliches Leid. Von den Cherokee und Creek ist bekannt, dass viele Vertriebene den Marsch nicht überlebten. Obwohl sich die Natchez mit der Zeit den kulturellen Ausdrucksformen ihrer gastgebenden Gruppen anpassten, gelang es ihnen dennoch, zahlreiche Traditionen ihrer Vorfahren zu bewahren. Selbst das heilige Feuer, das einstmals in ihrem Tempel am Mississippi brannte, konnten sie mitnehmen in ihre neue Heimat und dort pflegen. Heute arbeiten sie daran, ihre Sprache wiederzubeleben und neu zu lernen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Neues Zuhause in der Fremde
- Diaspora und Identität
- Ethnogenese
- Postkolonialismus
- „Domestic Dependent Nations“
- Produktionsverhältnisse, Bewusstsein und Diaspora
- Zusammenfassung
- Die Vertreibung der Creek und Cherokee
- Das Schicksal der Creek
- Die Diaspora der Cherokee
- Die Natchez: eine Diaspora-Gesellschaft?
- Die Diaspora der Natchez
- In voreuropäischer Zeit
- Der Weg in die Diaspora
- Stabilität der Traditionen
- Die Natchez heute
- Perspektiven
- Hinweise auf Websites
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Schicksal der Natchez-Nation nach ihrer Vertreibung aus ihrer angestammten Heimat am Unterlauf des Mississippi im 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Strategien der Natchez, ihre kulturelle Identität und Traditionen über mehrere Jahrhunderte hinweg zu bewahren, trotz der Diaspora und der kolonialen Vergangenheit. Die Arbeit hinterfragt gängige Narrative von Vernichtung und stellt die Kontinuität der Natchez-Identität in den Vordergrund.
- Die Diaspora der Natchez und ihre Auswirkungen auf die kulturelle Identität.
- Die Strategien der Natchez zur Bewahrung ihrer Traditionen.
- Der Vergleich der Natchez-Erfahrung mit anderen indigenen Völkern Nordamerikas (Creek, Cherokee).
- Die Rolle des Postkolonialismus im Selbstverständnis der Natchez.
- Der Status der Natchez als "Domestic Dependent Nations".
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und thematisiert den Widerspruch zwischen der oft beschriebenen Vernichtung der Natchez und der anhaltenden Selbstbestimmung einer Gruppe von Menschen, die sich bis heute als Natchez bezeichnen. Es kündigt die Absicht an, Wege zu einem besseren Verständnis des Schicksals der Natchez aufzuzeigen, insbesondere ihrer Fähigkeit, über Jahrhunderte hinweg ihre kulturellen Traditionen zu bewahren. Die Arbeit wird als ein erster Schritt zur Erforschung eines bisher wenig beachteten Themas vorgestellt, sowohl in den USA als auch in Europa.
Neues Zuhause in der Fremde: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen und Anpassungsstrategien der Natchez in der Diaspora. Es analysiert Aspekte der Identität, Ethnogenese und den Einfluss des Postkolonialismus auf die Entwicklung der Natchez-Gemeinschaft. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Natchez als "Domestic Dependent Nations" und der Analyse der Produktionsverhältnisse, des Bewusstseins und deren Interaktion mit der Diaspora-Erfahrung. Das Kapitel nutzt ein zusammenfassendes Schaubild, um die komplexen Zusammenhänge zu veranschaulichen. Es werden die Auswirkungen der Vertreibung auf die soziale Struktur und das kulturelle Leben der Natchez detailliert beleuchtet, inklusive der Anpassung an neue Lebensbedingungen und die Aufrechterhaltung von Traditionen.
Die Vertreibung der Creek und Cherokee: Dieses Kapitel setzt die Natchez-Geschichte in den Kontext der Erfahrungen anderer indigener Gruppen, der Creek und Cherokee. Es untersucht die Parallelen und Unterschiede in ihren Vertreibungsgeschichten und den daraus resultierenden Diaspora-Erfahrungen. Die Analysen umfassen die individuellen Schicksale der beiden Gruppen, aber auch den Vergleich der Strategien zur Bewältigung der Vertreibung und des Verlustes der Heimat. Der Abschnitt über die Natchez innerhalb dieses Kapitels stellt die Frage, inwieweit die Natchez als Diaspora-Gesellschaft betrachtet werden können, und vergleicht ihre Erfahrungen mit denen der Creek und Cherokee.
Die Diaspora der Natchez: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Geschichte der Natchez in der Diaspora, beginnend mit ihrer Situation in voreuropäischer Zeit. Es beschreibt den Prozess der Vertreibung und die anschließende Migration. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse der bemerkenswerten Stabilität der Natchez-Traditionen über die Jahrhunderte hinweg, trotz der Herausforderungen der Diaspora. Der letzte Teil des Kapitels befasst sich mit der Gegenwart der Natchez-Nation und ihren aktuellen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Natchez, Diaspora, Vertreibung, Identität, Ethnogenese, Postkolonialismus, „Domestic Dependent Nations“, kulturelle Traditionen, Mississippi, Nordamerika, indigene Völker, Migration, Kontinuität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Diaspora der Natchez
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Schicksal der Natchez-Nation nach ihrer Vertreibung aus ihrer angestammten Heimat im 18. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewahrung ihrer kulturellen Identität und Traditionen trotz der Diaspora und der kolonialen Vergangenheit. Sie widerlegt gängige Narrative von Vernichtung und betont die Kontinuität der Natchez-Identität.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Diaspora der Natchez und ihre Auswirkungen auf die kulturelle Identität, die Strategien zur Bewahrung ihrer Traditionen, einen Vergleich mit anderen indigenen Völkern (Creek, Cherokee), die Rolle des Postkolonialismus und den Status der Natchez als "Domestic Dependent Nations".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält Kapitel zu einem Vorwort, einem Überblick über "Neues Zuhause in der Fremde", die Vertreibung der Creek und Cherokee im Vergleich zur Natchez-Erfahrung, die detaillierte Diaspora der Natchez (inklusive voreuropäischer Zeit, Vertreibung und Gegenwart), Perspektiven, Hinweise auf Websites und eine Literaturliste.
Was wird im Kapitel "Neues Zuhause in der Fremde" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen und Anpassungsstrategien der Natchez in der Diaspora, Aspekte der Identität und Ethnogenese, den Einfluss des Postkolonialismus und das Verständnis der Natchez als "Domestic Dependent Nations". Es untersucht die Produktionsverhältnisse, das Bewusstsein und deren Interaktion mit der Diaspora-Erfahrung und beleuchtet die Auswirkungen der Vertreibung auf die soziale Struktur und das kulturelle Leben der Natchez.
Wie wird die Geschichte der Natchez mit der anderer indigener Völker verglichen?
Das Kapitel über die Vertreibung der Creek und Cherokee vergleicht die Parallelen und Unterschiede in ihren Vertreibungsgeschichten und Diaspora-Erfahrungen mit denen der Natchez. Es analysiert die Strategien zur Bewältigung der Vertreibung und des Verlustes der Heimat und untersucht, inwieweit die Natchez als Diaspora-Gesellschaft betrachtet werden können.
Was wird über die Gegenwart der Natchez berichtet?
Das Kapitel "Die Diaspora der Natchez" befasst sich mit der Gegenwart der Natchez-Nation und ihren aktuellen Herausforderungen. Es beschreibt die bemerkenswerte Stabilität der Natchez-Traditionen trotz der Herausforderungen der Diaspora über die Jahrhunderte hinweg.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Natchez, Diaspora, Vertreibung, Identität, Ethnogenese, Postkolonialismus, „Domestic Dependent Nations“, kulturelle Traditionen, Mississippi, Nordamerika, indigene Völker, Migration, Kontinuität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Schicksal der Natchez-Nation nach ihrer Vertreibung zu untersuchen und ein besseres Verständnis ihrer Fähigkeit zur Bewahrung kultureller Traditionen über Jahrhunderte hinweg zu ermöglichen. Sie präsentiert sich als erster Schritt zur Erforschung eines bisher wenig beachteten Themas.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten relevant, die sich mit der Geschichte der indigenen Völker Nordamerikas, Diaspora-Studien, Postkolonialismus und kultureller Identität auseinandersetzen.
- Quote paper
- Karl-Hermann Hörner (Author), 2023, Vertreibung und Diaspora im nordamerikanischen Südosten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1165804