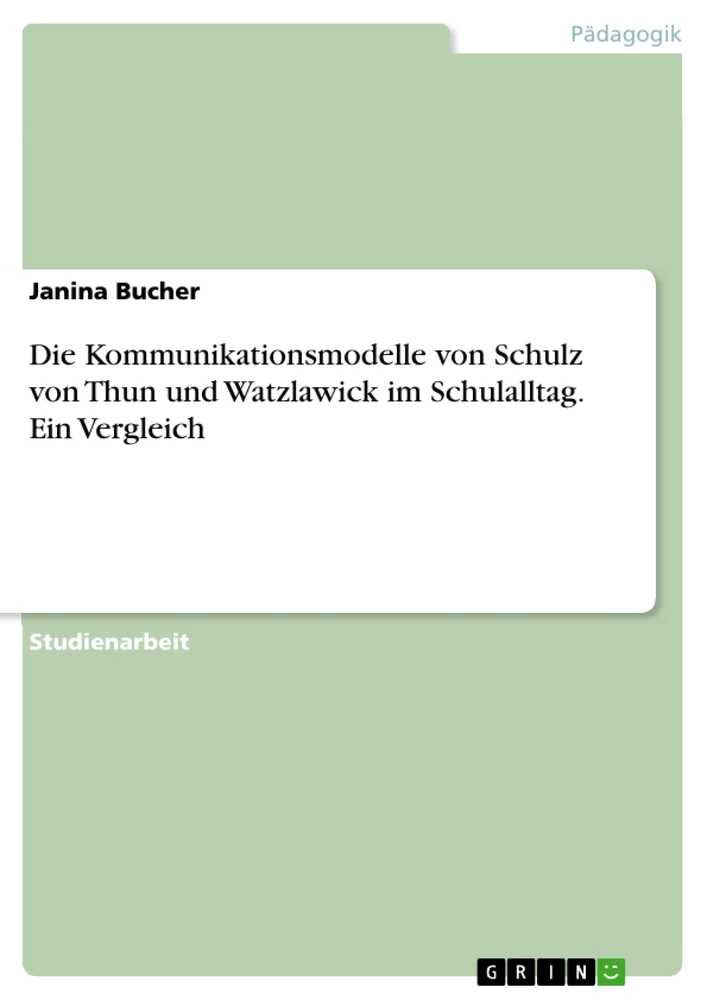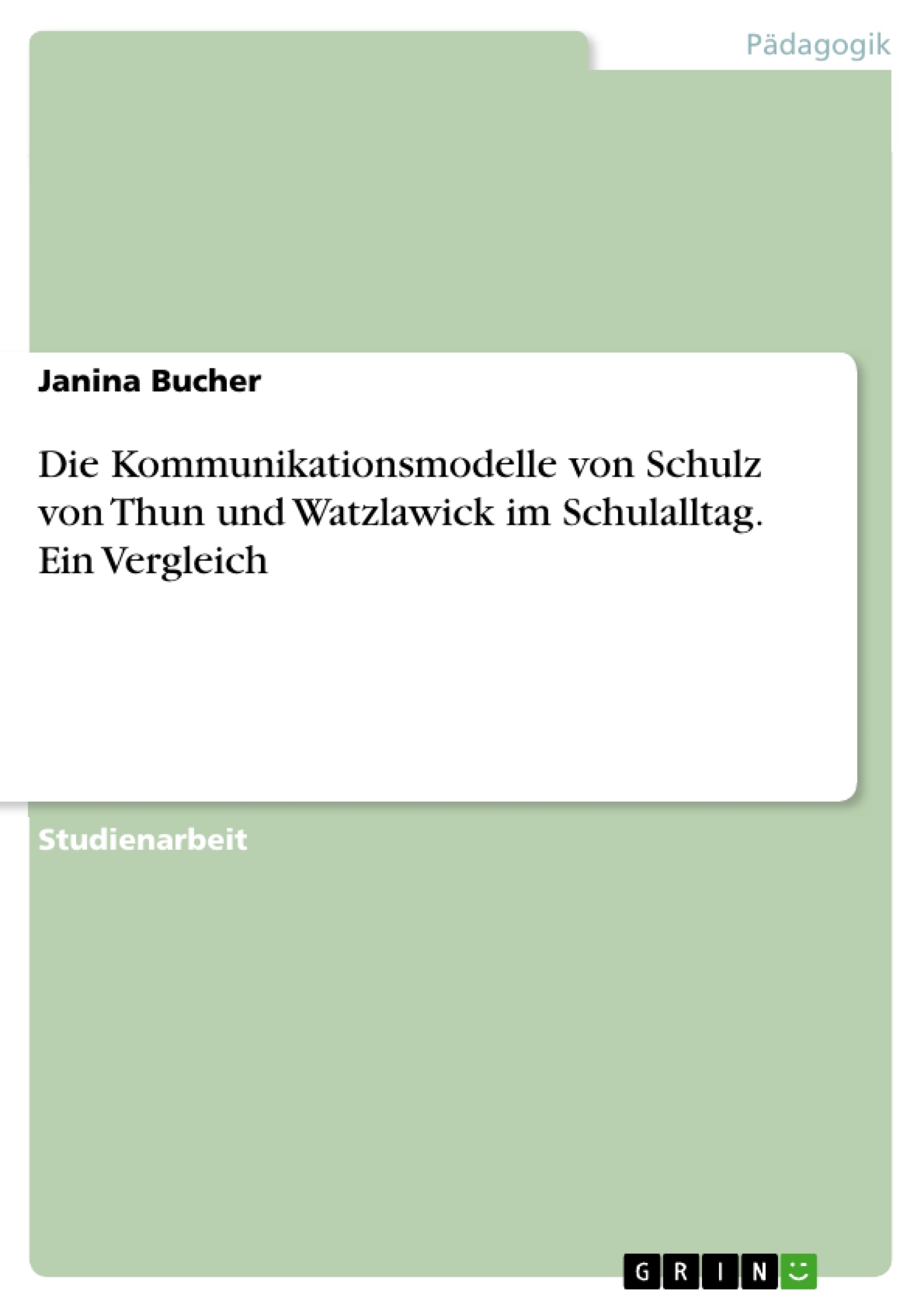Diese Arbeit vergleicht die beiden Kommunikationsmodelle von Friedemann Schulz von Thun und Paul Watzlawick im Schulalltag.
Kommunikation begegnet uns im Alltag ständig. Wir kommunizieren mit Kollegen, Freunden oder Familie und halten dabei ganz unbewusst bestimmte Regeln und Techniken ein.
Doch was ist Kommunikation eigentlich genauer betrachtet? Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Anwesenheit von zwei oder mehreren Personen. Die Informationen werden über Mitteilungen weitergegeben, die verbal und/oder nonverbal stattfinden können. Darauf gehen auch die beiden Kommunikationsmodelle von Schulz von Thun und Watzlawick genauer ein. Unter Informationsaustausch wird nicht nur der Austausch von Wissen, sondern auch die Übermittlung von Erkenntnissen, Erfahrungen, Vorstellungen, Gefühlen oder Meinungen verstanden.
Damit Kommunikation stattfinden kann, müssen noch andere Voraussetzungen gegeben sein, wie beispielsweise das Vorhandensein eines gemeinsamen Zeichenvorrats. Die Kommunikationspartner sollten sich der gleichen Sprache bedienen können. Wenn dies nicht der Fall ist, reichen teilweise auch nichtsprachliche Zeichen, wie zum Beispiel Mimik und Gestik. Außerdem sollten die Kommunikationspartner die Bedeutung der Worte und Wortfolgen teilen.
Diese Voraussetzungen reichen noch nicht aus, damit Kommunikation störfrei ablaufen kann. Schulz von Thun und Watzlawick beschreiben noch weitere Aspekte, die zum gelungenen Austausch von Informationen beitragen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kommunikation
- Das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun
- Das Kommunikationsquadrat
- Der Sender
- Der Empfänger
- Fazit
- Das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick
- Erstes Axiom
- Zweites Axiom
- Drittes Axiom
- Viertes Axiom
- Fünftes Axiom
- Fazit
- Vergleich der Kommunikationsmodelle von Schulz von Thun und Watzlawick
- Subjektive Wirklichkeit
- Nonverbale Sprache
- Aspekte einer Nachricht
- Metakommunikation
- Störungen
- Schulz von Thun im Zusammenhang mit Watzlawick
- Bezug zum Seminar „Didaktisch-methodische Grundlagen inklusiver Unterrichtsformate - Schwerpunkt Sprache“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Kommunikationsmodelle von Friedemann Schulz von Thun und Paul Watzlawick zu vergleichen. Sie analysiert die Kernaussagen beider Modelle und untersucht ihre Relevanz für den pädagogischen Kontext, insbesondere im Bereich der Kommunikation zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern.
- Die vier Seiten des Kommunikationsquadrats nach Schulz von Thun
- Die fünf Axiome der Kommunikation nach Watzlawick
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Modelle
- Anwendung der Modelle im Schulalltag
- Bedeutung der Kommunikation für inklusive Unterrichtsformate
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema Kommunikation und die Relevanz von Kommunikationsmodellen im pädagogischen Kontext ein. Sie stellt den Fokus der Arbeit auf den Vergleich der Modelle von Schulz von Thun und Watzlawick dar.
- Kommunikation: Dieses Kapitel definiert den Begriff Kommunikation und stellt die Grundprinzipien des Informationsaustausches dar. Es legt die Grundlage für die detaillierte Analyse der beiden Kommunikationsmodelle.
- Das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun: Dieses Kapitel stellt das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun vor und erklärt die vier Aspekte einer Nachricht: Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellaspekt. Es beleuchtet auch die Rolle des Senders und Empfängers im Kommunikationsprozess.
- Das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick: Dieses Kapitel erläutert die fünf Axiome der Kommunikation nach Watzlawick. Es beschreibt, wie diese Axiome die menschliche Kommunikation prägen und zu Missverständnissen führen können.
- Vergleich der Kommunikationsmodelle von Schulz von Thun und Watzlawick: Dieses Kapitel analysiert die beiden Modelle anhand verschiedener Aspekte wie der subjektiven Wirklichkeit, der nonverbalen Sprache, der Aspekte einer Nachricht und der Metakommunikation. Es zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Modellen auf.
- Bezug zum Seminar „Didaktisch-methodische Grundlagen inklusiver Unterrichtsformate - Schwerpunkt Sprache“: Dieses Kapitel verdeutlicht die Relevanz der beiden Kommunikationsmodelle für den inklusiven Unterricht und zeigt auf, wie die Modelle dazu beitragen können, effektive und wertschätzende Kommunikation im Schulalltag zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Kommunikationsmodellen von Schulz von Thun und Watzlawick, wobei die Schwerpunkte auf der Analyse der vier Seiten des Kommunikationsquadrats, den fünf Axiomen der Kommunikation, dem Vergleich der beiden Modelle und der Anwendung im pädagogischen Kontext, insbesondere im Bereich der inklusiven Unterrichtsformate, liegen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun?
Das Kommunikationsquadrat umfasst den Sachaspekt (Worüber ich informiere), die Selbstoffenbarung (Was ich von mir kundgebe), die Beziehung (Was ich von dir halte) und den Appell (Wozu ich dich veranlassen möchte).
Welche Axiome der Kommunikation stellte Paul Watzlawick auf?
Watzlawick formulierte fünf Axiome, darunter das bekannte: „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Weitere Axiome betreffen Inhalts- und Beziehungsaspekte sowie Symmetrie und Komplementarität.
Warum ist Metakommunikation im Schulalltag wichtig?
Metakommunikation – das Sprechen über die Art und Weise der Kommunikation – hilft Lehrkräften und Schülern, Störungen und Missverständnisse im Unterricht bewusst zu klären.
Wie unterscheiden sich die Modelle von Schulz von Thun und Watzlawick?
Während Schulz von Thun die Vielschichtigkeit einer einzelnen Nachricht betont, fokussiert Watzlawick stärker auf die systemischen Regeln und die Wechselwirkung zwischen den Partnern.
Welche Rolle spielt die nonverbale Sprache in diesen Modellen?
Beide Modelle betonen, dass Mimik, Gestik und Tonfall entscheidend dazu beitragen, wie eine Nachricht beim Empfänger ankommt, oft unabhängig vom gesprochenen Wort.
Was bedeutet "subjektive Wirklichkeit" in der Kommunikation?
Sie beschreibt die Tatsache, dass Sender und Empfänger Nachrichten aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und Gefühle unterschiedlich interpretieren können, was oft zu Störungen führt.
- Arbeit zitieren
- Janina Bucher (Autor:in), 2015, Die Kommunikationsmodelle von Schulz von Thun und Watzlawick im Schulalltag. Ein Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167144