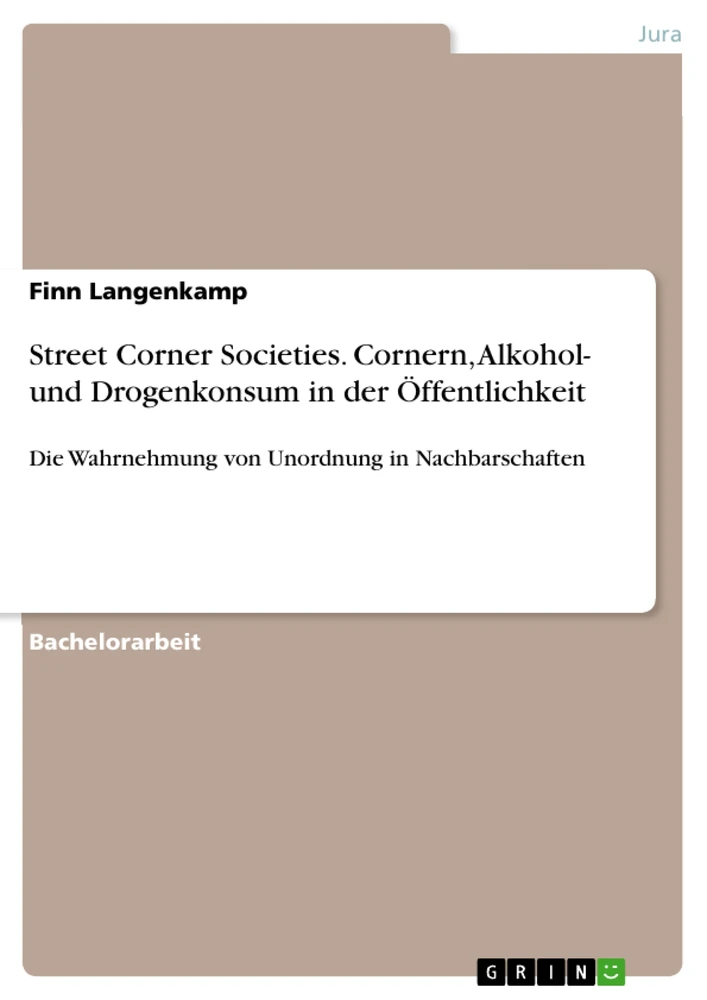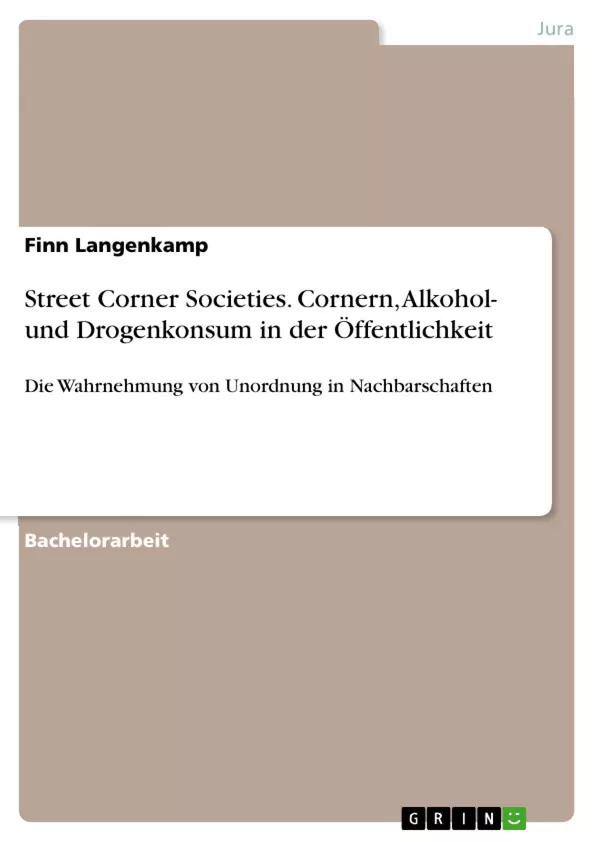Die Arbeit im Schwerpunkt Kriminologie thematisiert die kriminologischen Theorien der Street Corner Society und Broken Windows Theorie.
Cornern ist ein Neologismus in der deutschen Sprache. Er bezeichnet ein Treffen von Gruppen von zumeist jungen Menschen unter freiem Himmel, bei dem Alkohol konsumiert wird. Der Begriff kommt aus den USA. In der Bronx der 80er-Jahren wurden damit Breakdance Wettkämpfe an Straßenecken bezeichnet. Heute finden zwar keine Breakdance Wettkämpfe mehr statt, aber das cornern wird gegenwärtig zunehmend populärer in Deutschland. Immer mehr Menschen sehen es als Alternative zu einer Kneipe oder trinken unter freiem Himmel schon mal bevor sie weiterziehen.
Aus kriminologischer Perspektive ist Alkohol- und Drogenkonsum ein Gefährdungsfaktor für delinquentes Verhalten. So kommt es auch nicht zu selten beim cornern, wie überall, wo viele Menschen aufeinandertreffen und Alkohol konsumieren zu Streit und Schlägereien. Mittlerweile wächst die Kritik am cornern. Es vermüllt die Innenstädte, den Gastronomen fehlen deshalb zunehmend die Kunden und es vermittelt ein Gefühl von Unsicherheit an andere Bürger. Auch die Polizei fängt an, sich für dieses Phänomen zu interessieren. In diesem Zusammenhang soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, ob es womöglich sinnvoll wäre, Street Corner Societies konsequent polizeilich zu verfolgen und aufzulösen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- Street Corner Societies
- Die Studie von Whyte
- Cornerville
- „Corner boys“ und „College boys“
- Soziale Mobilität
- Street Corner Societies in der Forschung der Gegenwart
- Die Studien im Vergleich
- B. Broken Windows Theorie
- Zimbardos Experiment
- Wie durch Unordnung und Vernachlässigung eine idyllische Nachbarschaft zum kriminellen Brennpunkt werden kann
- Die Furcht vor jungen Menschen und Unordnung
- Die Rolle der Polizei nach Kelling und Wilson
- Praktische Auswirkungen der Broken Windows Theory
- Kritik an der Broken Windows Theory und ihren praktischen Auswirkungen
- C. Die Broken Windows Theorie und die Street Corner Societies
- D. Fazit zur Broken Windows Theorie und ihrer Anwendung gegenüber Street Corner Societies
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Street Corner Societies, Alkohol- und Drogenkonsum in der Öffentlichkeit und der Wahrnehmung von Unordnung in Nachbarschaften. Sie analysiert die "Broken Windows Theorie" und deren Anwendung auf die von William Foote Whyte beschriebenen Street Corner Societies. Das Ziel ist es, die Theorie kritisch zu beleuchten und deren praktische Auswirkungen zu bewerten.
- Street Corner Societies und deren soziale Dynamiken
- Die Broken Windows Theorie und ihre Kernargumente
- Der Zusammenhang zwischen Unordnung, Kriminalität und der Wahrnehmung von Sicherheit
- Kritische Auseinandersetzung mit der Broken Windows Theorie
- Praktische Implikationen der Theorie für die Polizeiarbeit und Stadtplanung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Street Corner Societies, öffentlichem Konsum von Alkohol und Drogen, und der Wahrnehmung von Unordnung dar. Es skizziert die "Street Corner Societies"-Studie von William Foote Whyte und deren Bedeutung für das Verständnis sozialer Strukturen in Nachbarschaften. Weiterhin wird die "Broken Windows Theorie" als relevantes theoretisches Konzept vorgestellt, welches im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert wird. Die Einleitung bereitet den Boden für eine kritische Auseinandersetzung mit beiden Konzepten und deren Wechselwirkung.
B. Broken Windows Theorie: Dieses Kapitel behandelt ausführlich die "Broken Windows Theorie". Es beschreibt das berühmte Stanford-Prison-Experiment von Philip Zimbardo als ein illustratives Beispiel für den Einfluss von Unordnung auf das Verhalten von Menschen. Es erläutert, wie kleine Verstöße gegen soziale Normen, wie z.B. Graffiti oder Müllansammlungen, zu einer Spirale der Kriminalität und Verwahrlosung führen können. Darüber hinaus werden die Rolle der Polizei im Kontext der Theorie nach Kelling und Wilson, die praktischen Auswirkungen und die Kritikpunkte an der Theorie umfassend dargestellt. Das Kapitel liefert eine detaillierte Analyse der Theorie, ihre Stärken und Schwächen sowie ihre Implikationen für die Praxis.
C. Die Broken Windows Theorie und die Street Corner Societies: Dieses Kapitel untersucht die Anwendung der "Broken Windows Theorie" auf die von Whyte beschriebenen Street Corner Societies. Es analysiert, inwieweit die in Cornerville beobachteten sozialen Dynamiken und Verhaltensweisen mit den Annahmen der "Broken Windows Theorie" übereinstimmen oder divergieren. Es wird ein Vergleich der beiden Konzepte vorgenommen und mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt. Dieser Abschnitt bietet eine kritische Auseinandersetzung der Anwendbarkeit der Theorie auf die komplexe soziale Realität von Street Corner Societies.
Schlüsselwörter
Street Corner Societies, Broken Windows Theorie, Unordnung, Kriminalität, Alkohol- und Drogenkonsum, öffentliche Räume, Nachbarschaften, soziale Kontrolle, Polizeiarbeit, Stadtplanung, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen zu: Street Corner Societies und die Broken Windows Theorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Street Corner Societies, öffentlichem Alkohol- und Drogenkonsum und der Wahrnehmung von Unordnung in Nachbarschaften. Im Mittelpunkt steht eine kritische Analyse der "Broken Windows Theorie" und ihrer Anwendbarkeit auf die von William Foote Whyte beschriebenen Street Corner Societies.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sozialen Dynamiken von Street Corner Societies, die Kernargumente der Broken Windows Theorie, den Zusammenhang zwischen Unordnung, Kriminalität und Sicherheitsempfinden, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der Broken Windows Theorie und ihren praktischen Implikationen für Polizei und Stadtplanung. Das berühmte Stanford-Prison-Experiment von Zimbardo wird als Beispiel für den Einfluss von Unordnung herangezogen.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit analysiert die "Street Corner Societies"-Studie von Whyte und vergleicht sie mit der Broken Windows Theorie. Es wird ein Vergleich der beiden Konzepte vorgenommen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die Anwendbarkeit der Broken Windows Theorie auf die komplexe soziale Realität von Street Corner Societies kritisch zu bewerten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung (mit Vorstellung der Studie von Whyte und der Broken Windows Theorie), eine ausführliche Darstellung der Broken Windows Theorie inklusive Kritik, ein Kapitel zum Vergleich der Broken Windows Theorie mit Street Corner Societies und abschließend ein Fazit zur Anwendbarkeit der Theorie auf Street Corner Societies.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Street Corner Societies, Broken Windows Theorie, Unordnung, Kriminalität, Alkohol- und Drogenkonsum, öffentliche Räume, Nachbarschaften, soziale Kontrolle, Polizeiarbeit, Stadtplanung und soziale Ungleichheit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen den genannten Themen zu untersuchen und die Broken Windows Theorie kritisch zu beleuchten, um deren praktische Auswirkungen und Anwendbarkeit auf Street Corner Societies zu bewerten.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert unter anderem auf der Studie "Street Corner Societies" von William Foote Whyte und bezieht sich auf die Broken Windows Theorie von Kelling und Wilson. Das Stanford-Prison-Experiment von Zimbardo dient als illustratives Beispiel.
- Citation du texte
- Finn Langenkamp (Auteur), 2021, Street Corner Societies. Cornern, Alkohol- und Drogenkonsum in der Öffentlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1172479