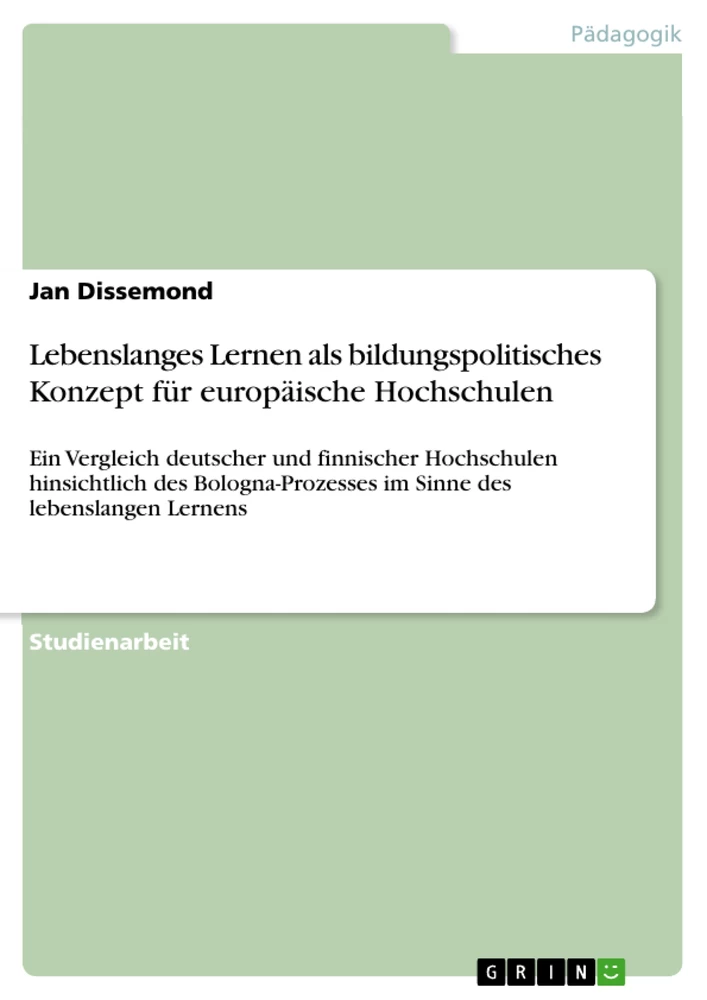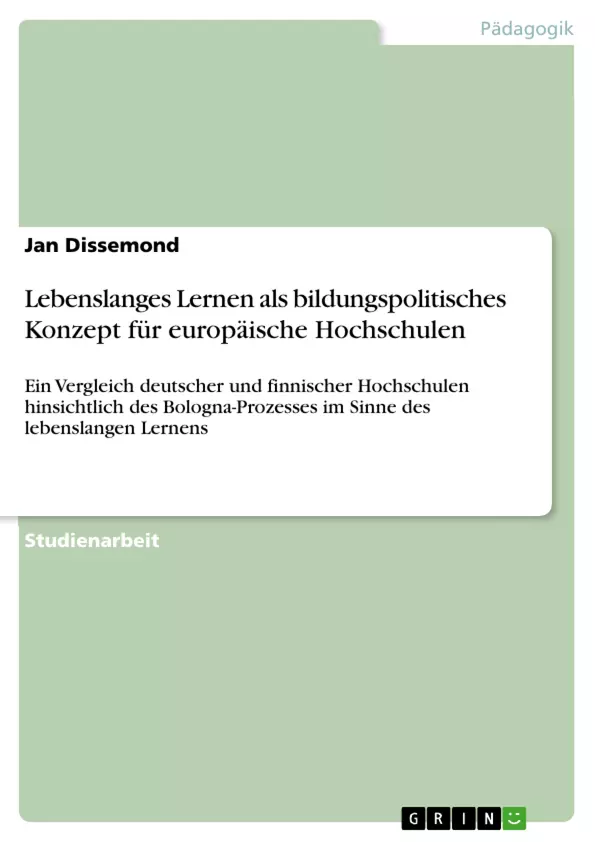Die wachsende Heterogenität der Lernenden stellt das Bildungsangebot unlängst vor Herausforderungen und impliziert gleichzeitig die Notwendigkeit, Bildungszugänge aus verschiedenen Richtungen zu ermöglichen. Für die Durchlässigkeit des Bildungswesens ist daher der Zugang zur Hochschulbildung für Personen ohne eine klassische Hochschulzugangsberechtigung zu einem entscheidenden Thema der europäischen Hochschulpolitik geworden. Eine Möglichkeit, unterrepräsentierten Gruppen den Zugang zu erleichtern, sieht der Bologna-Prozess im Konzept des lebenslangen Lernens.
Während in Deutschland berufliche und hochschulische Bildung weitestgehend voneinander getrennte Bereiche darstellen, sind die Grenzen in vielen anderen europäischen Ländern fließender. Teilweise ist die Idee des lebenslangen Lernens bereits gelebte Hochschulkultur. Bei der Implementierung von lebenslangem Lernen im europäischen Hochschulraum schneiden vor allem skandinavische Länder besonders gut ab. Finnland hat sich beispielsweise umfangreich auf die Anforderungen des lebenslangen Lernens im Sinne des Bologna-Prozesses ausgerichtet. Das finnische Hochschulwesen zeichnet sich dadurch aus bildungsferne Schichten besonders gut zu integrieren. Finnland kann also eine deutlich höhere Durchlässigkeit der Hochschulen gegenüber der heterogenen Studierendenschaft vorweisen. Das deutsche Hochschulwesen scheint sich diesbezüglich noch schwer zu tun.
Die Divergenz der beiden angeführten Hochschulwesen, trotz des gemeinsamen europäischen Hochschulraumes und dem im Bologna-Prozess gesetzten Ziel zur Implementierung des lebenslangen Lernens, macht den Vergleich dieser beiden Hochschulwesen zu einem relevanten Thema. Aus dem Vergleich soll hervorgehen, warum sich das deutsche Hochschulwesen, im Vergleich zum finnischen Hochschulwesen, bei der Umsetzung des lebenslangen Lernens im Sinne des Bologna-Prozesses so schwertut. Mithilfe der dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollen Rückschlüsse darauf gezogen werden, was deutsche Hochschulen von finnischen Hochschulen lernen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. LEBENSLANGES LERNEN: EINE EINFÜHRUNG
- 3. LEBENSLANGES LERNEN IM KONTEXT DES BOLOGNA-PROZESSES
- 4. LEBENSLANGES LERNEN AN DEUTSCHEN HOCHSCHULEN
- 5. LEBENSLANGES LERNEN AN FINNISCHEN HOCHSCHULEN
- 6. PERSPEKTIVEN
- 7. RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept des lebenslangen Lernens im Kontext des Bologna-Prozesses und analysiert, wie dieses Konzept an deutschen und finnischen Hochschulen umgesetzt wird. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Implementierung des lebenslangen Lernens für die beiden Hochschulsysteme ergeben. Darüber hinaus werden mögliche Übertragungsaspekte vom finnischen Hochschulsystem auf das deutsche System diskutiert, um die Umsetzung des Bologna-Prozesses im Sinne des lebenslangen Lernens in Deutschland zu fördern.
- Der Bologna-Prozess und seine Ziele für die Implementierung des lebenslangen Lernens
- Die Rolle des lebenslangen Lernens in der Wissensgesellschaft und im Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen
- Der Vergleich der Umsetzungsstrategien des lebenslangen Lernens an deutschen und finnischen Hochschulen
- Die Herausforderungen und Chancen der Implementierung des lebenslangen Lernens in beiden Hochschulsystemen
- Mögliche Übertragungsaspekte vom finnischen Hochschulsystem auf das deutsche System
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die wachsende Heterogenität der Lernenden und die Notwendigkeit, Bildungszugänge für alle zu ermöglichen. Sie stellt den Bologna-Prozess und das Konzept des lebenslangen Lernens im Kontext der europäischen Hochschulpolitik vor und hebt die Bedeutung des lebenslangen Lernens für die Anpassung an die heterogenere Studierendenschaft hervor.
- Kapitel 2: Lebenslanges Lernen: Eine Einführung
Kapitel 2 bietet eine Definition des lebenslangen Lernens und erläutert die Hintergründe und die Notwendigkeit dieses Konzepts im Kontext von Wissensgesellschaften, demografischem Wandel und Globalisierung. Es betont, dass das lebenslange Lernen nicht nur organisiertes Lernen umfasst, sondern auch informelles Lernen einbezieht.
- Kapitel 3: Lebenslanges Lernen im Kontext des Bologna-Prozesses
Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung und die Bedeutung des lebenslangen Lernens im Kontext des Bologna-Prozesses. Es zeigt auf, wie das Konzept des lebenslangen Lernens im Bologna-Prozess verankert ist und welche Ziele es für die europäischen Hochschulsysteme verfolgt.
- Kapitel 4: Lebenslanges Lernen an deutschen Hochschulen
Kapitel 4 analysiert die Umsetzung des lebenslangen Lernens an deutschen Hochschulen im Sinne des Bologna-Prozesses. Es beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Implementierung des lebenslangen Lernens in Deutschland ergeben.
- Kapitel 5: Lebenslanges Lernen an finnischen Hochschulen
Kapitel 5 widmet sich der Analyse der Umsetzung des lebenslangen Lernens an finnischen Hochschulen. Es untersucht die spezifischen Strategien und Ansätze, die in Finnland verfolgt werden, um das Konzept des lebenslangen Lernens im Hochschulwesen zu implementieren.
Schlüsselwörter
Bologna-Prozess, lebenslanges Lernen, Hochschulbildung, Heterogenität der Lernenden, Wissensgesellschaft, demografischer Wandel, Bildungszugänge, deutscher Hochschulraum, finnisches Hochschulsystem, Vergleich, Übertragung, Implementierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Bologna-Prozesses bezüglich lebenslangem Lernen?
Ziel ist es, die Durchlässigkeit des Bildungssystems zu erhöhen und auch unterrepräsentierten Gruppen (z.B. Berufstätigen ohne Abitur) den Zugang zur Hochschulbildung zu erleichtern.
Warum gilt Finnland als Vorbild für lebenslanges Lernen?
In Finnland sind die Grenzen zwischen beruflicher und akademischer Bildung fließender, und die Hochschulen sind besser darauf ausgerichtet, eine heterogene Studierendenschaft zu integrieren.
Wo liegen die Probleme im deutschen Hochschulwesen?
Deutschland trennt berufliche und hochschulische Bildung noch sehr stark, was den Zugang für nicht-traditionelle Lernende erschwert.
Was umfasst der Begriff „lebenslanges Lernen“?
Er umfasst alles Lernen während des gesamten Lebens – von der formalen Ausbildung über berufliche Weiterbildung bis hin zum informellen Lernen im Alltag.
Wie kann die Durchlässigkeit an Hochschulen verbessert werden?
Durch die Anerkennung beruflich erworbener Kompetenzen, flexiblere Studienformate und gezielte Förderangebote für bildungsferne Schichten.
- Citar trabajo
- Jan Dissemond (Autor), 2019, Lebenslanges Lernen als bildungspolitisches Konzept für europäische Hochschulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1175846