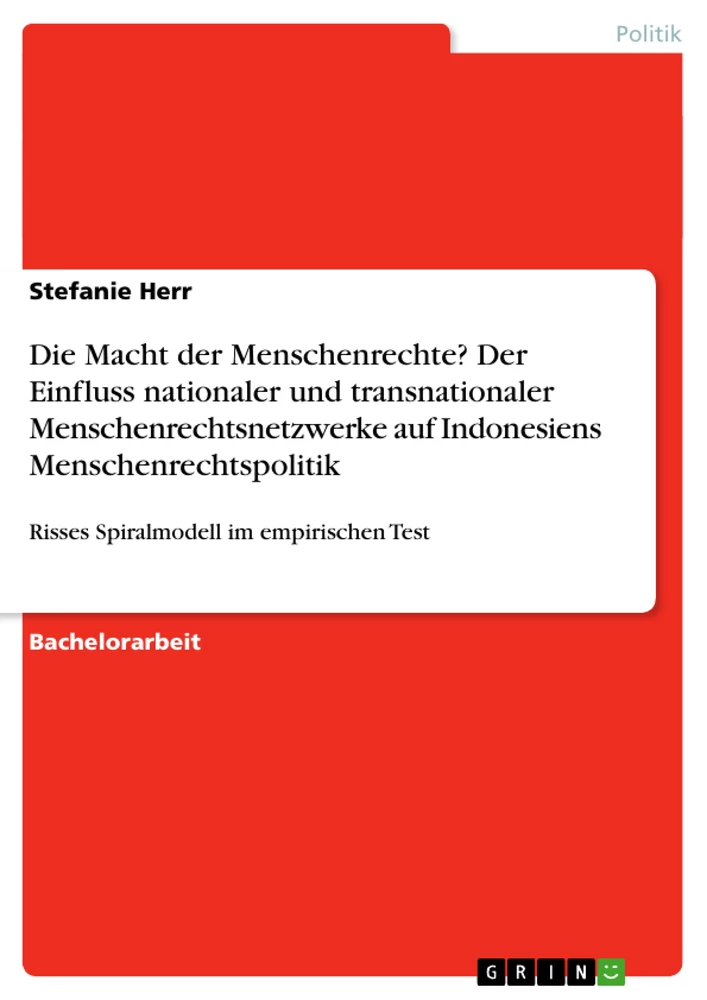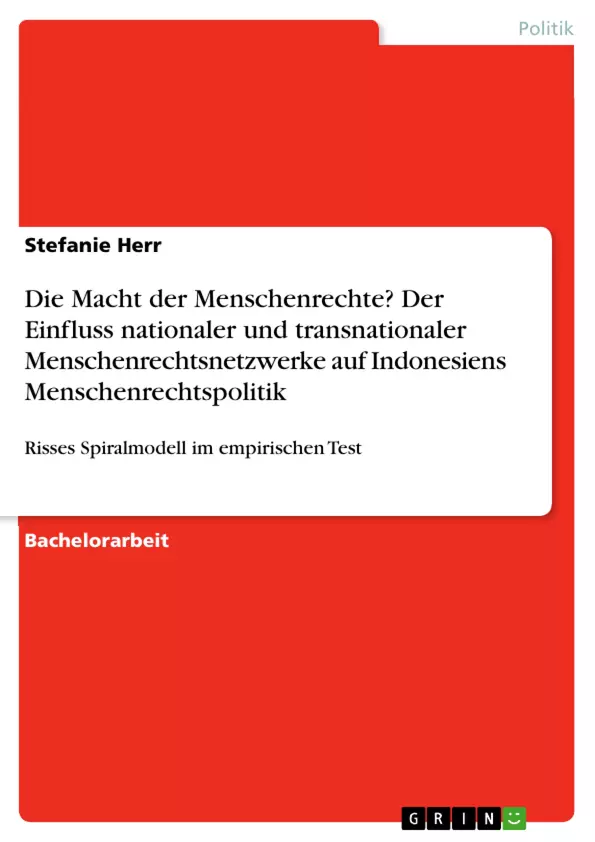Sechzig Jahre nach der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gehört das internationale Menschenrechtsregime zu den am stärksten institutionalisierten Bereichen der internationalen
Beziehungen1. Seit 1994 existiert kein Staat mehr, der nicht mindestens einer der zentralen Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen beigetreten ist. Dies ist umso erstaunlicher, da der Schutz von Menschenrechten die Befugnisse souveräner Nationalstaaten gegenüber ihren
Bürgern einschränkt (Risse 2003: 226). Folgt man jedoch Berichten von Amnesty International oder Human Rights Watch wird schnell deutlich, dass, im Unterschied zur vorangeschrittenen Verrechtlichung des globalen Menschenrechtsregimes, viele Staaten von einer effektiven Durchsetzung
der grundlegenden Bürger- und Freiheitsrechte noch weit entfernt sind. Die Erfolge bei der Normsetzung und deren Durchsetzung klaffen folglich weit auseinander (vgl. Schmitz/Sikkink 2001, Shute/Hurley 1996). Es stellt sich daher die Frage, wie diese großen Unterschiede zwischen der Anerkennung
der Menschenrechte und ihrer Einhaltung zu erklären sind. Warum kommt es in manchen Weltregionen zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage, während in anderen weiterhin massive Menschenrechtsverletzungen begangen werden?
Der Politikwissenschaftler Thomas Risse untersuchte in einem transatlantischen Forschungsprojekt die Wirkung internationaler Menschenrechtsnormen auf den politischen Wandel im Inneren eines Staates. Annahme des Forschungsprojektes war, dass in Staaten, in denen Menschenrechtsverletzungen begangen werden, ein Wandel durch die internationale Menschenrechtsnorm in Gang gesetzt
werden kann, wenn der transnationale Druck auf die normverletzenden Regierungen stark genug ist. Normunternehmer sind dabei like-minded Staaten, staatliche Bürokratien, Internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Der Einfluss transnationaler Menschenrechtsnetzwerke auf die nationale Menschenrechtspolitik steht für Risse et al. dabei im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Problemaufriss und allgemeines Forschungsinteresse
- 2. Die Macht der Menschenrechte
- 2.1 Das Spiralmodell
- 3. Risses Spiralmodell im empirischen Test: Indonesiens Menschenrechtspolitik bis 2001
- 3.1 Die Phase der Repression
- 3.2 Die Phase des Leugnens
- 3.3 Die Phase taktischer Konzessionen
- 3.4 Die Phase des präskriptiven Status
- 4. Die Mobilisierung der nationalen und internationalen Öffentlichkeit seit 2001
- 4.1 Stärkung der indonesischen Zivilgesellschaft?
- 4.2 Die Arbeit indonesischer Menschenrechtsorganisationen
- 4.3 Transnationale Menschenrechtsnetzwerke
- 4.4 Anhaltende Mobilisierung der Öffentlichkeit?
- 5. Risses Spiralmodell revisited: Die aktuelle Menschenrechtspolitik in Indonesien
- 5.1 Institutionelle Rahmenbedingungen
- 5.2 Rights in practice
- 5.2.1 Straffreiheit
- 5.2.2 Bürgerliche Rechte
- 5.2.3 Politische Freiheitsrechte
- 5.3 Normanerkennung vs. Normeinhaltung
- 6. Auswertung des empirischen Befunds
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die aktuelle Menschenrechtssituation in Indonesien anhand des Spiralmodells von Thomas Risse. Sie überprüft die These, dass die Anerkennung der Menschenrechte in Indonesien zur Normeinhaltung geführt hat. Dazu analysiert die Arbeit den Einfluss nationaler und transnationaler Menschenrechtsnetzwerke auf die indonesische Menschenrechtspolitik und untersucht, ob der Druck auf die Regierung zu einer nachhaltigen Verbesserung der Menschenrechtslage geführt hat.
- Das Spiralmodell und seine Anwendbarkeit auf Indonesien
- Die Rolle der indonesischen Zivilgesellschaft und transnationaler Menschenrechtsnetzwerke
- Die aktuelle Menschenrechtspraxis in Indonesien
- Die Diskrepanz zwischen Normanerkennung und Normeinhaltung
- Die Auswirkungen des Drucks auf die indonesische Regierung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt das allgemeine Forschungsinteresse der Arbeit vor. Kapitel 2 erläutert das Spiralmodell von Thomas Risse, welches die Interaktionen zwischen nationalen und transnationalen Akteuren im Bereich der Menschenrechtspolitik beschreibt. Kapitel 3 analysiert die Menschenrechtsentwicklung in Indonesien bis 2001 im Lichte des Spiralmodells. Kapitel 4 untersucht die Mobilisierung der nationalen und internationalen Öffentlichkeit seit 2001 und beleuchtet die Rolle der indonesischen Zivilgesellschaft und transnationaler Menschenrechtsnetzwerke. Kapitel 5 analysiert die aktuelle Menschenrechtspolitik in Indonesien und untersucht, ob die Normeinhaltung der Normanerkennung gefolgt ist. Kapitel 6 wertet die empirischen Befunde aus und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Menschenrechte, Indonesien, Spiralmodell, transnationale Menschenrechtsnetzwerke, Zivilgesellschaft, Normanerkennung, Normeinhaltung, Straffreiheit, Bürgerliche Rechte, Politische Freiheitsrechte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Spiralmodell“ von Thomas Risse?
Das Spiralmodell beschreibt den Prozess, wie internationaler Druck und nationale Mobilisierung dazu führen, dass Staaten Menschenrechtsnormen erst leugnen, dann taktisch anerkennen und schließlich einhalten.
Wie hat sich Indonesiens Menschenrechtspolitik bis 2001 entwickelt?
Die Entwicklung durchlief Phasen der Repression, des Leugnens und taktischer Konzessionen, bis hin zu einem präskriptiven Status der Normanerkennung.
Führt die Anerkennung von Menschenrechten in Indonesien auch zu deren Einhaltung?
Die Arbeit untersucht die kritische Diskrepanz zwischen der formalen Anerkennung von Normen und der tatsächlichen Praxis („Rights in practice“), insbesondere im Hinblick auf Straffreiheit.
Welche Rolle spielen transnationale Menschenrechtsnetzwerke?
Netzwerke aus NGOs, internationalen Organisationen und „like-minded“ Staaten üben Druck auf Regierungen aus, um politische Veränderungen im Inneren zu erzwingen.
Was sind die größten Probleme der aktuellen Menschenrechtslage in Indonesien?
Trotz institutioneller Rahmenbedingungen bleiben Straffreiheit bei Verletzungen, Einschränkungen bürgerlicher Rechte und politischer Freiheiten zentrale Herausforderungen.
- Citation du texte
- Bachelor Stefanie Herr (Auteur), 2008, Die Macht der Menschenrechte? Der Einfluss nationaler und transnationaler Menschenrechtsnetzwerke auf Indonesiens Menschenrechtspolitik , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117584