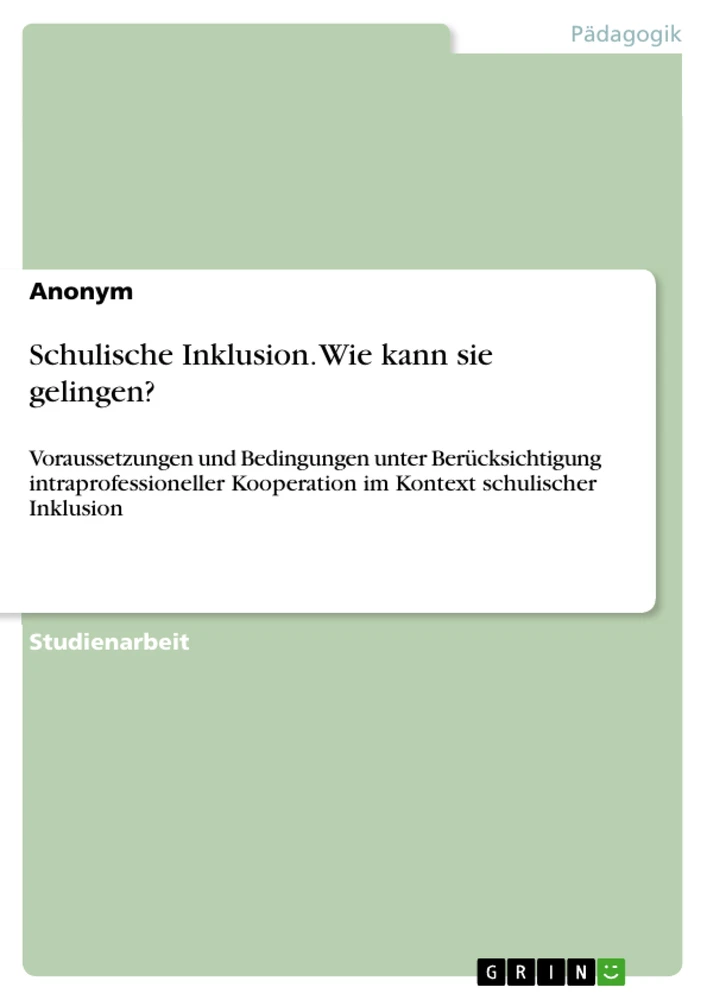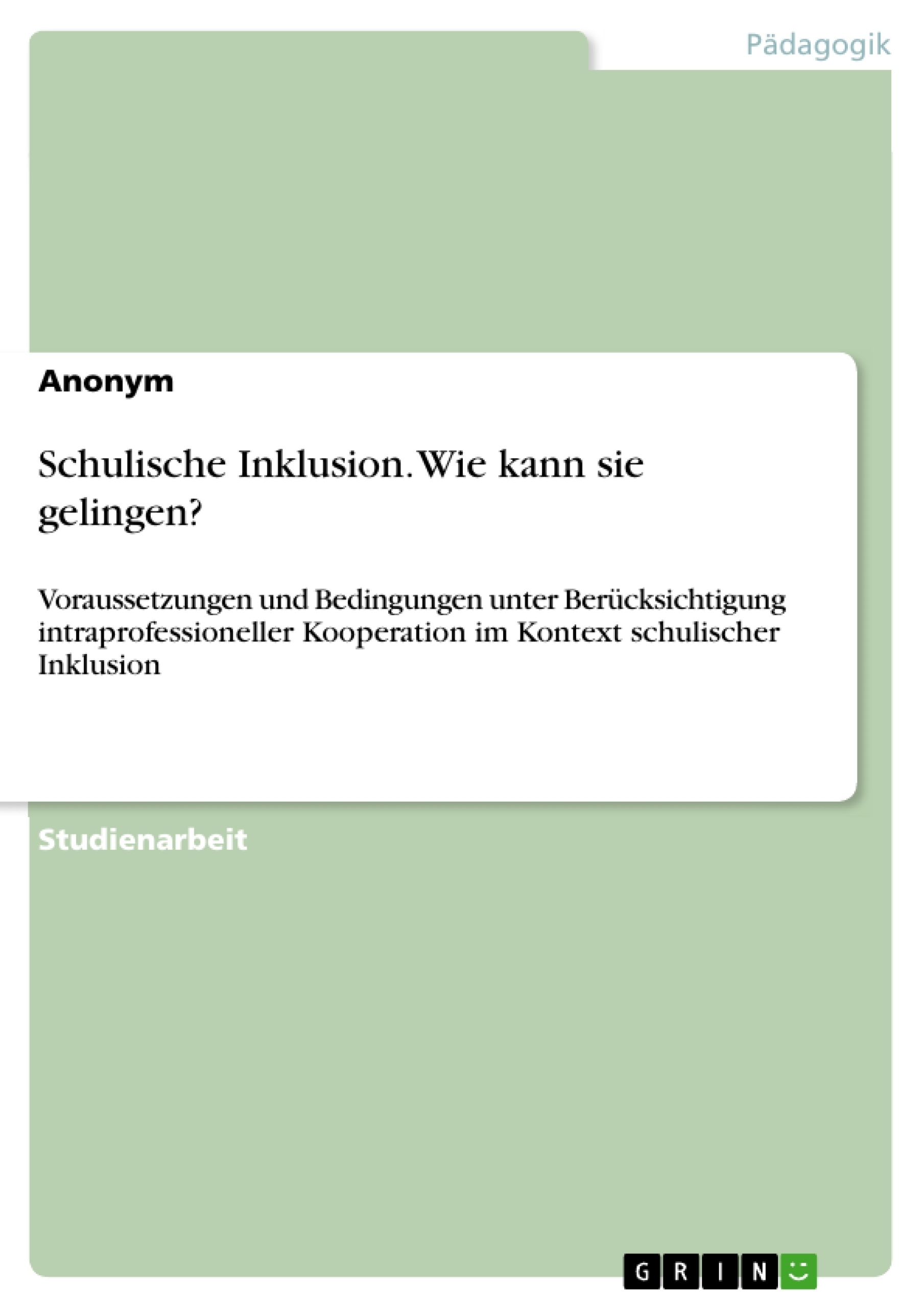Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die intraprofessionelle Kooperation an Schulen der Sekundarstufe zwischen Lehrkräften der Regelschulen mit jenen Lehrerinnen und Lehrern, die sonderpädagogisch ausgebildet sind. Zentral ist dabei die Fragestellung, welche Theorien und Modelle der intraprofessionellen Kooperation es gibt und welche Bedingungen die Kooperation der Lehrkräfte möglich machen und sie sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Zum besseren Verständnis der Arbeit wird nachfolgend der Begriff der intraprofessionellen Kooperation definiert. Daran anschließend werden ausgewählte Modelle und Theorien der intraprofessionellen Kooperationen vorgestellt und auf Grundlage dessen zentrale Bedingungen für gelingende Kooperation herausgearbeitet.
Die Kultusminister der Länder reagierten auf das Konzept der inklusiven Schulbildung mit dem Vorschlag, Lehrpersonen mit Ausbildungen in verschiedenen Lehrämtern die gemeinsame Verantwortung zum Unterrichten dieser Schülerinnen und Schüler an Regelschulen zu geben. Die Möglichkeit für Lehrende in professionellen Teams zu arbeiten bietet allen Lernenden die Chance auf Unterricht, der auf individuelle Lernvoraussetzungen eingehen kann und diese bestmöglich fördern kann. Diese sogenannte intraprofessionelle Kooperation der Lehrkräfte, speziell von Regelschullehrkräften und jener, die eine sonderpädagogische Ausbildung durchlaufen haben, wird in der Theorie als zentrale Bedingung für gelingende Inklusion gesehen, jedoch in der Praxis selten umgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- (Intraprofessionelle) Kooperation
- Kooperationsmodelle, Theorien und Formen
- Reisers Theorie integrativer Prozesse
- Niveaustufenmodell nach Marvin
- Kooperationsstrategien nach Friend und Cook
- Bedingungen für gelingende intraprofessionelle Kooperation
- Wechselseitiges Vertrauen als Grundlage für gemeinsame Zielfindung
- Autonomie (abgeben)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die intraprofessionelle Kooperation an Schulen der Sekundarstufe zwischen Regelschullehrkräften und sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften im Kontext inklusiver Bildung. Die Zielsetzung besteht darin, relevante Theorien und Modelle der Kooperation zu analysieren und die Bedingungen für gelingende Kooperation herauszuarbeiten, die Inklusion fördern oder behindern.
- Intraprofessionelle Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagogen
- Theorien und Modelle der Kooperation im Kontext inklusiver Bildung
- Bedingungen für gelingende und nicht gelingende Kooperation
- Einfluss von Autonomie und Vertrauen auf die Kooperation
- Bedeutung der UN-BRK für inklusive Schulbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der inklusiven Schulbildung ein und erläutert das Leitbild der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Es betont die Bedeutung von Inklusion als gesellschaftliche Zielsetzung und die Notwendigkeit eines integrativen Bildungssystems, welches allen Kindern und Jugendlichen gleiche Bildungschancen bietet. Die UN-BRK Grundsätze werden vorgestellt und ihre Relevanz für die inklusive Schulbildung hervorgehoben. Das Kapitel legt den Fokus auf die intraprofessionelle Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagogen als zentrale Bedingung für gelingende Inklusion und führt in die Forschungsfrage der Arbeit ein.
2. (Intraprofessionelle) Kooperation: Dieses Kapitel definiert den Begriff der intraprofessionellen Kooperation und untersucht dessen Bedeutung für die inklusive Schulbildung. Es werden verschiedene Ansätze und Definitionen von Kooperation vorgestellt, wobei die Aspekte gemeinsame Ziele, Kommunikation, gegenseitige Unterstützung, konstruktive Kritik und Autonomie der beteiligten Lehrkräfte betont werden. Die Herausforderungen in der Praxis, insbesondere der zeitliche Aspekt und die oft fehlende Möglichkeit für gemeinsame Teamarbeit, werden angesprochen. Der Zusammenhang zwischen Kooperation, Chancengleichheit und den Prinzipien der UN-BRK wird deutlich gemacht.
Schlüsselwörter
Inklusion, intraprofessionelle Kooperation, inklusive Schulbildung, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Sonderpädagogik, Regelschullehrkräfte, Kooperationstheorien, Autonomie, Vertrauen, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Intraprofessionelle Kooperation an Schulen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die intraprofessionelle Kooperation zwischen Regelschullehrkräften und sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften an Schulen der Sekundarstufe im Kontext inklusiver Bildung. Der Fokus liegt auf der Analyse relevanter Theorien und Modelle der Kooperation und der Herausarbeitung von Bedingungen, die Inklusion fördern oder behindern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Intraprofessionelle Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagogen; Theorien und Modelle der Kooperation im Kontext inklusiver Bildung; Bedingungen für gelingende und nicht gelingende Kooperation; Einfluss von Autonomie und Vertrauen auf die Kooperation; Bedeutung der UN-BRK für inklusive Schulbildung.
Welche Kooperationsmodelle und -theorien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem Reisers Theorie integrativer Prozesse, das Niveaustufenmodell nach Marvin und Kooperationsstrategien nach Friend und Cook. Diese Modelle und Theorien werden im Kontext der intraprofessionellen Kooperation zwischen Regelschullehrkräften und Sonderpädagogen im inklusiven Schulsystem untersucht.
Welche Bedingungen fördern gelingende Kooperation?
Gelingende Kooperation wird unter anderem durch wechselseitiges Vertrauen als Grundlage für gemeinsame Zielfindung und durch die Berücksichtigung der Autonomie der beteiligten Lehrkräfte gefördert. Die Arbeit untersucht diese und weitere Faktoren im Detail.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)?
Die UN-BRK wird als zentrales Leitbild für inklusive Schulbildung vorgestellt. Ihre Grundsätze und ihre Relevanz für die inklusive Schulbildung und die intraprofessionelle Kooperation werden in der Arbeit hervorgehoben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur intraprofessionellen Kooperation, ein Kapitel zu Kooperationsmodellen und -theorien, ein Kapitel zu den Bedingungen für gelingende Kooperation und ein Fazit. Zusätzlich werden die Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inklusion, intraprofessionelle Kooperation, inklusive Schulbildung, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Sonderpädagogik, Regelschullehrkräfte, Kooperationstheorien, Autonomie, Vertrauen, Chancengleichheit.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kürze)?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse der intraprofessionellen Kooperation zusammen und benennt die zentralen Bedingungen für gelingende Kooperation im inklusiven Kontext. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im bereitgestellten Text nicht detailliert aufgeführt.)
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Schulische Inklusion. Wie kann sie gelingen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176201