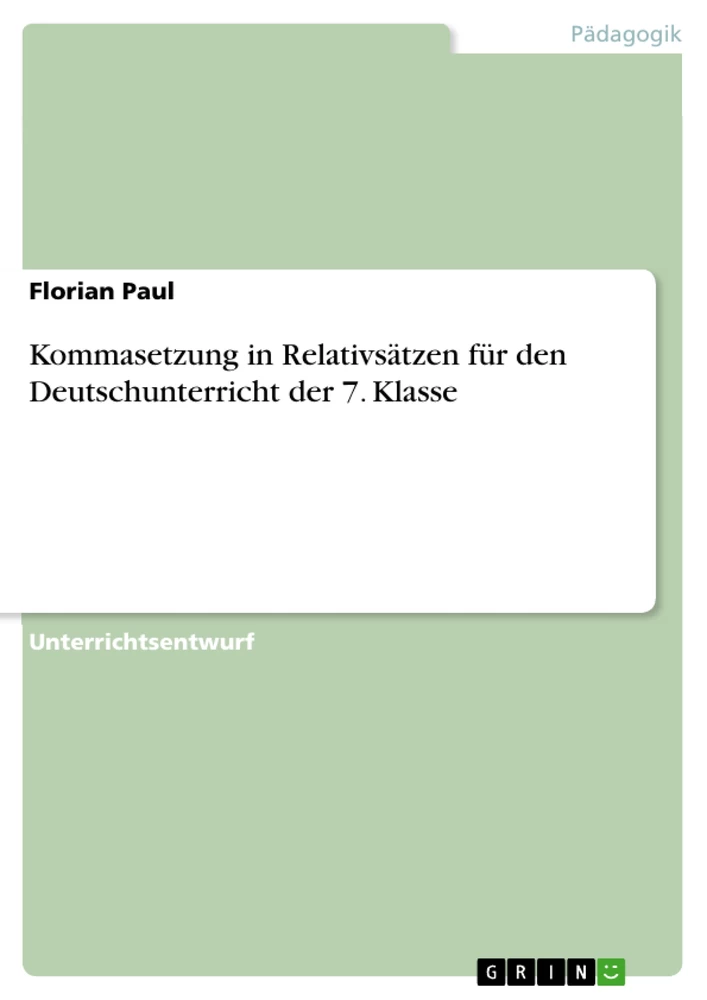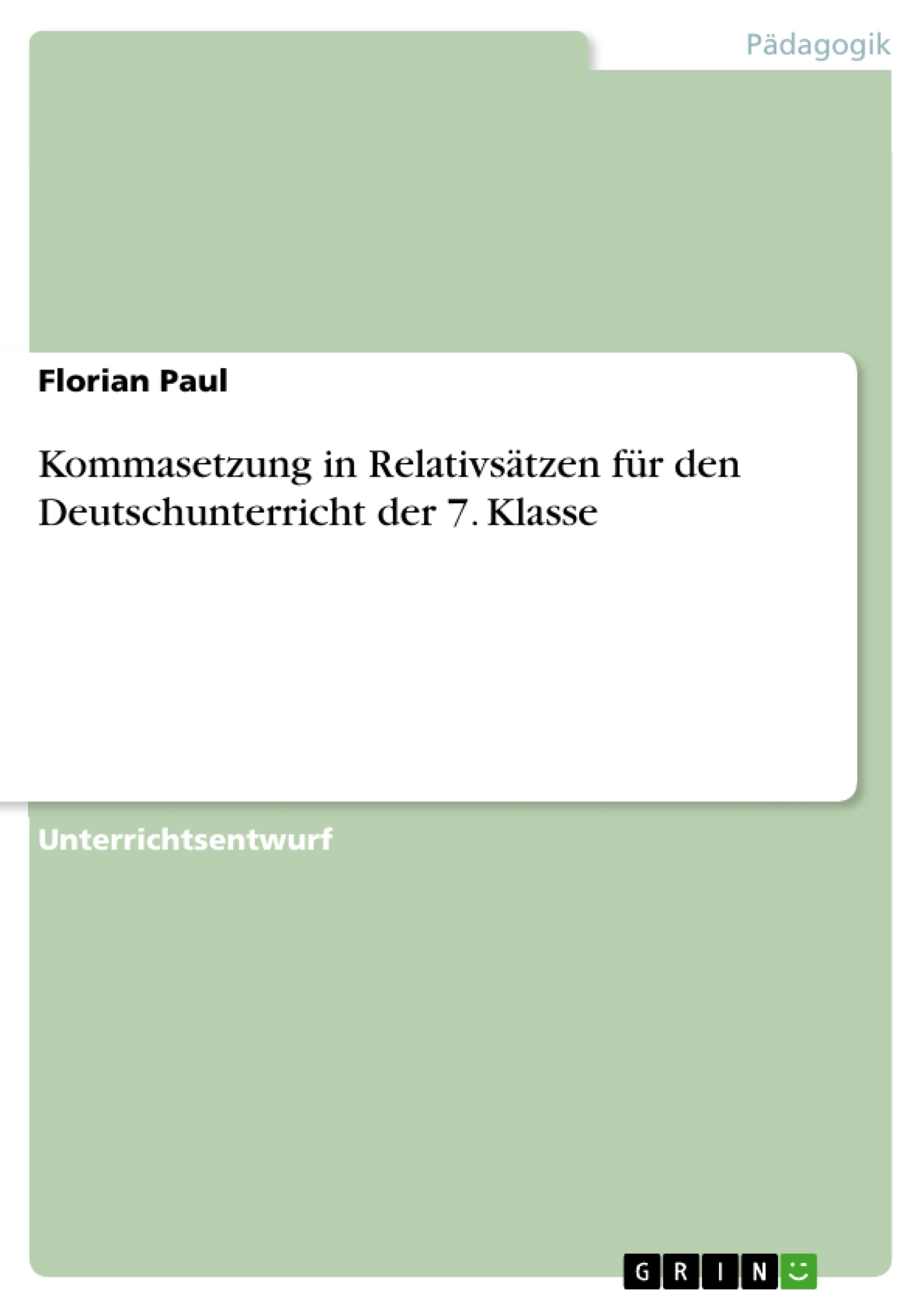Diese Arbeit beinhaltet einen Unterrichtsentwurf mit Reflexion für 7. Klassen, der sich mit der Vermittlung von Kommasetzungsstrategien bezogen auf Relativsätze im Deutschunterricht beschäftigt.
Die Sequenz ist mit fünf Unterrichtsstunden veranschlagt. Die Einzelthemen werden als Teil einer Stationsarbeit umgesetzt, sodass jeweils drei Schüler ihre Stationen durchführen und zwei weitere hospitieren. Die Stationen wechseln innerhalb der Sequenz. Am Ende der Sequenz müssen alle Schüler und Schülerinnen jede Station mindestens einmal absolviert haben. Das Thema der Sequenz bildet die Vermittlung von typischen Rechtschreibstrategien und die Erweiterung der orthografischen Kompetenzen auf der Basis von ausgewählten Fehlerschwerpunkten.
Das System der Kommata ist ein rein syntaktisches System, obwohl es häufig von den Schülern eher semantisch verstanden wird. Natürlich gibt es teilweise, unter anderem auch im Fall einiger Relativsätze, solche Sätze, die aufgrund ihrer Semantik Schwierigkeiten bei der Vermittlung der korrekten Kommasetzung hervorrufen können.
In seiner minimalsten Form besteht der Relativsatz grundlegend aus einem relativistischen Attribut, welches sich auf ein Wort oder eine Wortgruppe des Matrixsatzes bezieht sowie aus einem infiniten Verb. Das Verb steht immer in der Verbletztstellung, wobei das relativistische Attribut nicht immer am Beginn des Relativsatzes stehen muss. Es ist ebenso möglich, dass vor dem relativistischen Attribut eine Präposition steht.
Inhaltsverzeichnis
- Kontext: Einordnung der Stunde in die Unterrichtssequenz
- Bemerkungen zur Lerngruppe (Bedingungsanalyse)
- Didaktische Analyse
- Verortung der Stunde im Lehrplan, erste Konkretisierung der Kompetenzvorgaben zu Unterrichtszielen, erste Eingrenzung und Begründung des zentralen Unterrichtsthemas
- Überlegungen zum Unterrichtsgegenstand (Sachanalyse)
- Unterrichtsziele und angestrebte Kompetenzentwicklung
- Aufbau der Stunde mit Begründung
- Tabellarische Verlaufsplanung
- Erläuterungen zur Verlaufsplanung
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, die Kommatierungsfähigkeiten von Schülern in der siebten Klasse zu verbessern, indem sie sich auf den Schwerpunkt der Kommasetzung in Relativsätzen konzentriert. Die Stunde soll die Schüler dazu befähigen, die Regeln der Kommasetzung in Relativsätzen anzuwenden und die Bedeutung dieser Regeln für den korrekten Satzbau zu verstehen.
- Kommasetzung in Relativsätzen
- Identifizierung verschiedener Arten von Relativsätzen (Einschübe, Relativsätze am Ende eines Satzgefüges)
- Anwendung von Rechtschreibstrategien zur Kommasetzung in Relativsätzen
- Vertiefung des Verständnisses von Satzbau und Kommasetzung
- Verbesserung der Rechtschreibkompetenzen der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Kontext: Einordnung der Stunde in die Unterrichtssequenz
Diese Stunde ist Teil einer fünfstündigen Unterrichtssequenz, die sich mit Rechtschreibstrategien und der Erweiterung orthographischer Kompetenzen beschäftigt. Die Schüler arbeiten an verschiedenen Stationen, die jeweils von drei Schülern durchgeführt und von zwei anderen Schülern hospitiert werden. Die Themen der Stationen wurden anhand der Ergebnisse eines Lernausgangslagetests ausgewählt.
Bemerkungen zur Lerngruppe (Bedingungsanalyse)
Die Lerngruppe besteht aus 16 Schülern der siebten Klasse. Die Stunde findet im Rahmen eines 90-minütigen Blocks statt, der in 45-minütige Einzelstunden unterteilt ist. Die Klassenlehrerin empfiehlt eine allgemeine Rechtschreibförderung, die mit den Ergebnissen des Lernausgangslagetests übereinstimmt. Der Test zeigt, dass die Schüler zwar einzelne Rechtschreibkompetenzen abrufen können, aber Schwierigkeiten haben, Rechtschreibung und Grammatik in freien Texten korrekt anzuwenden, insbesondere in Bezug auf die Kommasetzung in Relativsätzen.
Didaktische Analyse
Verortung der Stunde im Lehrplan, erste Konkretisierung der Kompetenzvorgaben zu Unterrichtszielen, erste Eingrenzung und Begründung des zentralen Unterrichtsthemas
Die Unterrichtsstunde soll die Schüler auf die Niveaustufe E des Rahmenlehrplans für Berlin und Brandenburg führen, da die Ergebnisse des Lernausgangslagetests zeigen, dass viele Schüler die Niveaustufe E noch nicht vollständig erreicht haben. Der Schwerpunkt der Stunde liegt auf der Verbesserung der Kommatierungsfähigkeiten in Relativsätzen, da dies ein entscheidender Fehlerschwerpunkt bei den Schülern ist.
Schlüsselwörter
Kommasetzung, Relativsätze, Rechtschreibstrategien, orthographische Kompetenz, Satzbau, Rechtschreibung, Grammatik, Lernausgangslage, Rahmenlehrplan, Niveaustufe, Fehlerschwerpunkte, Unterrichtssequenz.
Häufig gestellte Fragen
Wie setzt man Kommata in Relativsätzen richtig?
Ein Relativsatz muss immer durch Kommata vom Hauptsatz abgegrenzt werden, unabhängig davon, ob er am Ende steht oder in den Hauptsatz eingeschoben ist.
Woran erkennt man einen Relativsatz?
Relativsätze werden meist durch Relativpronomen wie "der", "die", "das", "welcher" oder Relativadverbien eingeleitet und beziehen sich auf ein Nomen im Hauptsatz.
Was ist das Ziel der Unterrichtseinheit für die 7. Klasse?
Das Ziel ist die Vermittlung von Rechtschreibstrategien, um die orthografische Kompetenz der Schüler speziell bei der Kommasetzung in komplexen Satzgefügen zu verbessern.
Warum fällt Schülern die Kommasetzung oft schwer?
Schüler verstehen Kommata oft semantisch (Sprechpausen), obwohl das deutsche Kommasystem rein syntaktisch (nach Satzbau-Regeln) funktioniert.
Was ist eine Stationsarbeit im Deutschunterricht?
Bei dieser Methode bearbeiten Schüler verschiedene Aufgabenstationen in ihrem eigenen Tempo, was differenziertes Lernen ermöglicht.
Wo steht das Verb im Relativsatz?
In einem Relativsatz steht das konjugierte Verb in der Regel an der letzten Stelle (Verbletztstellung).
- Citar trabajo
- Florian Paul (Autor), 2022, Kommasetzung in Relativsätzen für den Deutschunterricht der 7. Klasse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176580