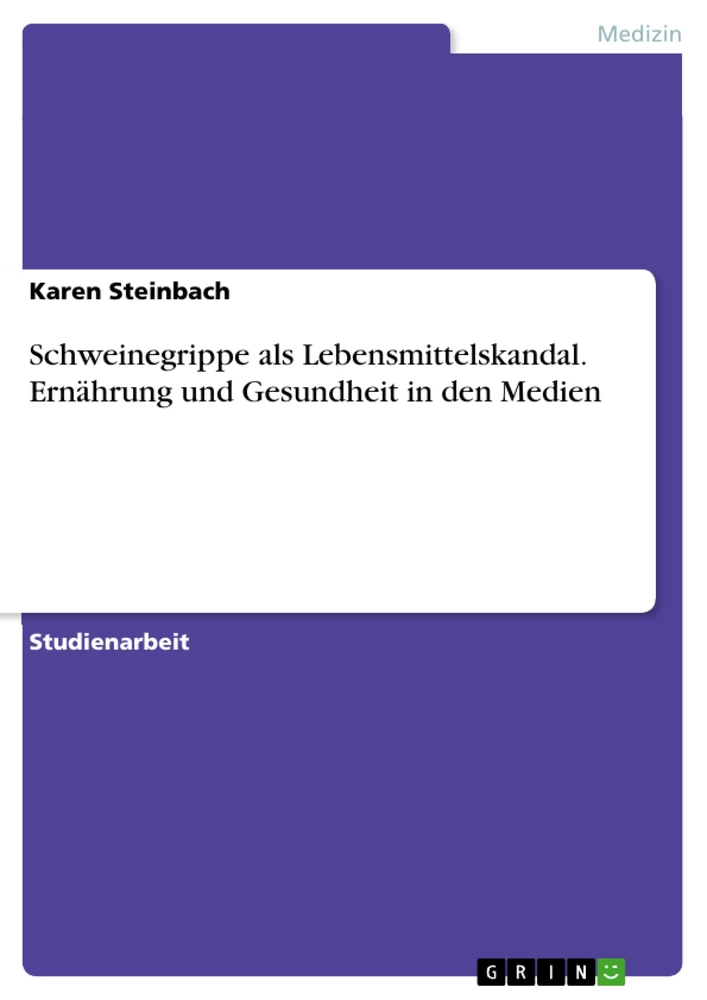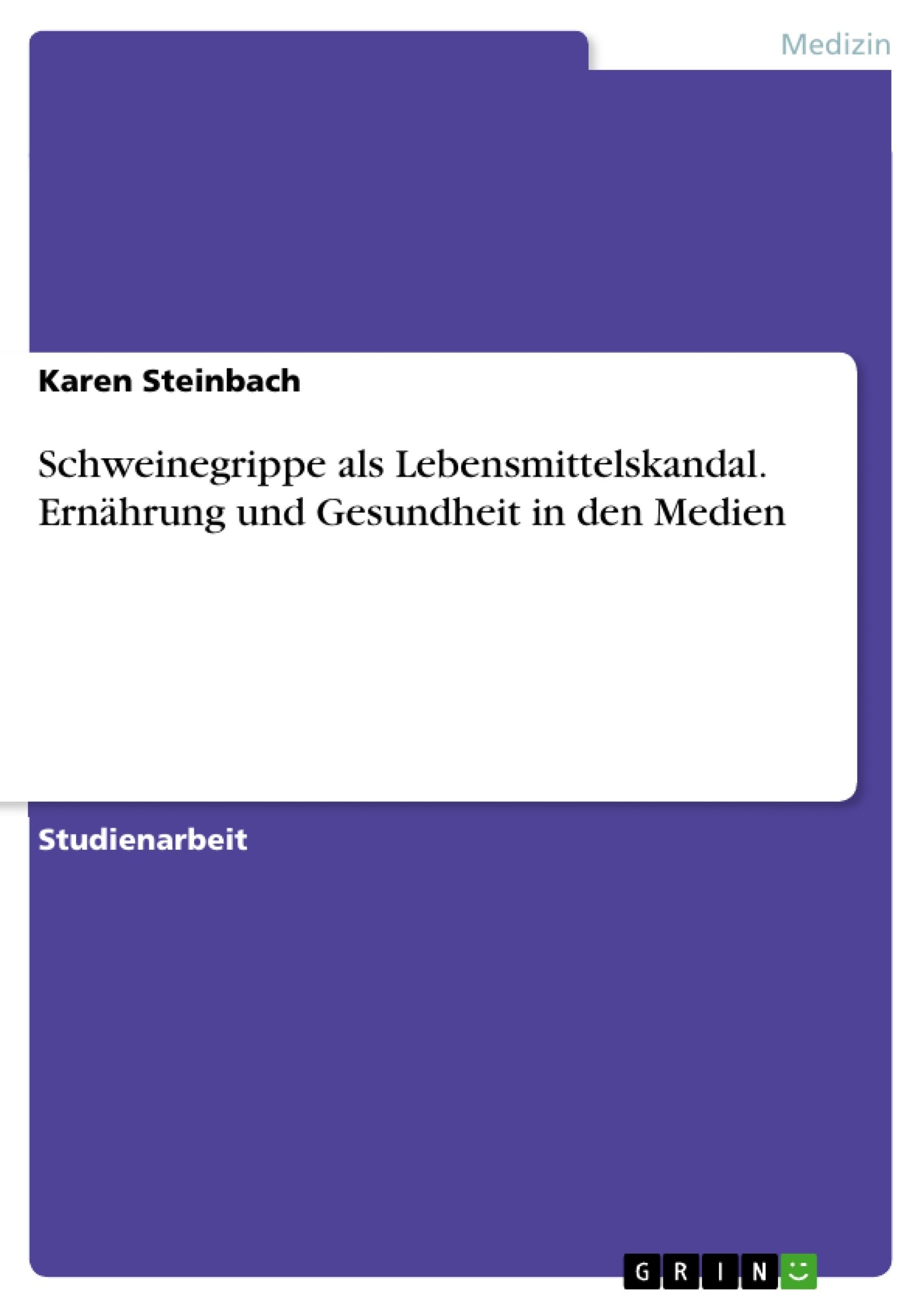Die Hausarbeit thematisiert die Lebensmittelskandale. Die Hauptfragestellung soll dabei sein, ob die Schweinegrippewelle, mit der Deutschland in den Jahren 2009 und 2010 zu kämpfen hatte, zu den Lebensmittelskandalen zählt, oder nicht. Dazu sollen bestimmte Argumente aufgestellt und belegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Basis - wie verläuft ein typischer Lebensmittelskandal und was charakterisiert ihn?
- Schweinegrippe - ein Lebensmittelskandal?
- Was ist die Schweinegrippe?
- Diskursverlauf der Schweinegrippe
- Dargestellte Bedrohung = reale Bedrohung?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Lebensmittelskandalen auf die Medienlandschaft. Konkret untersucht sie, ob die Schweinegrippewelle der Jahre 2009 und 2010 als Lebensmittelskandal eingestuft werden kann. Die Arbeit analysiert die typischen Elemente eines Lebensmittelskandals und untersucht die Berichterstattung zur Schweinegrippe in den Medien, um festzustellen, inwiefern diese den typischen Kriterien entspricht.
- Charakteristika von Lebensmittelskandalen in den Medien
- Die Schweinegrippe als potentieller Lebensmittelskandal
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Skandalen
- Die Auswirkungen von Lebensmittelskandalen auf das Konsumentenverhalten
- Die politische Dimension von Lebensmittelskandalen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor: Ist die Schweinegrippe ein Lebensmittelskandal? Sie skizziert den Forschungsrahmen und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
Theoretische Basis – wie verläuft ein typischer Lebensmittelskandal und was charakterisiert ihn?
Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Lebensmittelskandalen. Es erklärt, wie ein Missstand zu einem Skandal wird und welche Medienmechanismen dabei eine Rolle spielen. Dabei werden Faktoren wie die Dramatisierung von Missständen, die Latenzzeit und die Rolle der öffentlichen Meinung betrachtet.
Schweinegrippe - ein Lebensmittelskandal?
Dieses Kapitel widmet sich dem konkreten Beispiel der Schweinegrippe. Es beschreibt die Krankheit selbst, den Verlauf des Diskurses in den Medien und die Frage, inwieweit die dargestellte Bedrohung der realen Gefahr entsprach.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Lebensmittelskandale, Medienberichterstattung, Schweinegrippe, Diskursanalyse, Bedrohung und öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen
Gilt die Schweinegrippe offiziell als Lebensmittelskandal?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch. Ein Lebensmittelskandal erfordert meist einen Missstand in der Produktion oder Qualität von Nahrungsmitteln, während die Schweinegrippe primär eine virale Infektionswelle war.
Was charakterisiert einen typischen Lebensmittelskandal?
Typische Merkmale sind die Entdeckung eines Missstands, eine starke mediale Dramatisierung, eine Phase der öffentlichen Empörung und Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten.
Welche Rolle spielen die Medien bei der Konstruktion von Skandalen?
Medien wirken als Verstärker, indem sie Bedrohungen thematisieren, Verantwortliche suchen und durch kontinuierliche Berichterstattung den öffentlichen Diskurs prägen.
Gab es bei der Schweinegrippe eine reale Bedrohung durch Lebensmittel?
Die Untersuchung analysiert den Diskursverlauf und stellt fest, dass die mediale Darstellung der Gefahr oft nicht mit der tatsächlichen epidemiologischen Bedrohung durch Lebensmittel übereinstimmte.
Wie reagieren Konsumenten auf Lebensmittelskandale?
Oft führt ein Skandal zu einem kurzfristigen Einbruch der Nachfrage nach betroffenen Produkten und zu einem langfristig gesteigerten Bewusstsein für Lebensmittelqualität.
- Arbeit zitieren
- Karen Steinbach (Autor:in), 2016, Schweinegrippe als Lebensmittelskandal. Ernährung und Gesundheit in den Medien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176820