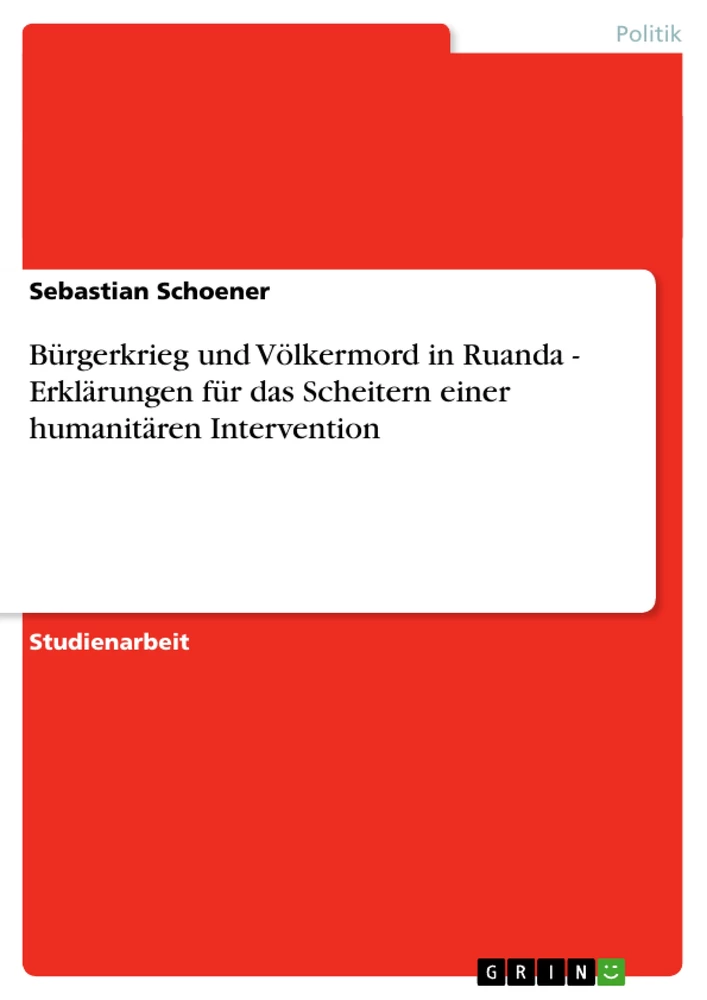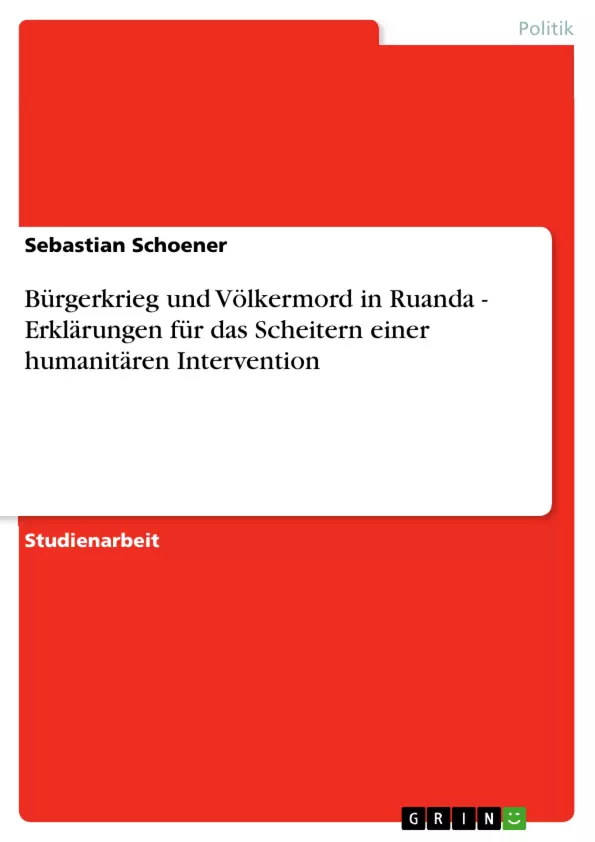Bei einer humanitären Intervention handelt es sich per definitionem um „ein auf Gewaltmittel gestütztes Eingreifen eines oder mehrerer Staaten in einem anderen Staat […], um dort nennenswerten Bevölkerungsteilen, die durch besonders brutale Gewalt massiv bedroht werden, zu helfen“ (Zangl, 2002: 106). Eine solche Intervention in einen fremden Staat bezieht sich dabei auf völkerrechtliche Grundsätze. Innerhalb des Zeitraums vom 6. April 1994 bis Mitte Juli 1994 werden in Ruanda ungefähr 800 000 Menschen umgebracht. Die Brutalität und die Geschwindigkeit in der Art und Weise der Durchführung dieses erst spät als Genozid bezeichneten Massakers sucht seinesgleichen in der Geschichte. 100 Tage lang werden innerhalb jeder Minute durchschnittlich 5 ½ Menschen getötet. Dies übertrifft die Rate der Ermordung an den Juden durch die Nationalsozialisten, wobei man beim Völkermord in Ruanda von einer industriellen Vernichtung wie im Falle des Holocausts nicht sprechen kann (Barnett, 2002: 1). Es war ein staatlich organisierter Massenmord, bei dem das Volk zu Massenmördern wurde. Und trotz der eingangs zitierten Bedingung zur Durchführung einer humanitären Intervention hat die internationale Gemeinschaft, allen voran die Vereinten Nationen, sowie die politischen Führungen der hauptsächlich in die Vorgänge in Ruanda verwickelten Staaten, Belgien, USA und Frankreich, vergeblich auf eine adäquate Reaktion ihrerseits warten lassen. Gegenstand dieser Arbeit soll es sein, Erklärungen für das Scheitern einer humanitären Intervention in Ruanda zu liefern. Dabei wird das Augenmerk zunächst auf möglicherweise dafür verantwortliche interne Faktoren gelegt, ehe dahinter stehende externe Bedingungen näher erläutert werden. Zur Bewerkstelligung dessen bilden zuvor sowohl ein allgemein definitorischer Teil, als auch ein landeskundlicher und historischer Abriss Ruandas, sowie die Beschreibung der Konfliktentwicklung bis zum Jahre 1994 inklusive der daran beteiligten Parteien, den Einstieg in die Thematik. Die Abwägung eines Für und Wider humanitärer Interventionen findet in der vorliegenden Untersuchung allerdings keine weitere Beachtung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Definitorisches
- 1.1. Genozid
- 1.2. Humanitäre Intervention
- 2. Landeskunde und Historie
- 3. Gegenstand, Parteien und Voraussetzung des Konfliktes
- 4. Konfliktentwicklung
- 4.1. Hamitenhypothese und Kolonialverordnungen
- 4.2. Die Folgen
- 5. Gründe für das Scheitern der humanitären Intervention
- 5.1. interne Faktoren
- 5.1.1. schnelles Umsetzen des geplanten Völkermords
- 5.1.2. Taktik & Täuschung
- 5.2. externe Faktoren
- 5.2.1. die internationalen Akteure
- 5.2.2. die Vereinten Nationen
- 5.1. interne Faktoren
- 1. Definitorisches
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für das Scheitern der humanitären Intervention in Ruanda im Jahr 1994. Sie analysiert interne und externe Faktoren, die zum Völkermord und dem unzureichenden Eingreifen der internationalen Gemeinschaft beitrugen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Erklärung des Scheiterns, nicht auf die ethische Bewertung humanitärer Interventionen.
- Definition von Genozid und humanitärer Intervention
- Landeskunde und historische Entwicklung Ruandas
- Analyse der Konfliktparteien und Konfliktursachen
- Interne Faktoren des Interventions-Scheiterns
- Externe Faktoren des Interventions-Scheiterns
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff der humanitären Intervention und stellt den Kontext des ruandischen Völkermords dar, bei dem innerhalb von 100 Tagen etwa 800.000 Menschen getötet wurden. Sie hebt das Scheitern der internationalen Gemeinschaft hervor und kündigt die Struktur der Arbeit an, die sich auf interne und externe Faktoren konzentriert, die zu diesem Scheitern beigetragen haben. Die Arbeit verzichtet auf eine ethische Bewertung von humanitären Interventionen.
II. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit der definitorischen Klärung von Genozid und humanitärer Intervention anhand internationaler Konventionen und wissenschaftlicher Literatur. Es folgt eine landeskundliche und historische Einführung in Ruanda, die bis zur Kolonialzeit reicht und den Kontext des späteren Konflikts beleuchtet. Anschließend wird der Konflikt selbst detailliert beschrieben, inklusive der beteiligten Parteien und der Entwicklung des Genozids. Der Hauptteil analysiert abschließend die Gründe für das Scheitern der humanitären Intervention, indem er interne Faktoren (schnelles Tempo des Völkermords, Täuschungsmanöver) und externe Faktoren (Handlungsunfähigkeit der internationalen Akteure, insbesondere der Vereinten Nationen) differenziert betrachtet.
Schlüsselwörter
Ruanda, Genozid, Humanitäre Intervention, Völkermord, Internationale Beziehungen, Vereinte Nationen, interne Faktoren, externe Faktoren, Kolonialismus, Konfliktentwicklung, Scheitern der Intervention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Analyse des Scheiterns humanitärer Intervention in Ruanda 1994
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gründe für das Scheitern der humanitären Intervention während des ruandischen Genozids von 1994. Der Fokus liegt auf der Erklärung des Scheiterns, nicht auf einer ethischen Bewertung humanitärer Interventionen. Die Analyse berücksichtigt sowohl interne als auch externe Faktoren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Genozid und humanitärer Intervention, Landeskunde und historische Entwicklung Ruandas, Analyse der Konfliktparteien und -ursachen, interne Faktoren des Interventions-Scheiterns (schnelles Tempo des Völkermords, Täuschungsmanöver), und externe Faktoren des Interventions-Scheiterns (Handlungsunfähigkeit internationaler Akteure, insbesondere der Vereinten Nationen).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, die den Kontext des Genozids und das Scheitern der internationalen Gemeinschaft beschreibt; einen Hauptteil, der die definitorische Klärung, die landeskundliche und historische Einführung, die Konfliktbeschreibung und die Analyse der Gründe für das Interventions-Scheitern beinhaltet; und einen Schluss (der Inhalt des Schlusses ist im gegebenen Text nicht detailliert beschrieben).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Ruanda, Genozid, Humanitäre Intervention, Völkermord, Internationale Beziehungen, Vereinte Nationen, interne Faktoren, externe Faktoren, Kolonialismus, Konfliktentwicklung, Scheitern der Intervention.
Wie ist der Hauptteil strukturiert?
Der Hauptteil beginnt mit der Definition von Genozid und humanitärer Intervention. Anschließend folgt eine Darstellung der Landeskunde und Historie Ruandas, bevor der Konflikt selbst detailliert beschrieben wird (Parteien, Entwicklung). Die Analyse des Interventions-Scheiterns unterteilt sich in interne und externe Faktoren, mit jeweils Unterpunkten zur detaillierten Erläuterung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Gründe für das Scheitern der humanitären Intervention in Ruanda 1994. Es soll aufgezeigt werden, welche internen und externen Faktoren zum Völkermord und zum unzureichenden Eingreifen der internationalen Gemeinschaft beigetragen haben.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung fasst die Einleitung (Definition humanitärer Intervention, Kontext des Genozids), den Hauptteil (definitorische Klärung, Landeskunde, Konfliktbeschreibung, Analyse der Interventions-Gründe) und implizit den Schluss zusammen. Die Einleitung betont den Fokus auf interne und externe Faktoren und den Verzicht auf ethische Bewertungen. Der Hauptteil wird als umfassende Analyse der Ursachen des Scheiterns beschrieben.
- Citation du texte
- Sebastian Schoener (Auteur), 2006, Bürgerkrieg und Völkermord in Ruanda - Erklärungen für das Scheitern einer humanitären Intervention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117683