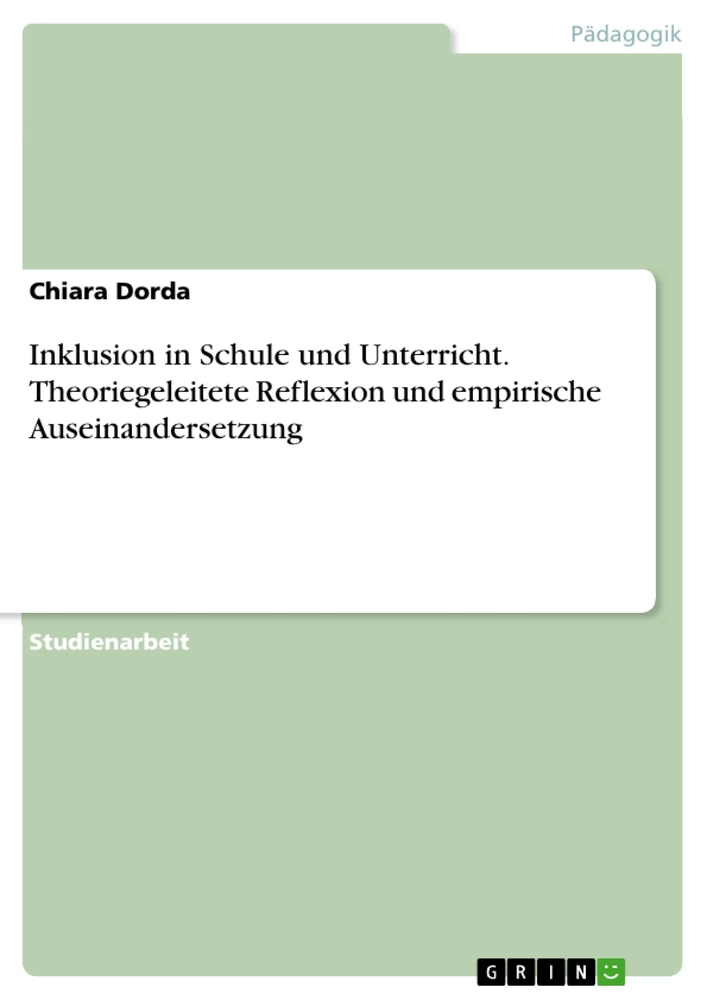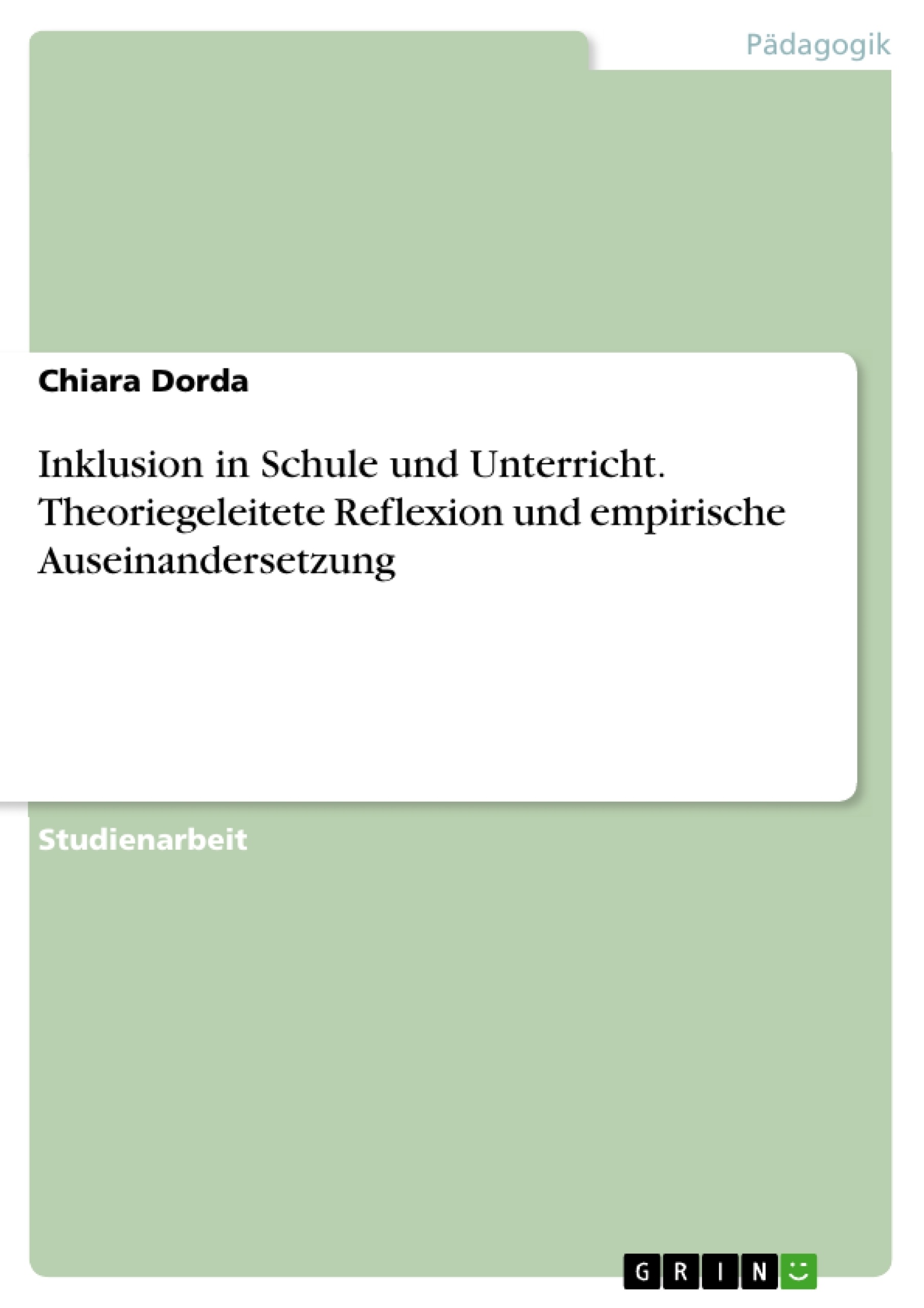In dieser Arbeit erfolgt eine theoriegeleitete Reflexion und empirische Auseinandersetzung mit der Relevanz von Inklusion für Schule und Unterricht. Gerade die praktische Umsetzung von Bildung in Deutschland stellt eine zentrale
Gelenkstelle im Spiel stigmatisierender und defizitärer Merkmalskategorisierungen im dynamischen Strukturverhältnis der Gesellschaft dar. Die Ratifizierung der UN-BRK durch die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2009 als einer der größten Meilensteine in der Inklusionsdebatte verlieh den Rechten von Menschen mit Behinderungen besonders im Hinblick auf soziale Zugänglichkeit und Teilhabe sowie Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit und Selbstbestimmung performativen und zugleich wegweisenden Charakter.
Mit besonderer Bezugnahme auf Artikel 24 wurde das Recht auf Bildung als Menschenrecht und somit als im demokratischen System der BRD einzufordernder Grundsatz der allgemeinen Menschenwürde deklariert. Dies rückt besonders Bildungsinstitutionen wie schulische Einrichtungen in den Fokus der Öffentlichkeit, repräsentieren sie doch potenzielle Ausweitungsmechanismen gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen in allen Fragen sozialer Exklusion und Inklusion und spielen demnach eine tragende Rolle im Kontext biografischer Entscheidungen sowie der (inter-)nationalen Bildungspraxis. Die Reproduktion sozialer Ungleichheiten durch die Institution Schule und des dort aktuell (noch) vorherrschenden, hierarchischen Leistungsprinzips soll durch die Akzeptanz eines transnormalistischen Fähigkeitsspektrums aller Lernenden im Sinne einer inklusiven Unterrichtsgestaltung möglichst eingedämmt und sukzessive verringert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Begründungsfiguren für einen inklusiven Unterricht.
- 2. Seminarbegleitende Reflexionsaufgaben
- 2.1. Inklusion: Begriffsentstehung, Bedeutung und Forschungsdesiderata
- 2.2. Das Leistungsprinzip als Selektionscharakter des deutschen Schulsystems
- 2.3. Inklusive Schulentwicklung
- 2.4. Inklusive Unterrichtsgestaltung
- 3. Fazit und Ausblick.
- 4. Literaturverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio befasst sich mit der Bedeutung von Inklusion für Schule und Unterricht. Es untersucht die Notwendigkeit einer inklusiven Schulentwicklung und Unterrichtsgestaltung, die allen Schülerinnen und Schülern gleiche Chancen und Partizipationsmöglichkeiten bietet, unabhängig von ihrer individuellen Heterogenität. Dabei wird der Fokus auf die Überwindung von strukturellen Asymmetrien und Systemmechanismen gelegt, die zu sozialer Exklusion und Diskriminierung führen.
- Das Leistungsprinzip und seine Auswirkungen auf soziale Ungleichheit
- Die Ratifizierung der UN-BRK und das Recht auf Bildung als Menschenrecht
- Inklusive Unterrichtsgestaltung und die Bedeutung von Differenzierung
- Die Rolle von Bildung im Kontext der sozialen Nachhaltigkeit
- Der Einfluss des Habitus auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch schulische Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Begründungsfiguren für einen inklusiven Unterricht
Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit eines inklusiven Unterrichts, der auf einer egalitären Differenz zwischen allen sozialen Heterogenitätsdimensionen basiert. Es argumentiert, dass die Maximierung der aktiven Teilhabe aller Menschen und die Minimierung von Diskriminierung und sozialer Exklusion von marginalisierten Randgruppen entscheidend für eine nachhaltige gesellschaftliche Transformation hin zu allgemeiner Chancengleichheit und Partizipation sind.2.1. Inklusion: Begriffsentstehung, Bedeutung und Forschungsdesiderata
Dieses Kapitel behandelt den Begriff der Inklusion, seine Entstehung und Bedeutung im Kontext der Schulentwicklung und des Unterrichts. Es werden wichtige Forschungsdesiderata im Bereich der Inklusionsforschung aufgezeigt.2.2. Das Leistungsprinzip als Selektionscharakter des deutschen Schulsystems
Dieses Kapitel analysiert das Leistungsprinzip als Selektionsfaktor im deutschen Schulsystem und seine Auswirkungen auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit. Es untersucht die Rolle von Bildung im Kontext von Habitus und sozialer Stratifizierung.2.3. Inklusive Schulentwicklung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung inklusiver Schulen und den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Es beleuchtet die Bedeutung von inklusiven Schulstrukturen und -prozessen.2.4. Inklusive Unterrichtsgestaltung
Dieses Kapitel erörtert die Gestaltung inklusiven Unterrichts, der auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Schülerinnen und Schüler eingeht. Es untersucht die Rolle von Differenzierung und Individualisierung im inklusiven Unterricht.Schlüsselwörter
Inklusion, Exklusion, Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Partizipation, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Heterogenität, Differenzierung, Leistungsprinzip, Schulentwicklung, Unterrichtsgestaltung, Habitus, soziale Ungleichheit, transnormalistisches Fähigkeitsspektrum, gesellschaftliche Transformationsprozesse, soziale Nachhaltigkeit.- Quote paper
- Chiara Dorda (Author), 2021, Inklusion in Schule und Unterricht. Theoriegeleitete Reflexion und empirische Auseinandersetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181228