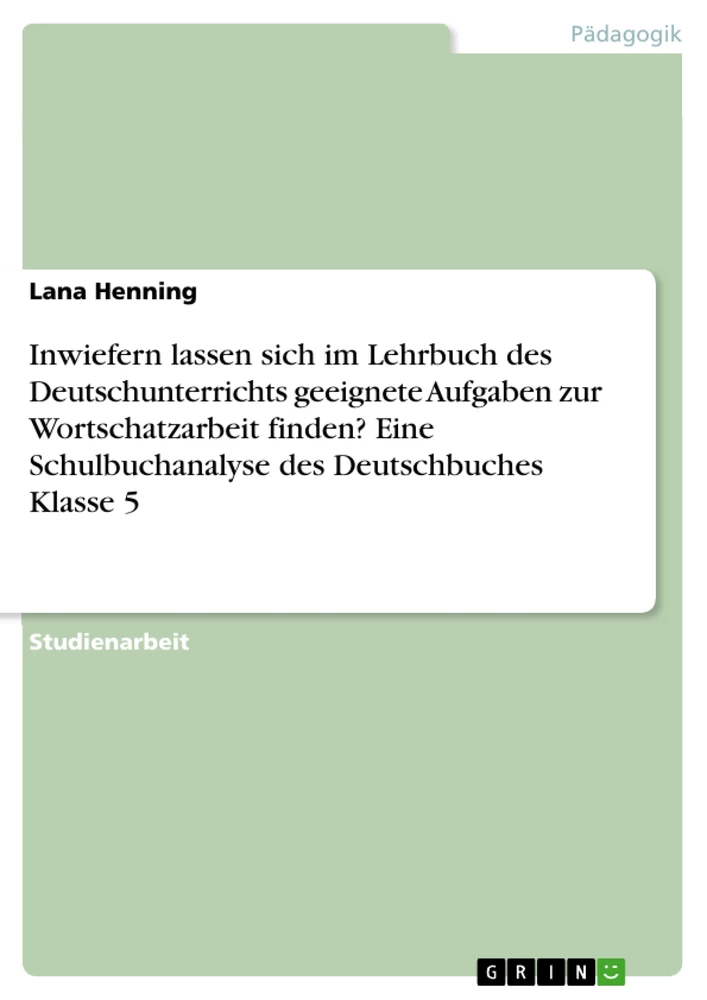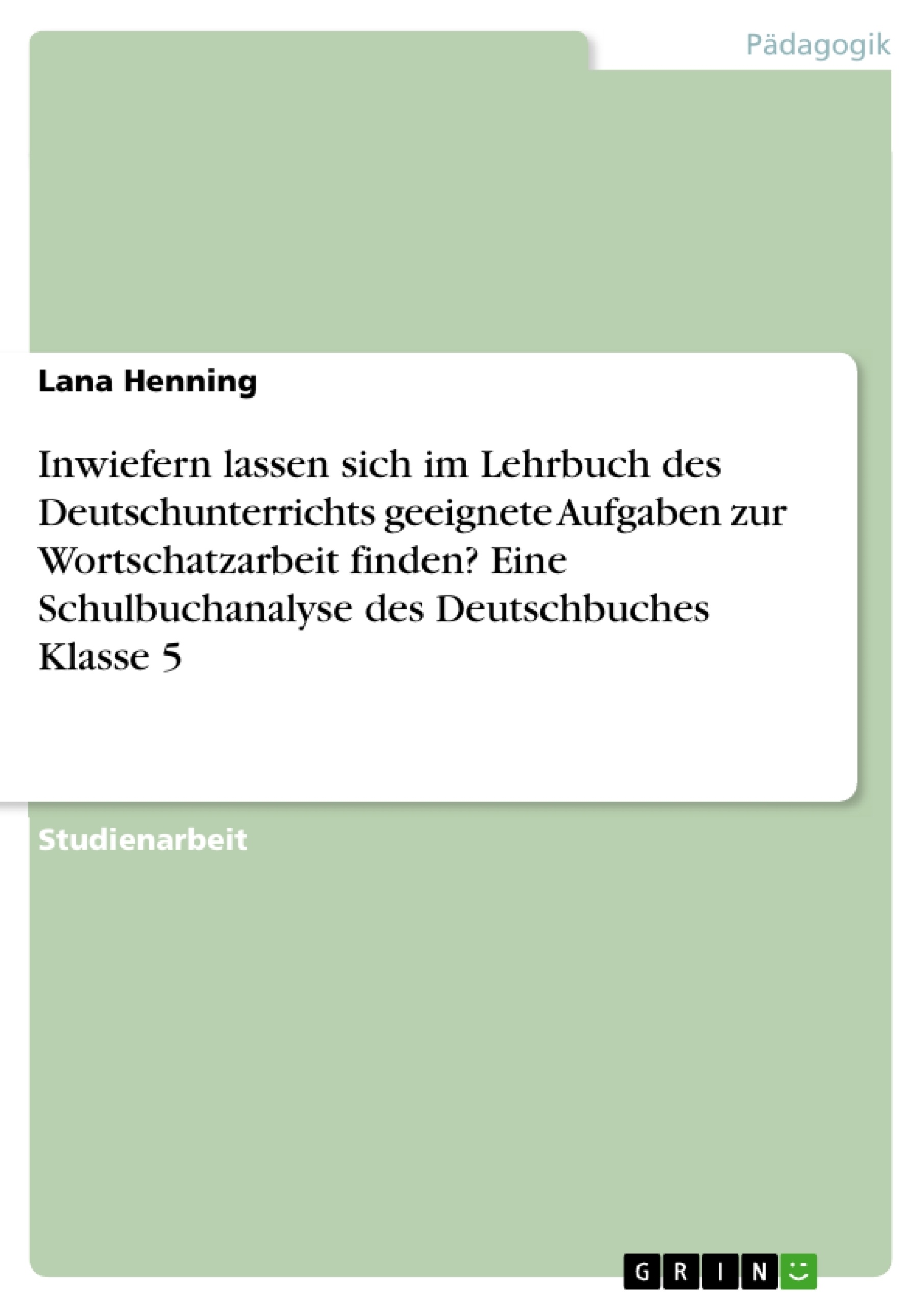Die Ausprägung des Wortschatzes steht in Verbindung mit unterschiedlichen Fähigkeiten eines Menschen. In diesem Kontext beeinflusst der individuelle Wortschatz einer Person deren Möglichkeit der Meinungsäußerung – also ihre Fähigkeit Wünsche, Ziele und Befindlichkeiten zu äußern und zu verstehen. Auch das Hinterfragen von Wirklichkeiten, Argumenten und Ähnlichem gelingt besser, umso treffender die Auswahl der Worte genutzt werden kann. Unbestreitbar kann man dem Wortschatz eine fundamentale Bedeutung zuschreiben und zugleich ist in den Fachanforderungen des Faches Deutsch die Wortschatzarbeit nicht explizit als Kompetenzbereich aufgeführt. An diesem Punkt deutet sich schon die Frage an, ob und in welchem Maße die Wortschatzarbeit in Lehrbüchern des Faches Deutsch angeboten wird.
Diese Hausarbeit soll untersuchen, inwiefern sich in Lehrbüchern des Deutschunterrichts der Klasse 5 geeignete Aufgaben finden lassen, die die Wortschatzarbeit fördern. Hierbei handelt es sich um eine Schulbuchanalyse eines gängigen Deutschlehrbuches der 5. Klasse.
Die dabei angewandte Methodik ist dem Abschnitt der Vorgehensweise (1.2.) zu entnehmen. Nach einem kurzen Forschungsbericht werden im Theorieteil (2.) die dieser Ausarbeitung dienlichen theoretischen Grundlagen der Wortschatzarbeit erläutert.
Im darauffolgenden Analyseteil (3.) wird auf Basis des zuvor statuierten theoretischen Wissens eine an Kriterien orientierte Schulbuchanalyse erfolgen. Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, welche Bedeutung die Wortschatzarbeit in der Theorie besitzt und wie die praktische Umsetzung mithilfe des Deutschbuches erfolgen kann. Letzteres wird durch das Untersuchen von authentischen Schulbuchmaterialien geprüft. Als Produkt sollte diese Arbeit im besten Fall positive Aufgabenexempel hervorbringen und unzureichende Aufgaben, Materialien und Methoden aufdecken. Abschließend werden die Forschungsergebnisse dieser Seminararbeit in einem Fazit konkludiert und ein Ausblick gegeben. In einem letzten Kapitel erfolgt eine Reflexion in visualisierter Darstellung zum Professionswissen aus der Meta-Perspektive einer Lehrperson.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Vorgehensweise
- Wortschatzarbeit in der Schule – Theoretische Grundlagen
- Analyse von Deutschbuch 5
- Wortfelder
- Wortbildung
- Wortschatzarbeit als sekundäres Ziel – die Wortfamilie
- Lautassoziation
- Redewendung
- Fachwortschatz
- Fazit
- Reflexion und Visualisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert ein gängiges Deutschlehrbuch der 5. Klasse, um zu untersuchen, inwieweit es geeignete Aufgaben zur Förderung der Wortschatzarbeit bietet. Die Arbeit betrachtet sowohl die theoretischen Grundlagen der Wortschatzarbeit im Schulunterricht als auch die praktische Umsetzung im konkreten Schulbuchmaterial.
- Bedeutung des Wortschatzes für sprachliche Kompetenzen
- Theoretische Ansätze zur Wortschatzarbeit
- Analyse der Wortschatzarbeit im Deutschbuch 5
- Identifizierung von Stärken und Schwächen im Schulbuch
- Reflexion der Ergebnisse aus Sicht einer Lehrperson
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie die Bedeutung des Wortschatzes für sprachliche Kompetenzen beleuchtet und die Forschungsfrage formuliert. Der Forschungsstand liefert einen Überblick über relevante Literatur zum Thema Wortschatzarbeit. Die Vorgehensweise erläutert die Methodik der Schulbuchanalyse. Im Theorieteil werden die theoretischen Grundlagen der Wortschatzarbeit im Schulunterricht dargelegt.
Der Analyseteil befasst sich mit der konkreten Untersuchung des Deutschbuches 5. Die einzelnen Kapitel analysieren verschiedene Aspekte der Wortschatzarbeit, wie zum Beispiel Wortfelder, Wortbildung und Redewendungen. Der Fokus liegt dabei auf der Identifizierung von Stärken und Schwächen in Bezug auf die Förderung der Wortschatzarbeit.
Schlüsselwörter
Wortschatzarbeit, Deutschunterricht, Schulbuchanalyse, Lehrbuch, Deutschbuch 5, Sekundarstufe 1, Wortschatzerwerb, Wortbildung, Wortfelder, Redewendungen, Fachwortschatz, Sprachkompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat Wortschatzarbeit im Deutschunterricht?
Ein fundierter Wortschatz ist die Basis für Meinungsäußerung, das Verständnis von Wünschen und das kritische Hinterfragen der Wirklichkeit.
Ist Wortschatzarbeit als eigener Kompetenzbereich gelistet?
Interessanterweise ist sie in vielen Fachanforderungen nicht explizit als eigener Bereich aufgeführt, obwohl sie eine fundamentale Bedeutung besitzt.
Was untersucht die Analyse des „Deutschbuch 5“?
Die Arbeit prüft, inwieweit Aufgaben zu Wortfeldern, Wortbildung, Redewendungen und Fachwortschatz im Lehrbuch vorhanden und geeignet sind.
Welche Methoden zur Wortschatzförderung werden im Buch genutzt?
Analysiert werden unter anderem Lautassoziationen, die Arbeit mit Wortfamilien und die Vermittlung von Fachwortschatz.
Was ist das Ziel dieser Schulbuchanalyse?
Herauszufinden, wie die theoretische Bedeutung der Wortschatzarbeit praktisch im Unterrichtsmaterial umgesetzt wird, und positive Beispiele sowie Mängel aufzudecken.
- Quote paper
- Lana Henning (Author), 2021, Inwiefern lassen sich im Lehrbuch des Deutschunterrichts geeignete Aufgaben zur Wortschatzarbeit finden? Eine Schulbuchanalyse des Deutschbuches Klasse 5, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184102