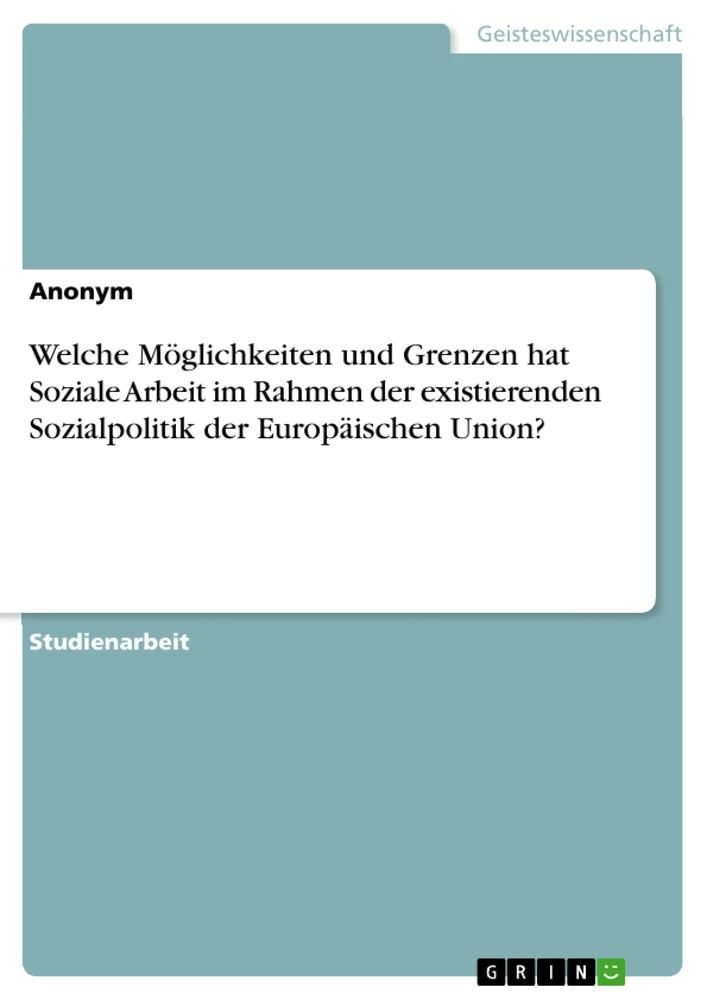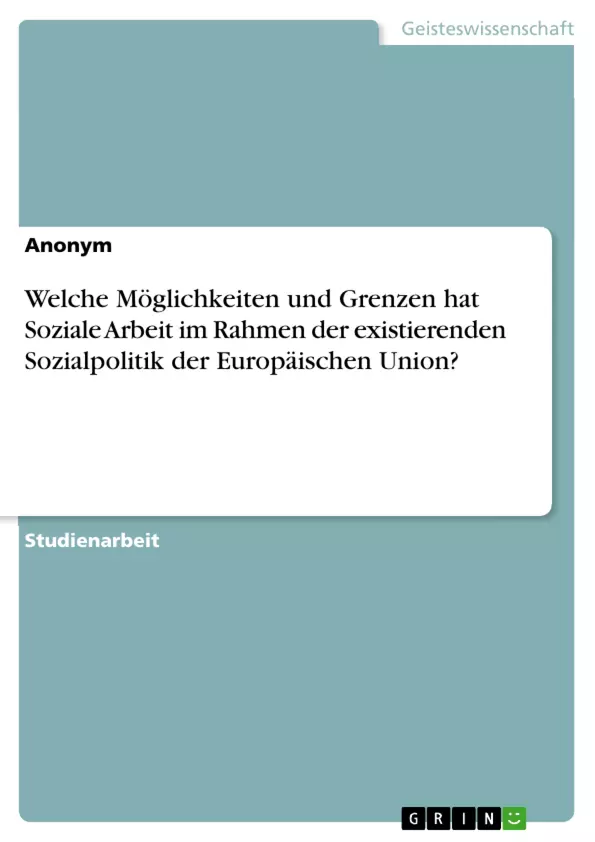Sozialleistungen in Europa sind in hohem Maße heterogen. Anspruchs- und Leistungsunterscheidungen und Gerechtigkeitskonzeptionen folgen sehr unterschiedlichen Logiken. Dies ist der historischen Entwicklung der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union (EU) geschuldet. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales beziehen die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten sich auf das jeweilige staatliche Territorium. Ansprüche auf Sozialleistungen beruhen auf nationalen Gesetzen und sind zugeschnitten auf die Lebensverhältnisse in einem bestimmten Gebiet. Sie berücksichtigen in der Regel keine Tatbestände, die auf anderen Staatsgebieten eingetreten sind.
In diesem Beitrag werden wesentliche Aspekte der Herausforderungen an Soziale Arbeit unter den Rahmenbedingungen nationalstaatlicher und europäischer Sozialpolitik aufgezeigt. Im ersten Teil wird nach einer kurzen Abhandlung zur Sozialpolitik in Deutschland und der EU im Allgemeinen detaillierter auf die europäische Dimension von Sozialpolitik, die soziale Dimension des europäischen Binnenmarktes und die Grundrechtecharta der EU eingegangen werden. Nach der Analyse der sozialpolitisch gestalteten Rahmenbedingungen der EU wendet sich Teil II der Sozialen Arbeit zu. Eine kurze Hinführung zur grundlegenden Thematik der Sozialen Arbeit folgt eine Darlegung der Positionierung und Entwicklung von Wissenschaft und Profession Sozialer Arbeit aus nationalstaatlichem und europäischem Blickwinkel. Ausgestattet mit den Perspektiven auf europäische Sozialpolitik und europäische Soziale Arbeit können weitere spezifische Herausforderungen für die Soziale Arbeit in den Blick genommen werden.
Als wichtig erachtet werden in diesem Beitrag die Auseinandersetzung mit normensetzenden Menschrechten, Normierungen von Migration, Inklusion und Sprache und die Erweiterung des professionellen Blickwinkels auf eine transnationale Perspektive. Abschließend soll hier auf das Risiko der Prekarisierung der Sozialen Arbeit und die Dominanz ökonomischer Logiken unter den Rahmenbedingungen der Projektfinanzierungen durch den Europäischen Sozialfond (ESF) eingegangen werden. Im dritten Teil werden alle darlegten Wissensbestände zusammengetragen, analytisch beurteilt und mit Handlungsaspekten für die Soziale Arbeit ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I
- Sozialpolitik in Deutschland und der Europäischen Union
- Was ist Sozialpolitik?
- Die europäische Dimension von Sozialpolitik
- Die soziale Dimension des EU-Binnenmarktes
- Grundrechtecharta der Europäischen Union (2000)
- Teil II
- Soziale Arbeit in Deutschland und der Europäischen Union
- Was ist Soziale Arbeit?
- (Deutsche) Soziale Arbeit in der Europäischen Union oder Europäische Soziale Arbeit?
- Möglichkeiten und Grenzen Sozialer Arbeit in Deutschland im Rahmen Europäischer Sozialpolitik
- Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession
- Migration und nationale Inklusion
- Transnationalität und Soziale Arbeit
- Sprachkompetenzen und Sprachbarrieren
- Soziale Arbeit und der ESF
- Teil III
- Zusammenfassung, Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag beleuchtet die Herausforderungen für Soziale Arbeit im Kontext der nationalen und europäischen Sozialpolitik. Er analysiert die Rahmenbedingungen der EU-Sozialpolitik und untersucht die Positionierung und Entwicklung der Sozialen Arbeit aus nationalstaatlicher und europäischer Perspektive.
- Die europäische Dimension von Sozialpolitik und die soziale Dimension des EU-Binnenmarktes
- Die Grundrechtecharta der Europäischen Union und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit in Deutschland im Rahmen der europäischen Sozialpolitik
- Die Rolle von Migration, Inklusion und Sprache in der Sozialen Arbeit
- Das Risiko der Prekarisierung der Sozialen Arbeit und die Dominanz ökonomischer Logiken im Kontext von Projektfinanzierungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Heterogenität von Sozialleistungen in Europa und die Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Kontext der nationalen und europäischen Sozialpolitik.
Teil I behandelt die deutsche und europäische Sozialpolitik. Dabei werden die Leitideen der Sozialpolitik, die europäische Dimension von Sozialpolitik, die soziale Dimension des EU-Binnenmarktes und die Grundrechtecharta der EU analysiert.
Teil II widmet sich der Sozialen Arbeit in Deutschland und der Europäischen Union. Hier werden die grundlegenden Aspekte der Sozialen Arbeit, die Positionierung und Entwicklung von Wissenschaft und Profession aus nationalstaatlicher und europäischer Perspektive betrachtet. Zudem werden spezifische Herausforderungen für die Soziale Arbeit in den Blick genommen, wie z.B. die Auseinandersetzung mit Menschenrechten, Migration, Inklusion und Sprache sowie die Erweiterung des professionellen Blickwinkels auf eine transnationale Perspektive.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Sozialpolitik, Europäische Union, Grundrechtecharta, Menschenrechte, Migration, Inklusion, Sprache, Transnationalität, Prekarisierung, ESF
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat die EU-Sozialpolitik auf die Soziale Arbeit in Deutschland?
Die Arbeit analysiert, wie europäische Rahmenbedingungen und Richtlinien (z.B. der ESF) die Handlungsmöglichkeiten und Finanzierungen der Sozialen Arbeit vor Ort prägen.
Was ist der Europäische Sozialfonds (ESF)?
Der ESF ist das wichtigste Finanzierungsinstrument der EU für soziale Projekte, birgt aber auch das Risiko einer Dominanz ökonomischer Logiken in der Sozialen Arbeit.
Warum ist eine transnationale Perspektive in der Sozialen Arbeit wichtig?
Durch Migration und den EU-Binnenmarkt enden soziale Probleme nicht an Staatsgrenzen, weshalb Fachkräfte grenzüberschreitende Kompetenzen benötigen.
Was bedeutet „Prekarisierung der Sozialen Arbeit“?
Es beschreibt das Risiko, dass durch projektbezogene Finanzierungen und ökonomischen Druck die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte und die Qualität der Hilfe leiden.
Welche Rolle spielt die EU-Grundrechtecharta für Sozialarbeiter?
Sie dient als normativer Rahmen für die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, um Inklusion und Gerechtigkeit auf europäischer Ebene einzufordern.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Welche Möglichkeiten und Grenzen hat Soziale Arbeit im Rahmen der existierenden Sozialpolitik der Europäischen Union?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184135