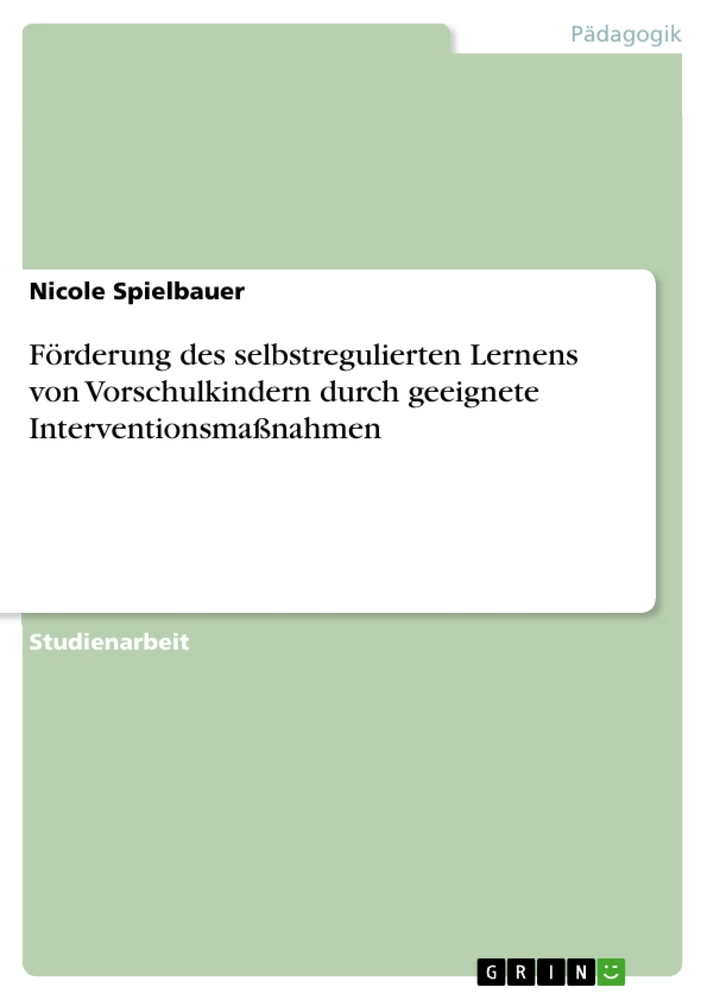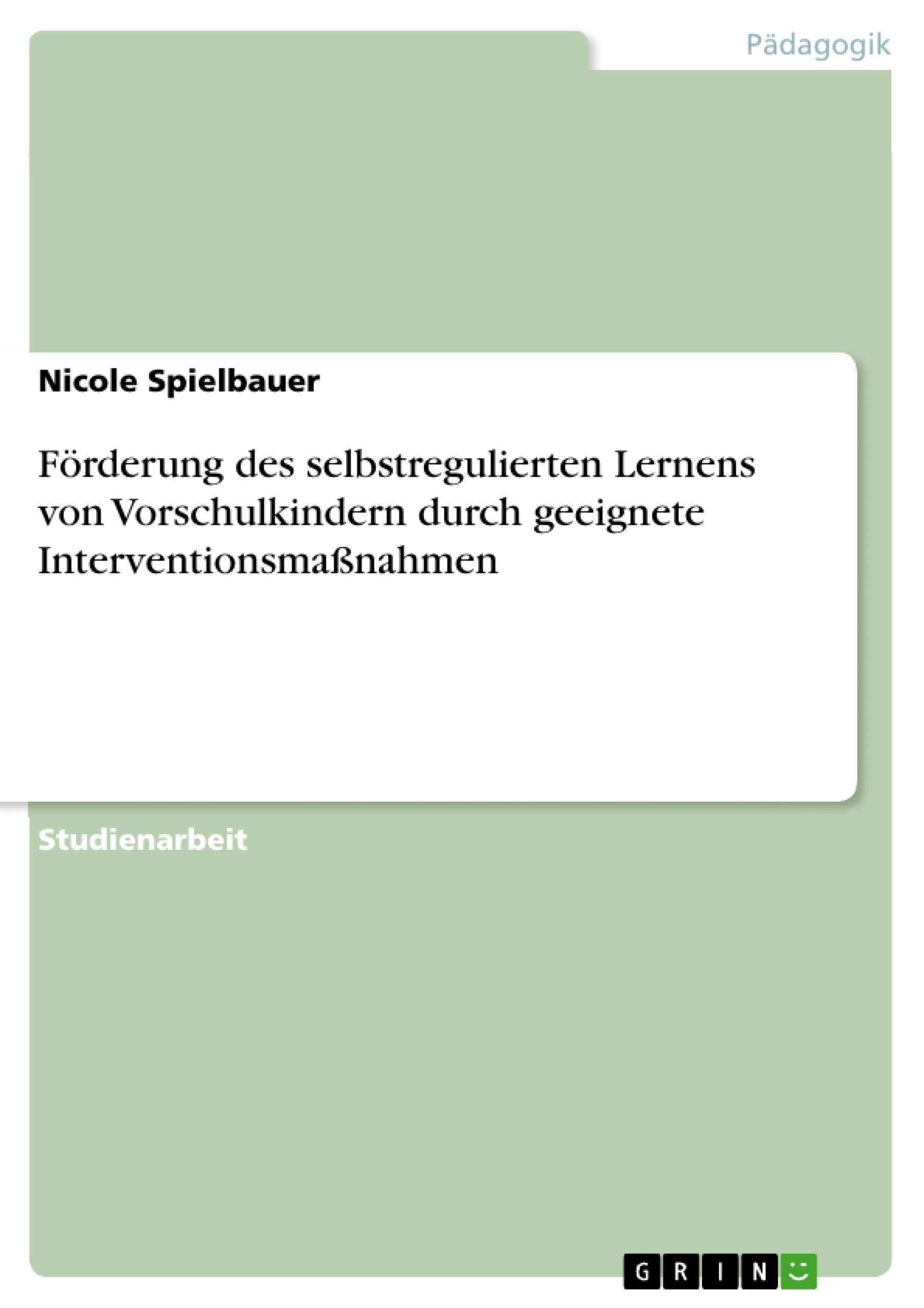Wie kann selbstreguliertes Lernen bei Vorschulkindern durch geeignete Interventionsmaßnahmen gefördert werden? Ziel dieser Hausarbeit ist es, durch Erkenntnisse aus aktuellen Studien zur Förderung von selbstreguliertem Lernen bei Vorschulkindern, Implikationen für Interventionsmaßnahmen abzuleiten.
Die heutige Gesellschaft hat sich zu einer Wissensgesellschaft gewandelt, in welchem lebenslangen Lernen immer mehr an Bedeutung gewinnt. In diesem Zusammenhang ist die frühzeitige Förderung des selbstgesteuerten Lernens in den Fokus der pädagogischen Forschung geraten, da sie als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen hervorgehoben wurde.
In Deutschland treten Kinder in der Regel mit 3 Jahren in den Kindergarten ein, ehe sie mit 6 Jahren eingeschult werden. Die Aufgabe der deutschen Vorschule ist es, Kinder auf den Übergang in die Grundschule vorzubereiten, jedoch gibt es keinen standardisierten Lehrplan für Vorschulkinder. Allerdings scheinen vor allem junge Kinder von einer frühzeitigen Förderung selbstregulierten Lernens in dieser sensiblen Entwicklungsphase zu profitieren, da ihr Lernverhalten noch formbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstreguliertes Lernen im Vorschulalter
- Begriffserklärung
- Das sozial-kognitive Prozessmodell nach Zimmermann (2000)
- Voraussetzungen für selbstreguliertes Lernen im Vorschulalter
- Förderung des selbstregulierten Lernverhaltens bei Vorschulkindern
- Erkenntnisse zur Förderung des selbstregulierten Lernens
- Implikationen für eine Intervention zum selbstregulierten Lernen
- Kombination von direkten und indirekten Interventionen
- Besondere Eigenschaften der Intervention für Vorschulkinder
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung von selbstreguliertem Lernen bei Vorschulkindern durch geeignete Interventionsmaßnahmen. Sie befasst sich mit der Frage, wie selbstreguliertes Lernen im Vorschulalter gefördert werden kann. Die Arbeit analysiert aktuelle Studien und leitet daraus Implikationen für Interventionsmaßnahmen ab.
- Begriffserklärung und Abgrenzung von selbstreguliertem Lernen und allgemeiner Selbstregulationsfähigkeit
- Das sozial-kognitive Prozessmodell von Zimmermann (2000) und dessen Bedeutung für die Förderung von selbstreguliertem Lernen
- Entwicklungspsychologische Voraussetzungen für selbstreguliertes Lernen im Vorschulalter
- Aktuelle Interventionsstudien zur Förderung von selbstreguliertem Lernen bei Vorschulkindern
- Implikationen für die Förderung von selbstreguliertem Lernen bei Kindern im Vorschulalter
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel zwei beleuchtet den theoretischen Hintergrund des selbstregulierten Lernens. Zunächst wird der Begriff des selbstregulierten Lernens definiert und von der allgemeinen Selbstregulationsfähigkeit abgegrenzt. Anschließend wird das sozial-kognitive Prozessmodell nach Zimmermann (2000) vorgestellt, das die dynamischen Prozesse der Selbstregulation im Lernprozess beschreibt. Kapitel drei widmet sich der Förderung von selbstreguliertem Lernen bei Vorschulkindern. Es werden verschiedene Arten von Interventionen erläutert und aktuelle Interventionsstudien vorgestellt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Implikationen für die Förderung von selbstreguliertem Lernen bei Kindern im Vorschulalter abgeleitet.
Schlüsselwörter
Selbstreguliertes Lernen, Vorschulalter, Interventionsmaßnahmen, sozial-kognitive Prozessmodell, Metakognition, Motivation, Lernverhalten, Entwicklungspsychologie, pädagogische Forschung
Häufig gestellte Fragen
Was ist selbstreguliertes Lernen bei Vorschulkindern?
Selbstreguliertes Lernen beschreibt die Fähigkeit von Kindern, ihre eigenen Lernprozesse durch den Einsatz von Metakognition, Motivation und Verhaltensstrategien aktiv zu steuern.
Warum ist die Förderung im Vorschulalter so wichtig?
In dieser sensiblen Entwicklungsphase ist das Lernverhalten noch sehr formbar. Eine frühzeitige Förderung legt den Grundstein für lebenslanges Lernen und erleichtert den Übergang in die Grundschule.
Was besagt das Prozessmodell nach Zimmermann?
Zimmermanns Modell unterteilt den Lernprozess in drei Phasen: Vorausplanung, Durchführung (volitionale Kontrolle) und Selbstreflexion, die zyklisch ineinandergreifen.
Wie können pädagogische Fachkräfte dieses Lernen fördern?
Durch eine Kombination aus direkten Instruktionen (Vermittlung von Strategien) und indirekten Maßnahmen (Gestaltung einer lernförderlichen Umgebung und Autonomieunterstützung).
Welche Rolle spielen Metakognition und Motivation?
Metakognition hilft dem Kind, das eigene Denken zu überwachen, während Motivation den Antrieb liefert, Herausforderungen anzunehmen und bei Schwierigkeiten dranzubleiben.
Gibt es einen Standardlehrplan für die Vorschule in Deutschland?
Nein, es gibt keinen bundesweit standardisierten Lehrplan für Vorschulkinder, weshalb individuelle Interventionsmaßnahmen und Konzepte der Einrichtungen besonders wichtig sind.
- Quote paper
- Nicole Spielbauer (Author), 2021, Förderung des selbstregulierten Lernens von Vorschulkindern durch geeignete Interventionsmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1185142