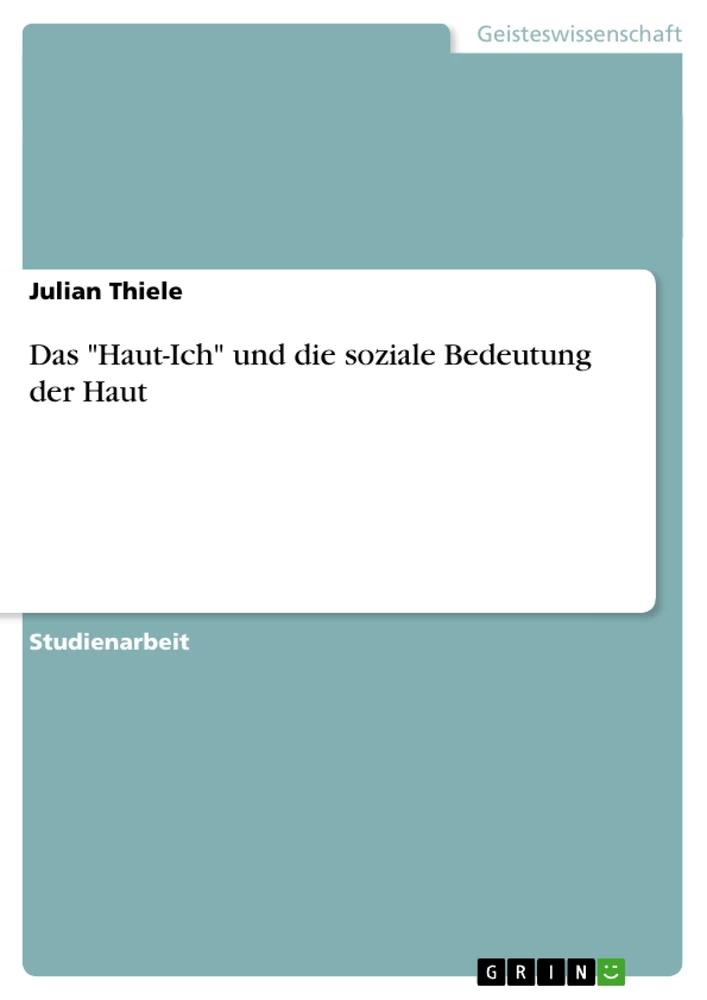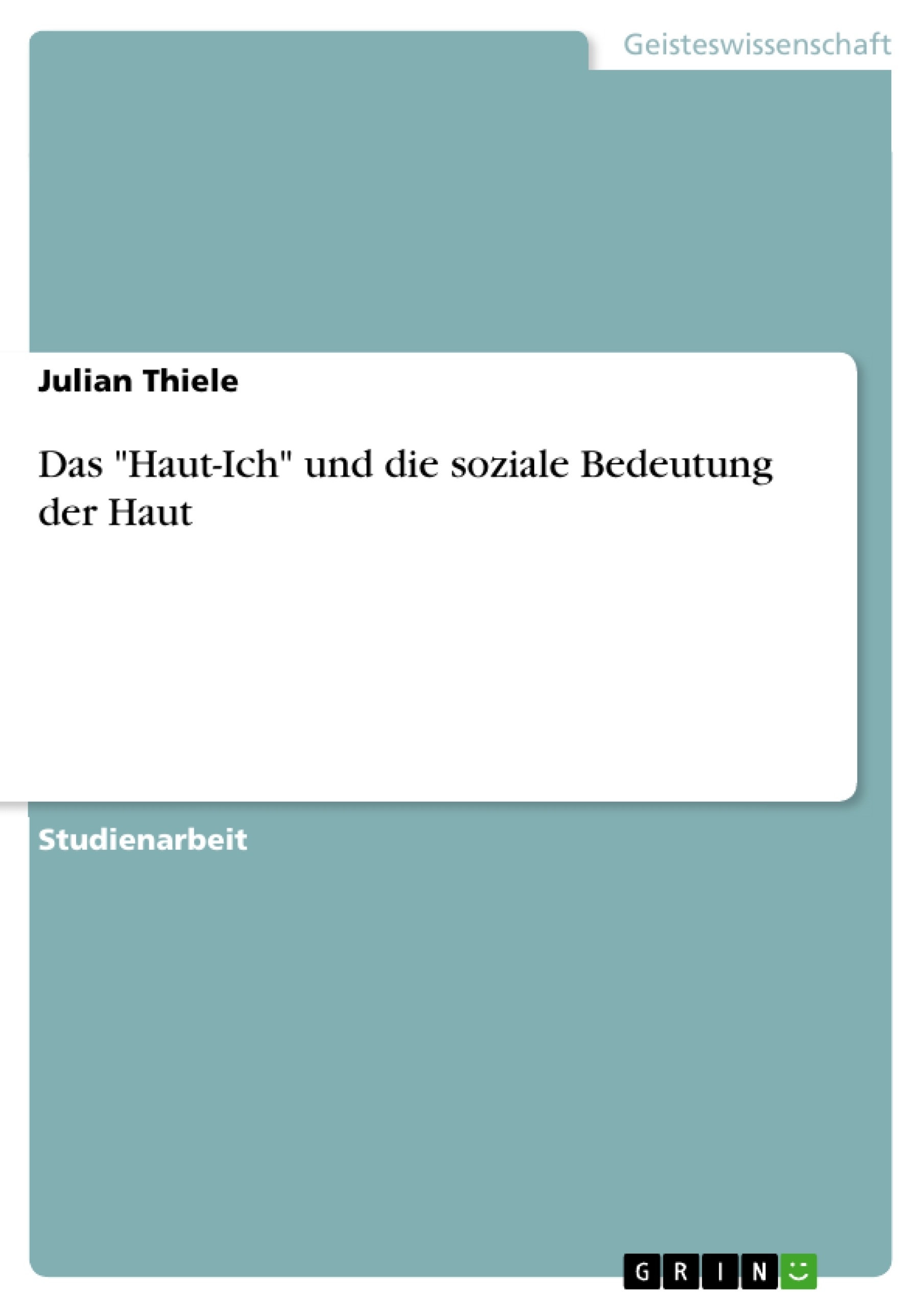[...] Aus diesem Sprachgebrauch
geht hervor, dass sie als Synonym bzw. Metapher der Individualität steht. Besonders in Bezug auf
das eigene Wohlempfinden werden Redewendungen gebraucht, die sich auf unsere äußere Hülle
beziehen, wie etwa, „sich nicht wohl in seiner Haut fühlen“, es geht ihm „unter die Haut“, oder
„nicht aus seiner Haut können“. So ist die Haut als äußere Hülle im Vergleich zu unseren inneren
Organen sichtbar offen und bezieht sich über den Hautbegriff auf unsere innersten Zustände. Mythen, wie der des enthäuteten Marsyas, verleihen der Haut die Eigenschaft einer Schutzhülle. In
der Kunstgeschichte wird das Enthäuten denn auch als Machtvollzug gedeutet. Der Enthäutete kann
ohne seine schützende Hülle nicht weiterleben. Gleichzeitig steht das Enthäuten für einen
Neubeginn, da durch das Abziehen der alten Haut etwas Neues gedeihen kann und es somit einen
metamorphorischen Charakter annimmt. Die Haut steht in dieser Hinsicht sowohl für den Verlust
des Selbst als auch für dessen Gewinn. Auch in den Legenden des „Achill“ und des „Siegfried“ wird der Haut eine schützende Funktion
zugewiesen. Ihre „Panzerhaut“ macht sie beinahe unverletzlich respektive göttlich und verleiht
ihnen übermenschliche Kräfte.
Diese Beispiele aus der Literatur- und Kunstgeschichte zeigen, wie weitreichend das Thema der
Haut behandelt wird. In der folgenden Arbeit setze ich die genannten Mythen bzw.
Literaturgeschichte um die Haut voraus, um mein Hauptaugenmerk auf die von Didier Anzieu
vollzogene Beschreibung des „Haut-Ichs“ zu legen. Daraus leitet sich die These dieser Arbeit ab,
„welche soziale Bedeutung die Haut in unserer Gesellschaft einnimmt“. Um der Aufarbeitung
dieser These gerecht zu werden, gebe ich zuerst einen physiologischen Überblick über den Aufbau
der Haut. Hieraus soll ersichtlich werden, welche Bedeutung die Haut für den Körper, aber eben
auch für die Psyche einnimmt. So bezeichnet Uwe Gieler „die Haut als Spiegel der Pyche1“ Aus
den psychischen Funktionen der Haut heraus erklärt sich die These Anzieus eines Haut-Ichs. Im
Anschluss daran werde ich die Wichtigkeit von Berührungen für den Menschen und die soziale
Funktion der Haut erörtern, ehe abschließend ein zusammenfassender Kommentar zu diesem
Thema erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Physiologische Funktion der Haut
- Aufbau der Haut
- Psychologische Funktion der Haut
- Das Haut-Ich
- Berührung
- Soziale Funktion der Haut
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die soziale Bedeutung der Haut in unserer Gesellschaft. Sie analysiert die physiologischen und psychologischen Funktionen der Haut und beleuchtet insbesondere das Konzept des "Haut-Ichs" nach Didier Anzieu. Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Berührungen und der Rolle der Haut als soziales Kommunikationsorgan.
- Physiologische Funktionen der Haut
- Psychologische Funktionen der Haut
- Das Haut-Ich als Konzept der Selbstwahrnehmung
- Die soziale Bedeutung von Berührungen
- Die Haut als Kommunikationsorgan
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Haut" in unserer Gesellschaft dar und führt in die Thematik ein. Das Kapitel "Physiologische Funktion der Haut" gibt einen Überblick über den Aufbau und die Funktionen der Haut als Organ. Das Kapitel "Psychologische Funktion der Haut" untersucht die Bedeutung der Haut für die Psyche. Das Kapitel "Das Haut-Ich" erläutert das Konzept des "Haut-Ichs" nach Didier Anzieu und seine Bedeutung für die Selbstwahrnehmung. Das Kapitel "Berührung" untersucht die Bedeutung von Berührungen für den Menschen und die soziale Funktion der Haut.
Schlüsselwörter
Haut, Haut-Ich, Didier Anzieu, Physiologie, Psychologie, Berührung, Soziale Funktion, Selbstwahrnehmung, Kommunikation
- Quote paper
- Julian Thiele (Author), 2008, Das "Haut-Ich" und die soziale Bedeutung der Haut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118605