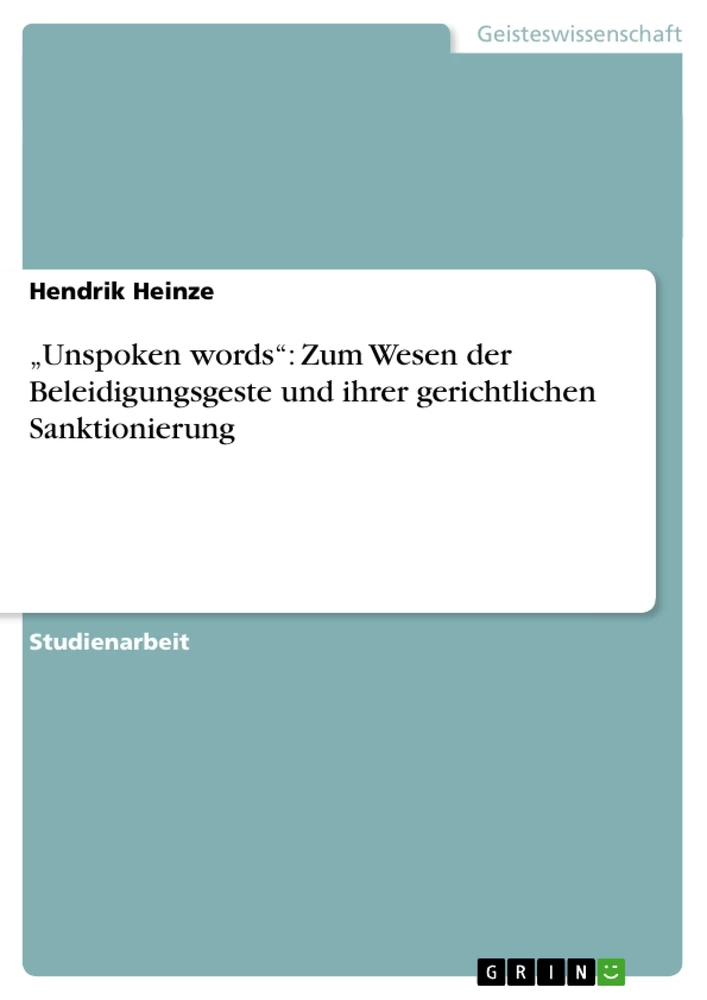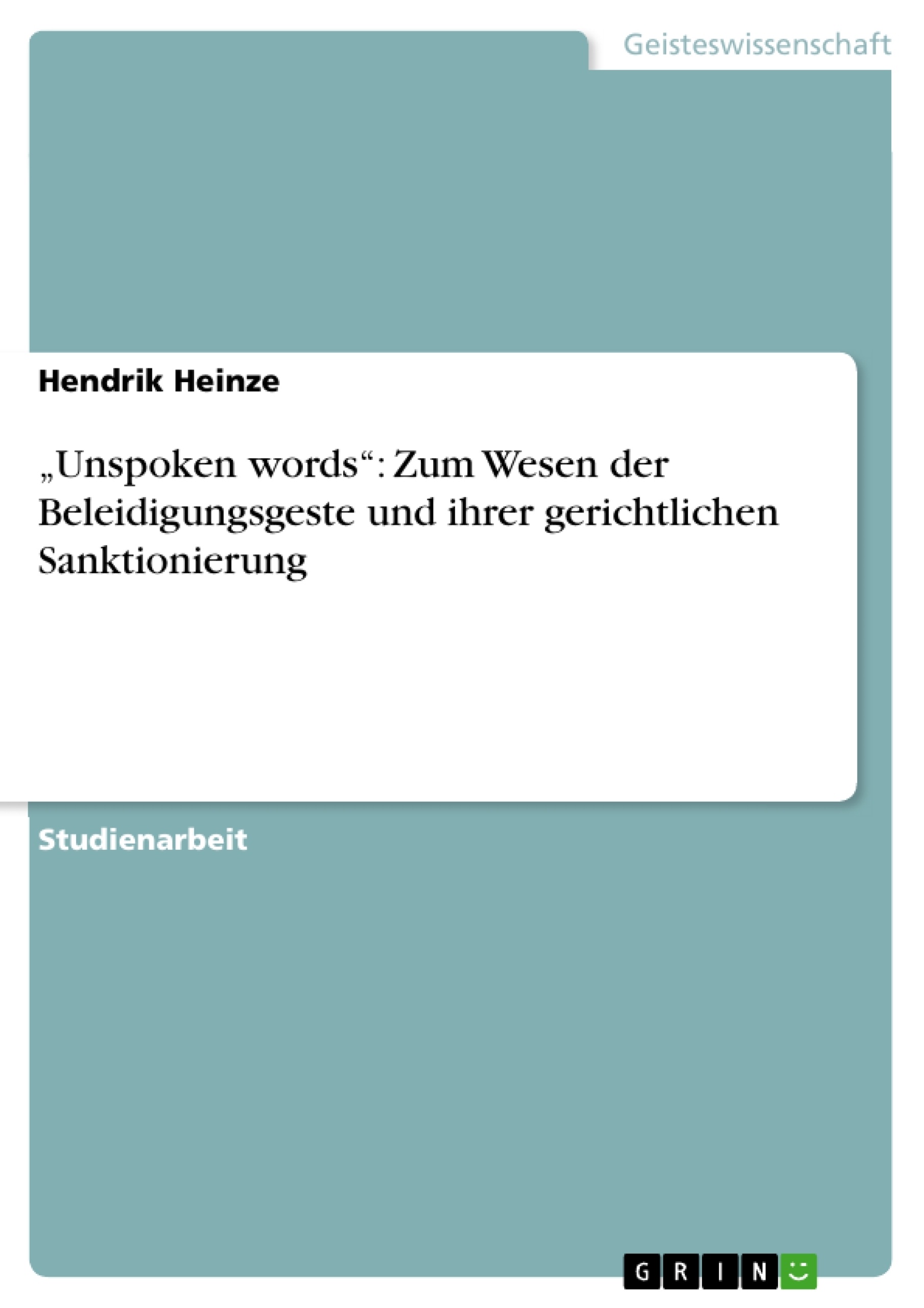Ein zeitloser, anschaulich geschriebener Überblick über die beleidigende Kraft von Gesten und über die Strafen, die Gerichte für die wortlosen Beleidigungen verhängen. In dieser Form bis heute einzigartig.
Bereits Shakespeare wusste um die beleidigende Kraft von Gesten. In der ersten Szene der Tragödie Romeo und Julia lässt Shakespeare die Diener der verfeindeten Häuser Capulet und Montague aufeinandertreffen. Sampson aus dem Hause Capulet versucht die Bediensteten der Montague zu provozieren, indem er sich, Abraham vom Hause Montague zugewandt, auf den Daumen beisst. Die Übersetzung von Wieland behält diese Geste bei, mit der der verächtliche Biss in den Penis des Gegenübers symbolisiert wird. Der große Dichter war nicht nur ein Meister der Worte, sondern auch der wortlosen Kommunikation.
Konventionalisierte Beleidigungsgesten sind kein Kind unserer Tage. Vielmehr ist zu vermuten, dass jede Kultur zu jeder Zeit über ein Repertoire konventionalisierter Gesten verfügte, mit denen Missachtung oder Nichtachtung ausgedrückt werden konnte. Heute informieren Reiseführer und Ratgeber zur interkulturellen Kommunikation ausführlich, wie die Hände im Gastland tunlichst nicht bewegt werden sollten.
In Deutschland kann die gestische Beleidigung – abgesehen von den sonstigen zwischenmenschlichen Verstimmungen – sogar nach den Maßgaben des Gesetzes bestraft werden. Die meisten Beleidigungen gelangen den Gerichten dabei aus dem Straßenverkehr zur Kenntnis. Meist sind das die Klassiker „Stinkefinger“ und „Vogel“. Die diesbezügliche Rechtsprechung ist wesentliche Quelle dieser Arbeit.
Teil II befasst sich mit den theoretischen Grundlagen dieser Rechtsprechung. Einer juristischen Definition der Beleidigung ist Abschnitt 2.1 gewidmet. Dort wird auch auf die möglichen Formen gestischer Beleidigung, die Frage nach der Intention des Kundgebenden und den sonstigen Voraussetzungen für das Zustandekommen einer Beleidigung im Sinne des Strafgesetzbuchs eingegangen. Abschnitt 2.2 versucht sich an einer für unsere Zwecke hilfreichen Definition der Geste. Abschnitt 2.3 diskutiert sprechakttheoretische Erwägungen zum Handeln durch den Gebrauch von Äußerungen.
Teil III befasst sich genauer mit dem Wesen der Beleidigungsgeste und stellt die geläufigsten Gesten vor. Teil IV beleuchtet ausführlich die gerichtliche Sanktionierung anhand ausgewählter Urteile. Im Fazit in Teil V werden die erlangten Erkenntnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Was ist eine Beleidigung?
- Was ist eine Geste?
- Sprechakttheoretische Erwägungen: How to do things with gestures?
- Zum Wesen der Beleidigungsgeste
- Zugewandtheit und Unmittelbarkeit
- „Alpha! Ehrenmann! Sonnengott!“: Zur Konventionalität von Beleidigungsgesten
- Die Beleidigung der Feiglinge: Zur Ambiguität der Ansprache
- Gerichtliche Sanktionierung von Beleidigungsgesten
- Rechtliche Grundlagen: Antragsdelikt und Rechtswirklichkeit
- Fälle und Urteile
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Wesen der Beleidigungsgeste und ihrer gerichtlichen Sanktionierung. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen des Begriffs der Beleidigung, definiert das Konzept der Geste und untersucht die sprechakttheoretischen Aspekte des Handelns durch den Gebrauch von Gesten. Darüber hinaus werden die konventionalisierten Beleidigungsgesten sowie die Ambiguität der Ansprache in Bezug auf Beleidigungsgesten beleuchtet. Die Arbeit betrachtet auch die rechtlichen Grundlagen der Sanktionierung von Beleidigungsgesten und analysiert ausgewählte Urteile, die sich mit gestischen Beleidigungen im Straßenverkehr befassen.
- Definition und theoretische Grundlagen der Beleidigung
- Konzept der Geste und deren sprechakttheoretische Aspekte
- Konventionalisierte Beleidigungsgesten und ihre Ambiguität
- Rechtliche Grundlagen der Sanktionierung von Beleidigungsgesten
- Analyse von Urteilen zu gestischen Beleidigungen im Straßenverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Beleidigungsgeste ein und zeigt anhand eines Beispiels aus Shakespeares Romeo und Julia die historische Bedeutung von konventionalisierten Beleidigungsgesten auf. Teil II beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Beleidigung, definiert den Begriff der Geste und betrachtet sprechakttheoretische Aspekte des Handelns durch den Gebrauch von Gesten. Teil III befasst sich mit dem Wesen der Beleidigungsgeste, analysiert die Zugewandtheit und Unmittelbarkeit von Gesten und beleuchtet die Konventionalität sowie die Ambiguität von Beleidigungsgesten. Teil IV untersucht die gerichtliche Sanktionierung von Beleidigungsgesten anhand von ausgewählten Urteilen, wobei die rechtlichen Grundlagen sowie konkrete Fälle und Urteile zu verschiedenen Gesten im Straßenverkehr beleuchtet werden. Die Zusammenfassung in Teil V fasst die erlangten Erkenntnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Beleidigung, Geste, Sprechakttheorie, Konventionalität, Ambiguität, Gerichtliche Sanktionierung, Straßenverkehr, Stinkefinger, Vogel, Rechtsprechung, Antragsdelikt, Rechtswirklichkeit.
- Quote paper
- Diplom-Kulturwissenschaftler Hendrik Heinze (Author), 2005, „Unspoken words“: Zum Wesen der Beleidigungsgeste und ihrer gerichtlichen Sanktionierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118695