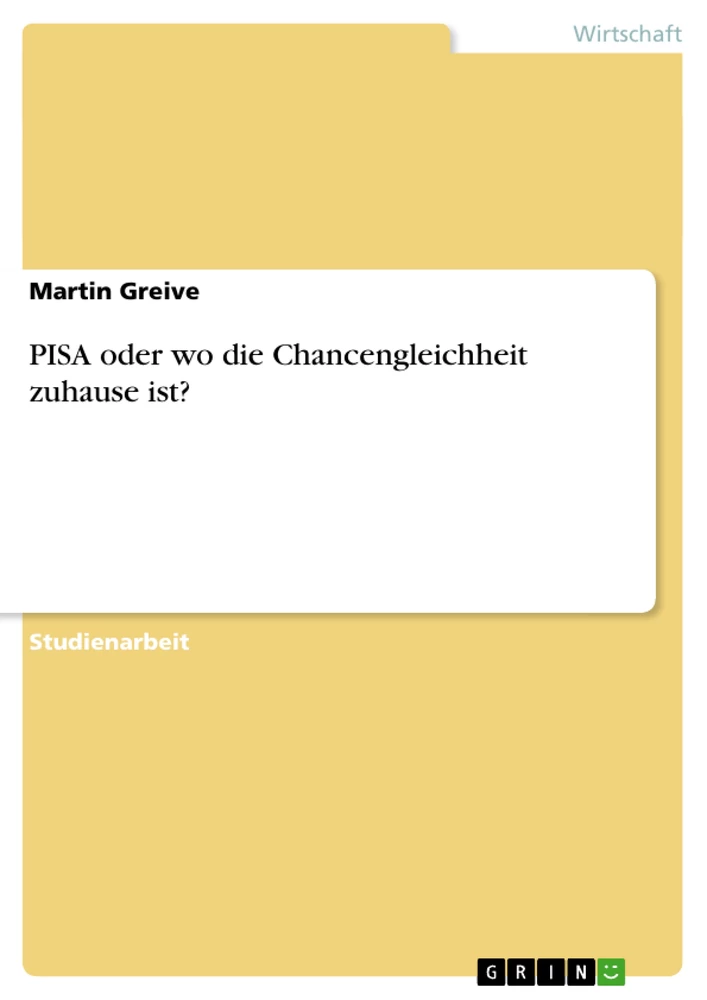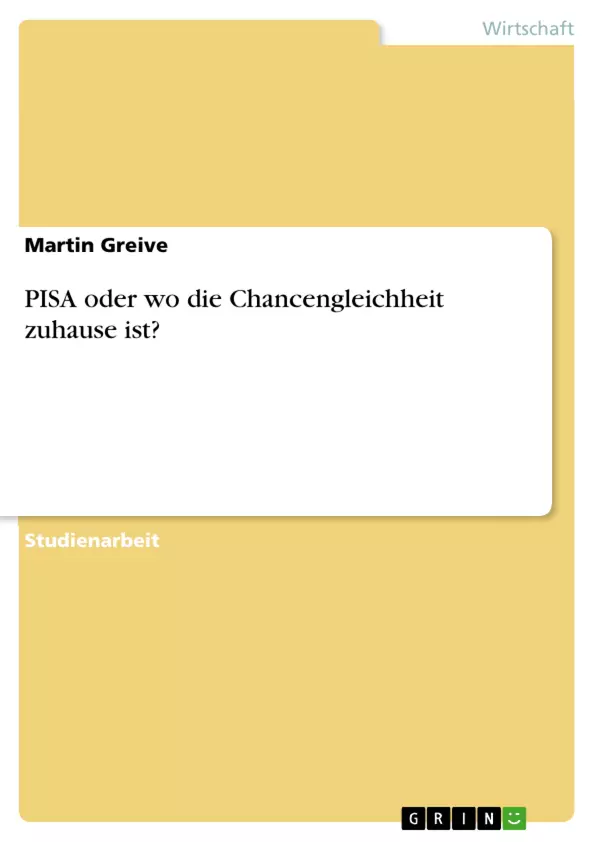Wohl keine andere Studie hat die Bildungslandschaft so durcheinandergewirbelt wie die PISA-Studie der OECD. In der im Jahr 2000 erstmals veröffentlichten Bildungsvergleichsstudie landeten die deutschen Schüler im internationalen Vergleich beim Leistungsniveau nur im Mittelfeld. Zudem prangerten die Autoren an, dass das Bildungsniveau in keinem anderen Land so stark von der familiären Herkunft abhänge wie in Deutschland. Diese Ergebnisse sorgten für den oft zitierten „PISA-Schock“. Seitdem überschlagen sich die Forderungen nach einschneidenden Bildungsreformen. Exemplarisch sei hier die Aussage vom PISA-Koordinator Andreas Schleicher aufgeführt, das dreigliedrige deutsche Schulsystem sei ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert.1 Diese Hausarbeit geht zwei Fragen nach: Erstens wird untersucht, welche Aussagekraft die Ergebnisse der PISA-Studie zur Chancengleichheit in Deutschland haben. Zweitens wird geprüft, ob man aus den Ergebnissen der PISA-Studie die Rückschlüsse für Bildungsreformen ziehen kann, die oftmals in politischen Diskussionen auftauchen. Die Hausarbeit ist zweigeteilt: Im ersten Teil der Arbeit gehe ich in Kapitel 2 auf verschiedene Definitionsmöglichkeiten von Chancengleichheit ein. Anhand des Bildungsparadoxons und der Bildungsexpansion werden zudem Strömungen vorgestellt, die dem Begriff Chancengleichheit kritisch gegenüberstehen. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der PISA-Studie. Kapitel 3 zeigt, was PISA genau ist und wer die Autoren der Studie sind. Kapitel 4 stellt die Ergebnisse im Bereich Chancengleichheit vor und übt Kritik daran. Kapitel 5 gibt einen Einblick in Handlungsempfehlungen zur Durchsetzung verbesserter Bildungschancen. [1 Vgl. Welt Kompakt (2007), S. 4.]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Chancengleichheit
- Definitionsmöglichkeiten von Chancengleichheit
- Formale Chancengleichheit
- Substantielle Chancengleichheit
- Schlussfolgerungen
- Kritik am Begriff Chancengleichheit
- Bildungsexpansion
- Bildungsparadoxon
- Schlussfolgerungen
- Definitionsmöglichkeiten von Chancengleichheit
- Die PISA-Studie der OECD
- PISA - eine internationale Schulleistungsuntersuchung
- Die Autoren der PISA-Studie
- Das PISA-Konsortium
- Kritik am PISA-Konsortium
- PISA und die Chancengleichheit
- Die PISA-Ergebnisse für Deutschland
- Kritik an PISA und politischen Rückschlüssen
- Kritik an den Erhebungsdaten
- PISA und das Abschneiden der Migrantenkinder
- PISA und der Ruf nach Gesamtschulen
- PISA und der Ruf nach Ganztagsschulen
- PISA und der Ruf nach höheren Bildungsausgaben
- Schlussfolgerungen
- Handlungsempfehlungen zur Steigerung von Chancengleichheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aussagekraft der PISA-Studie bezüglich der Chancengleichheit in Deutschland und prüft, inwiefern daraus Rückschlüsse für Bildungsreformen gezogen werden können. Die Arbeit beleuchtet kritische Punkte der Studie und diskutiert verschiedene Definitionsansätze von Chancengleichheit.
- Definition und Kritik des Begriffs Chancengleichheit (formale vs. substantielle Chancengleichheit)
- Analyse der PISA-Studie: Methodik und Ergebnisse
- Bewertung der PISA-Ergebnisse im Hinblick auf Chancengleichheit in Deutschland
- Kritik an den politischen Schlussfolgerungen aus den PISA-Ergebnissen
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den „PISA-Schock“ und die daraus resultierenden Forderungen nach Bildungsreformen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Aussagekraft der PISA-Studie hinsichtlich der Chancengleichheit und die daraus abgeleiteten politischen Schlussfolgerungen.
Der Begriff Chancengleichheit: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionsmöglichkeiten von Chancengleichheit, indem es formale und substantielle Chancengleichheit unterscheidet. Es wird kritisch auf die Implikationen substantieller Chancengleichheit eingegangen, insbesondere im Hinblick auf die Ressourcenallokation im Bildungssystem und die Rolle der Familie. Die Bildungsexpansion und das Bildungsparadoxon werden als kritische Gegenströmungen vorgestellt.
Die PISA-Studie der OECD: Dieses Kapitel beschreibt die PISA-Studie als internationale Schulleistungsuntersuchung und benennt die Autoren und das PISA-Konsortium. Es wird auch kritisch auf das Konsortium eingegangen.
PISA und die Chancengleichheit: Dieses Kapitel präsentiert die PISA-Ergebnisse für Deutschland im Hinblick auf Chancengleichheit. Es analysiert kritisch die Erhebungsdaten, das Abschneiden von Migrantenkinder und die daraus resultierenden Forderungen nach Gesamtschulen, Ganztagsschulen und höheren Bildungsausgaben.
Handlungsempfehlungen zur Steigerung von Chancengleichheit: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Textfragment fehlt) würde voraussichtlich konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem vorschlagen.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, PISA-Studie, Bildungssystem, Bildungsreformen, Bildungsexpansion, Bildungsparadoxon, formale Chancengleichheit, substantielle Chancengleichheit, soziale Herkunft, Migrantenkinder, Gesamtschulen, Ganztagsschulen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der PISA-Studie und Chancengleichheit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Aussagekraft der PISA-Studie im Hinblick auf Chancengleichheit in Deutschland und untersucht, inwieweit daraus Schlussfolgerungen für Bildungsreformen gezogen werden können. Sie beleuchtet kritische Punkte der Studie und diskutiert verschiedene Definitionsansätze von Chancengleichheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Kritik des Begriffs Chancengleichheit (formale vs. substantielle Chancengleichheit), Analyse der PISA-Studie (Methodik und Ergebnisse), Bewertung der PISA-Ergebnisse bezüglich Chancengleichheit in Deutschland, Kritik an politischen Schlussfolgerungen aus den PISA-Ergebnissen und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungssystem.
Wie definiert die Arbeit Chancengleichheit?
Die Arbeit unterscheidet zwischen formaler und substantieller Chancengleichheit. Formale Chancengleichheit bedeutet gleiche formale Zugänge zum Bildungssystem, während substantielle Chancengleichheit gleiche Ergebnisse trotz unterschiedlicher sozialer Hintergründe anstrebt. Die Arbeit kritisiert die Implikationen substantieller Chancengleichheit hinsichtlich Ressourcenallokation und der Rolle der Familie.
Was ist die Rolle der PISA-Studie in dieser Arbeit?
Die PISA-Studie dient als zentrale Datenbasis für die Analyse der Chancengleichheit in Deutschland. Die Arbeit untersucht die Methodik der Studie, ihre Ergebnisse und die daraus abgeleiteten politischen Schlussfolgerungen kritisch. Die Kritikpunkte umfassen die Erhebungsdaten, das Abschneiden von Migrantenkinder und die daraus resultierenden Forderungen nach Reformen wie Gesamtschulen, Ganztagsschulen und höheren Bildungsausgaben.
Welche Kritikpunkte an der PISA-Studie werden angesprochen?
Die Arbeit kritisiert die Erhebungsmethoden der PISA-Studie, die Interpretation der Ergebnisse und die daraus abgeleiteten politischen Schlussfolgerungen. Es wird insbesondere die Aussagekraft der Studie hinsichtlich des Abschneidens von Migrantenkinder hinterfragt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die PISA-Studie zwar wichtige Hinweise auf Ungleichheiten im Bildungssystem liefert, ihre Ergebnisse aber kritisch zu hinterfragen und nicht unreflektiert für politische Entscheidungen zu verwenden sind. Die Arbeit plädiert für eine differenzierte Betrachtung von Chancengleichheit und eine differenzierte Interpretation der PISA-Ergebnisse.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Der vorliegende Textauszug enthält noch keine konkreten Handlungsempfehlungen. Dieser Teil der Arbeit wird im vollständigen Dokument erwartet und würde voraussichtlich konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem vorschlagen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Chancengleichheit, PISA-Studie, Bildungssystem, Bildungsreformen, Bildungsexpansion, Bildungsparadoxon, formale Chancengleichheit, substantielle Chancengleichheit, soziale Herkunft, Migrantenkinder, Gesamtschulen, Ganztagsschulen.
- Quote paper
- Martin Greive (Author), 2008, PISA oder wo die Chancengleichheit zuhause ist? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118722