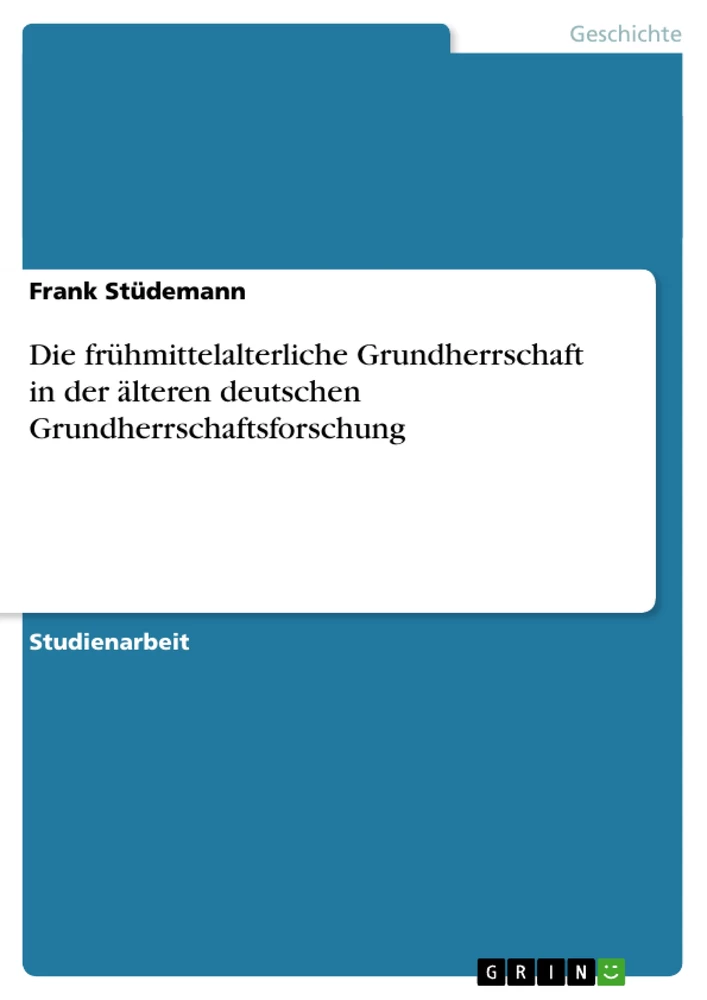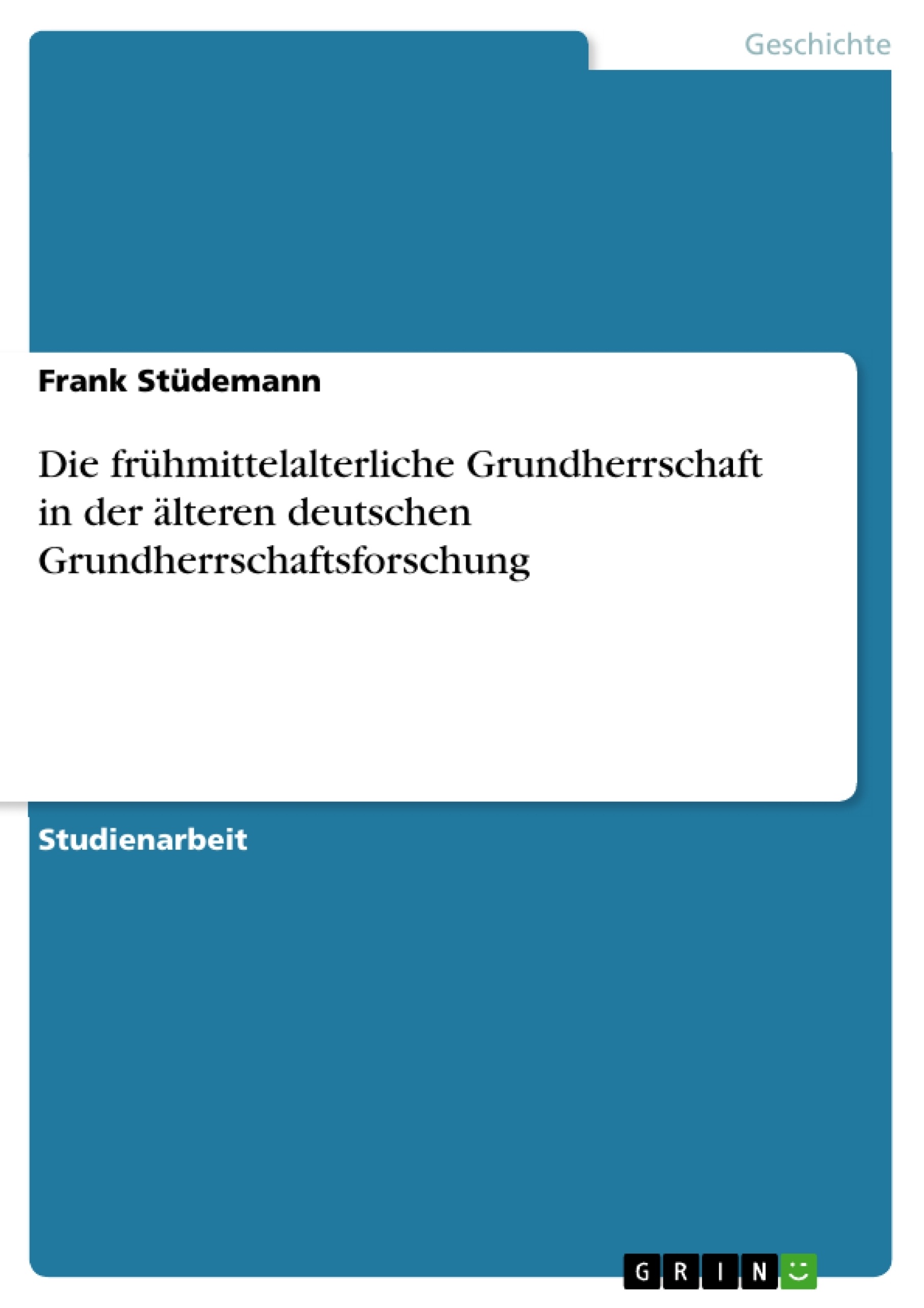Was bedeutet „Mittelalter“? – so fragte der Mediävist Kahl, und er antwortete mit dem
Hinweis auf genau fünf Gegebenheiten, die „Mittelalter“ bedeuten, nämlich eine
„Gesellschaft mit überwiegend agrarischer Struktur“, die „Partikularisierung des öffentlichen
Lebens“, die „Adelsherrschaft“, ein „christliches Kirchentum“ von „vortridentinischerkatholischer
Gestalt“ als Grundlage „alles höheren geistigen Lebens“ und schließlich die
„Traditionsmacht“ der „lateinischen Antike“. Wenn aber nur diese fünf Punkte von Belang
für das Mittelalter sind, was kann dieses noch für den modernen Menschen für eine
Bedeutung haben? Diese Frage wird gestellt und auch in Zukunft gestellt werden, wie Otto
Gerhard Oexle meint, denn die traditionellen historischen Rechtfertigungen der
Mittelalterforschung und des Mittelalterwissens sind inzwischen vergangen. Weder sind Ost-
und Italienpolitik römisch-deutscher Könige und Kaiser, noch der heroische Kampf der
Bürger gegen Fürstenmacht und Fürstenwillkür wirklich interessant. Im Zeichen
verschwundener nationaler Ideologien ist auch das nationalgeschichtliche Bedürfnis nach
Mittelalterforschung, zumindest in Westeuropa, rückläufig. Und angesichts des allgemeinen
Desinteresses in unserer Gesellschaft an Religion und Kirche stellt sich die Frage, welche
Rolle die Erinnerung an Entstehung und Geschichte der Kirche im Mittelalter noch spielen
sollte. Ebenso kann man nach dem Ende des real existierenden Sozialismus und seiner
Formationstheorien, in denen der Feudalismus des Mittelalters einen unverzichtbaren Platz
einnahm, nach weiterem Sinn mittelalterlicher Geschichtsforschung fragen. Sind also nur
noch ein paar spärliche Reste des Mittelalters, die im Rahmen politischer und kultureller
Europa-Rhetorik aufgegriffen werden, wie die Übermittlung des antiken Erbes, die
Geschichte des lateinischen Christentums oder die Gestalt Karl des Großen, für uns von
Interesse? Oder sollten wir drei französischen Mediävisten folgen, die den Sinn von
Mittelalterkenntnissen in der Optimierung der Entwicklungshilfe der Dritten und Vierten Welt
sehen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wesen und Bedeutung der Grundherrschaft im frühen Mittelalter
- 3. Der Begriff Grundherrschaft in den Quellen des frühen Mittelalters
- 4. Die ältere deutsche Grundherrschaftsforschung und der Historismus
- 4.1 Karl Theodor von Inama-Sternegg
- 4.2 Karl Lamprecht
- 4.3 Georg von Below
- 4.4 Alfons Dopsch
- 4.5 Rudolf Kötzschke
- 5. Abschließende Betrachtung
- 6. Quellen und Literatur
- 6.1 Quellen
- 6.2 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der frühmittelalterlichen Grundherrschaft in der älteren deutschen Grundherrschaftsforschung. Sie analysiert die Definition und Bedeutung der Grundherrschaft im frühen Mittelalter und beleuchtet die Genese des Begriffs. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Strömungen der älteren deutschen Grundherrschaftsforschung, insbesondere dem Streit zwischen Below und Lamprecht. Die Arbeit zeigt auf, wie unterschiedliche Ansätze im Kontext des Historismus die Forschung beeinflussten und welche Standpunkte die wichtigsten Vertreter des Fachs vertraten.
- Definition und Bedeutung der Grundherrschaft im frühen Mittelalter
- Die Genese des Begriffs „Grundherrschaft“
- Der Historismus als Rahmen der Forschung
- Die Kontroverse zwischen Below und Lamprecht
- Die wichtigsten Vertreter der älteren deutschen Grundherrschaftsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Mittelalters für die moderne Gesellschaft dar und erläutert die Bedeutung des Themas Grundherrschaft. Kapitel 2 definiert die Grundherrschaft und beschreibt ihre Rolle im frühen Mittelalter. Kapitel 3 analysiert die Verwendung des Begriffs „Grundherrschaft“ in den Quellen des frühen Mittelalters. Kapitel 4 widmet sich der älteren deutschen Grundherrschaftsforschung und beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze und Debatten im Kontext des Historismus. Es werden die wichtigsten Vertreter der Forschung wie Karl Theodor von Inama-Sternegg, Karl Lamprecht, Georg von Below, Alfons Dopsch und Rudolf Kötzschke vorgestellt und ihre Standpunkte dargestellt. Die Arbeit gipfelt in einer abschließenden Betrachtung, die die Ergebnisse der Forschung zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Grundherrschaft, Frühmittelalter, Historismus, Karl Theodor von Inama-Sternegg, Karl Lamprecht, Georg von Below, Alfons Dopsch, Rudolf Kötzschke, Agrargeschichte, Agrarverfassung, Quellenkritik, Forschungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Grundherrschaft" im frühen Mittelalter?
Grundherrschaft bezeichnet die Herrschaft eines Grundherrn über Land und die darauf ansässigen, oft rechtlich abhängigen Bauern (Unfreie oder Hörige).
Worum ging es im Streit zwischen Below und Lamprecht?
Es war eine zentrale Debatte der älteren deutschen Geschichtsforschung über die Entstehung der Grundherrschaft und ob diese eher auf politischen/rechtlichen oder ökonomischen Faktoren basierte.
Welche Rolle spielt der Historismus in dieser Forschung?
Der Historismus bildete den methodischen Rahmen, in dem Forscher wie Inama-Sternegg oder Dopsch versuchten, Geschichte aus ihren zeitgenössischen Quellen heraus zu verstehen und zu systematisieren.
Warum ist die Frühmittelalterforschung heute noch relevant?
Die Arbeit diskutiert, inwiefern mittelalterliche Strukturen (Agrarverfassung, Adelsherrschaft) das Fundament für das moderne Europa legten und heute noch als Identifikationspunkte dienen.
Wer war Alfons Dopsch?
Alfons Dopsch war ein bedeutender Historiker, der die These der Kontinuität zwischen der Antike und dem Mittelalter vertrat und die Bedeutung der Grundherrschaft für die soziale Ordnung betonte.
- Quote paper
- Frank Stüdemann (Author), 2003, Die frühmittelalterliche Grundherrschaft in der älteren deutschen Grundherrschaftsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118808