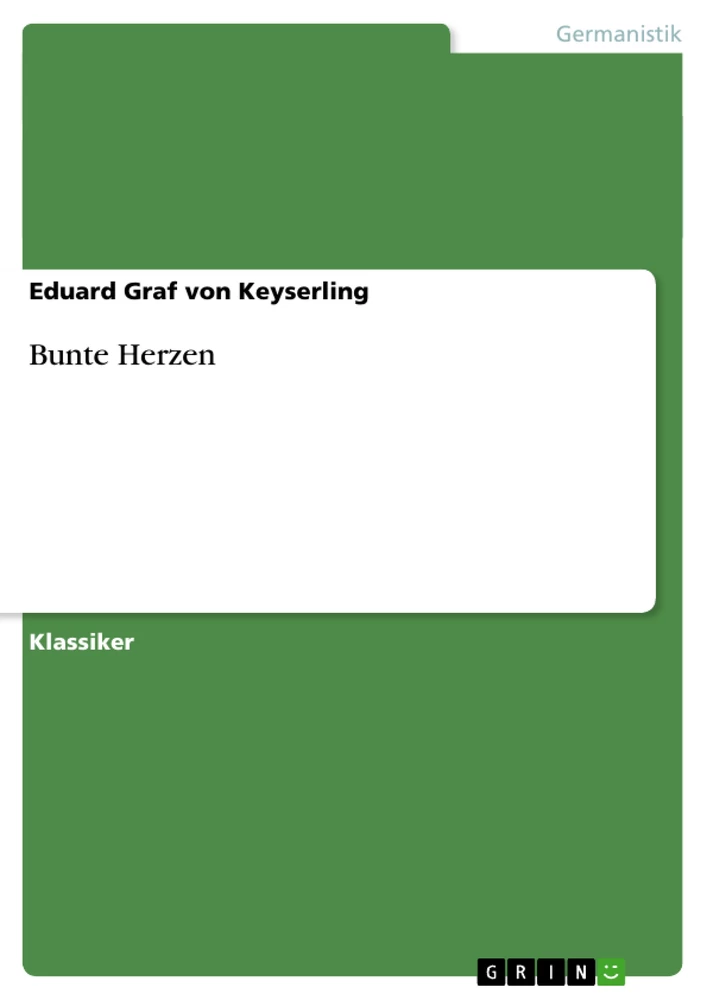Erstmalig erschienen 1909. Auszug: In Kadullen wurde im Sommer schon um vier Uhr gespeist, um den Abend für sommerliche Unternehmungen frei zu haben. Dann lag das Nachmittagslicht stetig auf der langen, weißen Gartenfront und den drei schweren Giebeln des Landhauses. In den geradlinigen Beeten glänzten die Levkojen wie krause hellfarbige Seide und der Buxbaum duftete warm und bitter. Ein Diener stellte sich auf die Stufen der Gartenveranda und läutete mit einer großen Glocke, das Signal, daß es Zeit sei, sich für das Mittagessen anzukleiden.
Der Hausherr, der alte Graf Hamilkar von Wandl-Dux, kam schon fertig angekleidet mit seinem Gast, dem Professor von Pinitz, in den Garten hinaus. Graf Hamilkar, sehr lang und schmal in seinem schwarzen Gehrock, hielt sich ein wenig gebeugt. Den Panama zog er tief in die Stirn. Das glattrasierte Gesicht mit dem langen, lippenlosen Munde hatte etwas Asketisches, wie es jene Gesichter haben, auf denen alles, was das Leben hineingeschrieben hat, beruhigt, gleichsam widerrufen erscheint. Mit langen Schritten begann er den Gartenweg hinabzuschreiten. Der Professor vermochte kaum Schritt zu halten, denn er war kurz und dick, die weiße Weste saß sehr prall über dem runden Bauch und das Gesicht war rot und erhitzt unter dem kannelfarbigen Bartgestrüpp. Er erzählte dem Grafen einen merkwürdigen Traum, den er gehabt hatte, dafür interessierte er sich jetzt, denn er wollte eine Theorie des Traumes schreiben, und der Graf teilte ihm das Material mit, welches er einmal auch über dieses Thema gesammelt hatte. Graf Hamilkar hatte immer gesammeltes Material für die Bücher, welche die anderen schreiben wollten, er selbst hatte nie eins geschrieben,»ich wußte nie«, pflegte er zu sagen,»welches meiner Bücher ich schreiben sollte und so kam es denn zu keinem.«
»Also denken Sie sich«, berichtete der Professor,»ich war beim Kollegen Domnitz, im Traum nämlich. Nun Domnitz legt mir beide Hände auf die Schultern, macht ein ganz feierliches Gesicht und sagt mit einer ganz tiefen Stimme, die er sonst nie hat: ›Kollege, ich habe die Grundform, die Urform der Schönheit gefunden, einfach die Schönheit an sich.‹ Ich sage Ihnen, das fuhr mir so durch alle Glieder, so eine Art Schreck oder Freude oder Rührung, gewiß, das Weinen war mir so nahe. Das sind Empfindungen, wie wir sie nur im Traum haben können: ›Nein wirklich‹, sage ich. ›wo ist sie denn?‹ – ›Da‹, sagte er und ja – und zeigt sie mir.«
Inhaltsverzeichnis
- In Kadullen
- Der Traum
- Schönheit an sich
- Die Welle jugendlichen Lebens
- Die Rose
- Der Garten
- Boris Dangellô
- Über das Gartengitter hinweg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Bunte Herzen“ von Eduard Keyserling, erstmals veröffentlicht im Jahr 1909, beschäftigt sich mit der Frage der Schönheit und ihrer Wahrnehmung in verschiedenen Lebensbereichen. Der Fokus liegt auf der individuellen Interpretation von Schönheit und der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen der ästhetischen Erfahrung.
- Schönheit als subjektive Wahrnehmung
- Die Suche nach der „Schönheit an sich“
- Die Rolle von Natur und Kultur in der Wahrnehmung von Schönheit
- Der Einfluss von Jugend und Alter auf die Bewertung von Schönheit
- Die Verbindung von Schönheit und Lebensgefühl
Zusammenfassung der Kapitel
- In Kadullen: Der Text beginnt mit der Beschreibung des Landhauses Kadullen und seiner Bewohner, darunter der alte Graf Hamilkar von Wandl-Dux und sein Gast, der Professor von Pinitz. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Lebensgefühls und der Atmosphäre des Landhauses.
- Der Traum: Der Professor von Pinitz berichtet dem Grafen von einem Traum, in dem er die „Grundform der Schönheit“ entdeckt. Der Traum wird als Ausgangspunkt für die Diskussion über die Natur der Schönheit verwendet.
- Schönheit an sich: Die beiden Herren diskutieren über die verschiedenen Erscheinungsformen der Schönheit, wobei der Professor von Pinitz die „Schönheit an sich“ als eine halbrunde weiße Tafel beschreibt.
- Die Welle jugendlichen Lebens: Eine Gruppe junger Leute betritt den Garten und bringt eine lebendige und jugendliche Atmosphäre in die Szenerie. Diese Szene dient als Kontrast zur ruhigen und nachdenklichen Atmosphäre des vorherigen Gesprächs.
- Die Rose: Der Graf zeigt dem Professor ein Beet voll roter Rosen und bezeichnet die Schönheit der Rose als „einleuchtende Schönheit, eigentlich Schönheit an sich“. Diese Szene unterstreicht die Verbindung von Schönheit und Natur.
- Der Garten: Der Text beschreibt die Atmosphäre des Gartens und die verschiedenen Elemente, die zur Schönheit des Gartens beitragen. Die Schönheit des Gartens wird als Spiegelbild der Schönheit der Natur angesehen.
- Boris Dangellô: Der Neffe des Grafen, Boris Dangellô, wird vorgestellt. Der Text beschreibt seine Schönheit und die Reaktion des Grafen darauf. Die Szene wirft Fragen über die Bedeutung von Schönheit im Kontext von Jugend und Alter auf.
- Über das Gartengitter hinweg: Der Text endet mit einem Blick über das Gartengitter hinweg auf die umliegende Landschaft. Die Szene symbolisiert die Verbindung von Natur und Kultur und die Suche nach Schönheit in der Welt.
Schlüsselwörter
Der Text „Bunte Herzen“ fokussiert auf die Themen Schönheit, Wahrnehmung, Natur, Kultur, Jugend, Alter und Lebensgefühl. Wichtige Begriffe sind „Schönheit an sich“, „Subjektivität“, „ästhetische Erfahrung“, „Traum“, „Naturerfahrung“, „Jugendlichkeit“, „Alter“, „Lebensgefühl“ und „Landschaft“. Der Text verwendet eine poetische Sprache und evoziert atmosphärische Bilder, die den Leser in die Welt des Landhauses Kadullen eintauchen lassen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Eduard Keyserlings „Bunte Herzen“?
Der Text thematisiert die subjektive Wahrnehmung von Schönheit und die ästhetische Erfahrung im Kontext von Natur, Jugend und Alter.
Was wird unter der „Schönheit an sich“ im Text verstanden?
Der Professor im Buch beschreibt sie im Traum als halbrunde weiße Tafel, während der Graf sie in der Natur, etwa bei roten Rosen, findet.
Welche Rolle spielt der Schauplatz Kadullen?
Das Landhaus Kadullen schafft eine ruhige, atmosphärische Kulisse für die philosophischen Gespräche der Protagonisten.
Wie wird der Kontrast zwischen Jugend und Alter dargestellt?
Durch das Eintreffen junger Leute in den Garten, was eine lebendige Atmosphäre schafft, die im Gegensatz zur Beschaulichkeit der älteren Herren steht.
Wer ist Boris Dangellô?
Er ist der Neffe des Grafen, dessen jugendliche Schönheit Fragen über die Bewertung von Ästhetik im Lebenslauf aufwirft.
- Citation du texte
- Eduard Graf von Keyserling (Auteur), 2008, Bunte Herzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118818