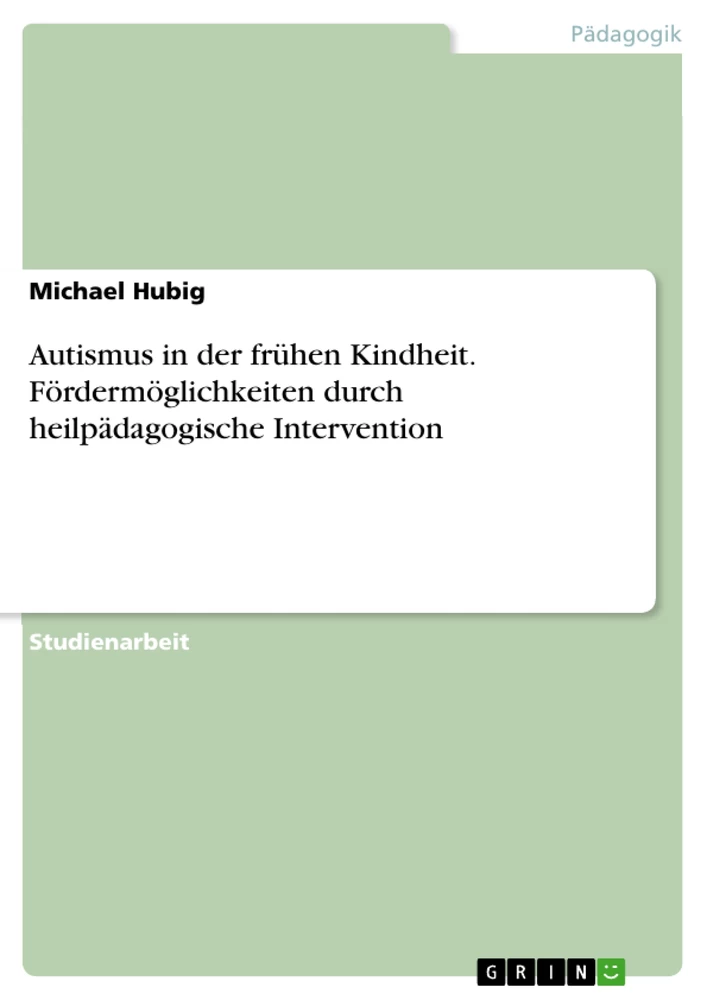Mit dieser Arbeit werden verschiedene Interventionsmöglichkeiten der Heilpädagogik für Kinder (Alter: drei bis sechs Jahre) mit signifikanten Symptomen aus dem Autismus-Spektrum dargestellt, diese vor einem entwicklungspsychologischen und neurobiologischen Hintergrund eingeordnet und hierzu abschließend Empfehlungen hinsichtlich der Umsetzung einer langfristig erfolgversprechenden Frühförderung gegeben.
Kinder und Jugendliche stellen nach wie vor die zahlenmäßig größte Zielgruppe für heilpädagogische Interventionen dar, wobei diese Arbeit einen heilpädagogischen Förderbedarf in der frühen Kindheit durch eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) fokussiert. Eine ASS stellt eine sogenannte personale Bedingung dar, denn es handelt sich hier um eine dauerhafte Beeinträchtigung bzw. Abweichung in Form einer personalen, also persönlichen, somatischen Eigenschaft.
Während man früher häufig drei Formen von Autismus unterschied, werden diese heute zunehmend unter der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst. Innerhalb des Spektrums finden sich Formen mit Einschränkungen der kognitiven und sprachlichen Entwicklung bis hin zu mindestens durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Intelligenz. Bei eindeutiger Symptomatik und früher Diagnose (18 bis 24 Monate) ist meist mit Sprachentwicklungsstörungen und einer bleibenden Diagnose zu rechnen. Eine Frühförderung ist bei dieser oft signifikanten Symptomatik besonders wichtig. Auch wenn eine Heilung nicht möglich ist, so können Entwicklungsverläufe positiv beeinflusst und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben langfristig unterstützt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Heilpädagogische Interventionen in der Kindheit
- 1.2 ASS in der frühen Kindheit
- 1.3 Fragestellung
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2. Heilpädagogische Frühförderung bei Autismus-Spektrum-Symptomatik
- 2.1 Ursachen, Verlaufsformen und Diagnostik
- 2.1.1. ASS Symptomatik – Ätiologie und neurobiologischer Hintergrund
- 2.1.2. ASS Symptomatik – Entwicklungspsychologischer Hintergrund
- 2.1.3. Verändertes Spiel- und Sozialverhalten
- 2.1.4. Abweichende Entwicklungsverläufe
- 2.1.5. Frühe Diagnostik
- 2.1.6. Frühe Förderung und Intervention für Kinder im Autismus-Spektrum
- 2.2 Möglichkeiten und Perspektiven heilpädagogischer Interventionen
- 2.2.1. Förderung von Kommunikation und Sprache
- 2.2.2. Förderung der sozialen Interaktion
- 2.2.3. TEACCH
- 2.2.4. ESDM
- 2.2.5. PECS®
- 2.2.6. Das Frankfurter Frühinterventionsprogramm A-FFIP
- 2.2.7. Fazit
- 2.1 Ursachen, Verlaufsformen und Diagnostik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die heilpädagogischen Fördermöglichkeiten für Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) im Alter von drei bis sechs Jahren. Dabei steht die Frage im Vordergrund, welche Interventionsmöglichkeiten der Heilpädagogik es für Kinder mit signifikanten ASS-Symptomen gibt und wie diese vor einem entwicklungspsychologischen und neurobiologischen Hintergrund einzuordnen sind.
- Die verschiedenen Ursachen und Verlaufsformen von ASS in der frühen Kindheit
- Die Bedeutung früher Diagnostik und Intervention bei ASS
- Die verschiedenen Ansätze der heilpädagogischen Frühförderung bei ASS
- Die Förderung von Kommunikation und Sprache bei Kindern mit ASS
- Die Förderung der sozialen Interaktion bei Kindern mit ASS
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik der heilpädagogischen Interventionen bei ASS in der frühen Kindheit. Es beleuchtet die Bedeutung des frühzeitigen Erkennens und der Intervention bei ASS, sowie die verschiedenen Formen und Ausprägungen der Störung im frühen Kindesalter.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit den Ursachen, Verlaufsformen und der Diagnostik von ASS. Es werden die wichtigsten neurobiologischen und entwicklungspsychologischen Hintergründe der Störung erläutert, sowie die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und Intervention hervorgehoben.
Kapitel zwei, Teil zwei, beleuchtet die verschiedenen Ansätze der heilpädagogischen Frühförderung bei ASS. Es werden verschiedene Förderprogramme und Methoden vorgestellt, die auf die Förderung von Kommunikation, Sprache und sozialer Interaktion bei Kindern mit ASS ausgerichtet sind.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum-Störung (ASS), Frühförderung, heilpädagogische Interventionen, Kommunikation, Sprache, soziale Interaktion, TEACCH, ESDM, PECS®, Frankfurter Frühinterventionsprogramm A-FFIP.
Häufig gestellte Fragen
Welche Altersgruppe steht im Fokus der heilpädagogischen Intervention bei ASS?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Frühförderung von Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren mit Autismus-Spektrum-Störungen.
Warum ist eine frühe Diagnostik bei Autismus so entscheidend?
Eine frühe Diagnose (idealerweise zwischen 18 und 24 Monaten) ermöglicht den rechtzeitigen Beginn von Fördermaßnahmen, die den Entwicklungsverlauf positiv beeinflussen können.
Welche Förderansätze werden in der Arbeit vorgestellt?
Vorgestellt werden unter anderem der TEACCH-Ansatz, das ESDM-Modell, PECS® sowie das Frankfurter Frühinterventionsprogramm A-FFIP.
Kann heilpädagogische Frühförderung Autismus heilen?
Nein, eine Heilung von ASS ist nicht möglich, aber die Interventionen können die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Kommunikationsfähigkeit langfristig erheblich verbessern.
Was sind die Kernbereiche der Förderung bei Kindern mit ASS?
Die Schwerpunkte liegen auf der Förderung der Sprache, der Kommunikation sowie der sozialen Interaktion und dem Spielverhalten.
- Quote paper
- Michael Hubig (Author), 2022, Autismus in der frühen Kindheit. Fördermöglichkeiten durch heilpädagogische Intervention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190366