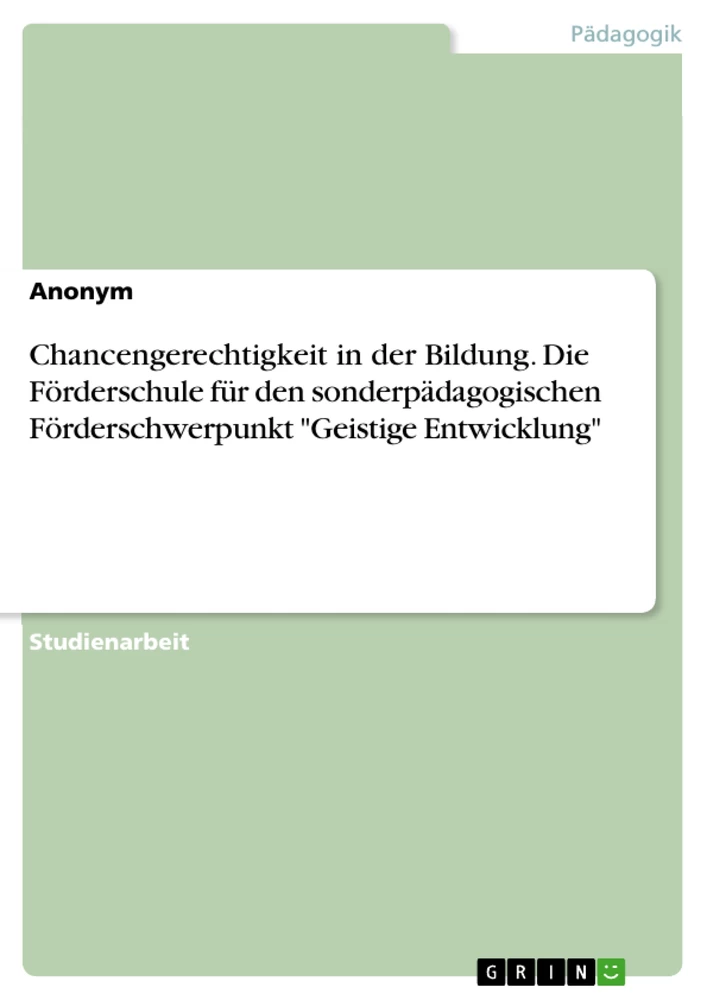Erfüllt der Staat mit der Förderschule für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ die Chancengerechtigkeit auf Bildung? Oder hat seit Beginn der Geschichte der Förderschule sich prinzipiell wenig verändert? Ist die Förderschule noch eine Form der Separation der Beeinträchtigten ohne Möglichkeit auf entsprechende Bildung?
Ich beleuchte zunächst die Geschichte der Förderschule, um erkenntlich zu machen, wie sich sowohl die Chance auf Bildung als auch die Aussonderung der Kinder mit geistiger Behinderung entwickelte. Danach stelle ich kurz die rechtlichen Rahmenbedingungen für diesen Schultyp am Beispiel Berlins dar. Dies ziehe ich in Betracht, um aufzuzeigen, welche gegenwärtigen Möglichkeiten es für den Unterricht an einer Förderschule gibt und inwieweit es den Bildungsauftrag erfüllt. Im Anschluss folgt eine Argumentation unterstützend mit einigen Aussagen von Bildungs- und Erziehungswissenschaftlern zur Frage der Separation und Chancengerechtigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Die Geschichte der Förderschule in Deutschland
- Die Entwicklung bis 1945
- Die Entwicklung bis zur ersten KMK-Empfehlung 1994
- Die Entwicklung mit der KMK-Empfehlung von 1998
- Möglichkeiten durch die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Förderschule in Berlin
- Separation und Chancengerechtigkeit durch die Förderschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Geschichte der Förderschule für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Deutschland und beleuchtet die Frage der Chancengerechtigkeit in der Bildung für Menschen mit geistiger Behinderung.
- Entwicklung der Förderschule in Deutschland
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Förderschulen in Berlin
- Separation und Integration im Bildungssystem
- Chancengerechtigkeit für Menschen mit geistiger Behinderung
- Der Anspruch auf Bildung für Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Geschichte der Förderschule in Deutschland
Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Förderschule für geistig behinderte Kinder in Deutschland vom 19. Jahrhundert bis zur KMK-Empfehlung von 1998. Es wird die Entwicklung von Hilfsschulen, Vor- und Sammelklassen, die Situation im dritten Reich und die unterschiedlichen Entwicklungen in der DDR und BRD nach dem Krieg dargestellt. Die Bedeutung der KMK-Empfehlungen von 1972 und 1994 für die Förderung von Kindern mit geistiger Behinderung wird hervorgehoben.
Möglichkeiten durch die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Förderschule in Berlin
Dieses Kapitel beleuchtet die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen für Förderschulen in Berlin und zeigt die Möglichkeiten für den Unterricht auf. Es wird diskutiert, inwieweit diese Rahmenbedingungen den Bildungsauftrag für Menschen mit geistiger Behinderung erfüllen.
Separation und Chancengerechtigkeit durch die Förderschule
Das Kapitel thematisiert die Frage der Separation und Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Es werden Argumente von Bildungs- und Erziehungswissenschaftlern zur Diskussion gestellt, die sich mit der Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung im allgemeinen Bildungssystem auseinandersetzen.
Schlüsselwörter
Förderschule, Geistige Entwicklung, Sonderpädagogik, Inklusion, Separation, Chancengerechtigkeit, UN-Behindertenrechtskonvention, Bildungssystem, Recht auf Bildung, Hilfsschule, KMK-Empfehlung, Integration, Deutschland, Berlin.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Chancengerechtigkeit in der Bildung. Die Förderschule für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1193715