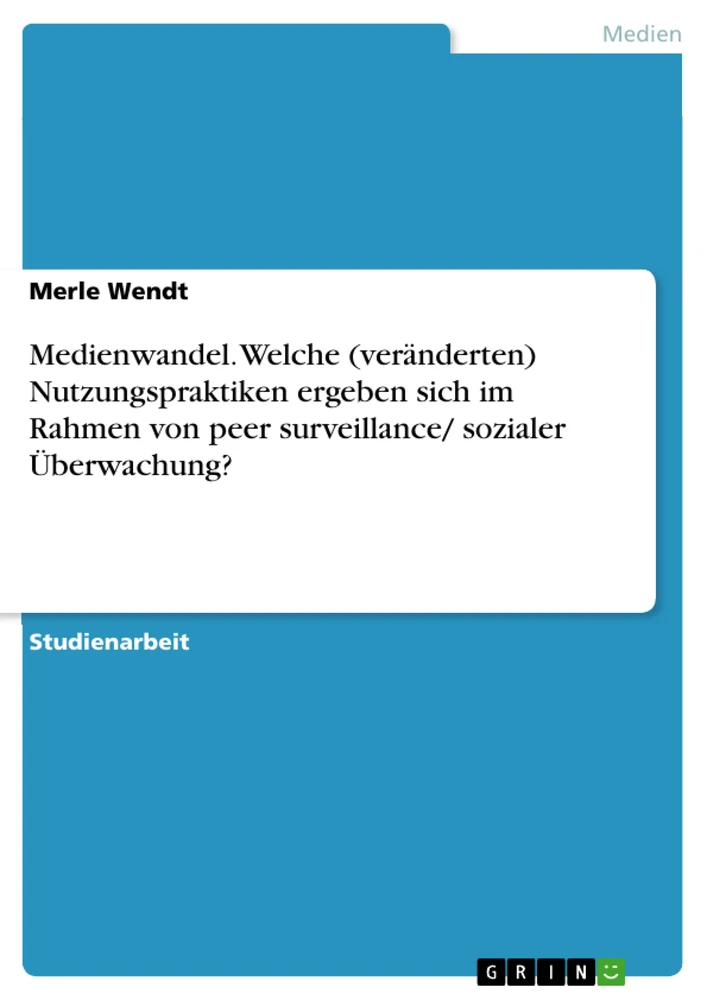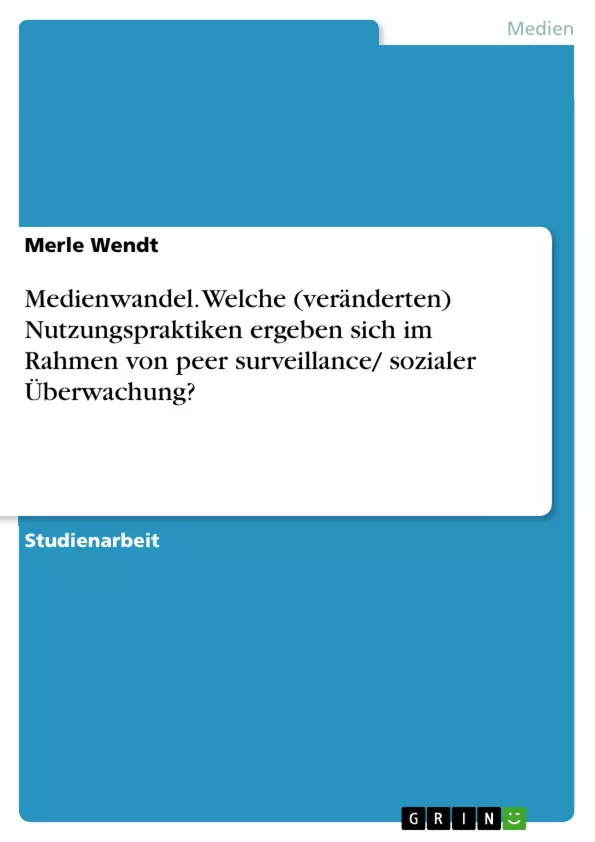Was veranlasst Menschen dazu, andere zu überwachen? Was versteht man unter peer surveillance? Wie gehen (junge) Menschen mit dem Wissen um, überwacht zu werden? Welchen Einfluss hat dies auf ihre Nutzungspraktiken? Um diese Entwicklungen und die Hinter- und Beweggründe von peer surveillance nachvollziehen zu können, wird zunächst erläutert, was unter Mediatisierung zu verstehen ist.
Anschließend wird der Forschungsstand der Surveillance Studies anhand wissenschaftlicher Literatur dargestellt, indem zunächst ein Einblick in die vertikale Überwachung erfolgt. Darauffolgend wird die daraus hervorgehende horizontale Überwachung beleuchtet. Kapitel 4 beschäftigt sich mit peer surveillance in Sozialen Netzwerken, was die Funktionsweisen der Sozialen Medien und die damit verbundenen Möglichkeiten für die User einschließt.
In Kapitel 4.1 werden zunächst die (veränderten) Nutzungspraktiken der überwachenden User dargestellt und die Beweggründe für peer sur-veillance betrachtet. Im Anschluss daran werden die (veränderten) Nutzungspraktiken der (potenziell) überwachten User betrachtet, die die Wahrnehmung und Verwaltung der eigenen Sichtbarkeit beinhalten. In diesem Zusammenhang werden die veränderten Selbstpräsentationspraktiken, Verwaltung der Privatsphäre, Selbstüberwachung und Erstellung pseudonymer Accounts erläutert. Das fünfte Kapitel beinhaltet die ausführliche Diskussion über die (veränderten) Nutzungspraktiken im Rahmen von peer surveillance. Im sechsten Kapitel erfolgt die Limitation der vorliegenden Arbeit und es wird ein Ausblick auf zukünftige Forschungen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mediatisierung
- 3. Surveillance Studies
- 3.1 Vertikale Überwachung
- 3.2 Horizontale Überwachung
- 4. Peer surveillance in Sozialen Netzwerken
- 4.1 (Veränderte) Nutzungspraktiken der überwachenden User
- 4.2 (Veränderte) Nutzungspraktiken der (potenziell) überwachten User
- 4.2.1 Verwaltung der Privatsphäre
- 4.2.2 Selbstüberwachung
- 4.2.3 Erstellung pseudonymer Accounts
- 5. Diskussion und Fazit
- 6. Limitation und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die veränderten Nutzungspraktiken im Kontext von Peer Surveillance, insbesondere in sozialen Netzwerken. Die Arbeit analysiert, wie die allgegenwärtige Überwachung unter Gleichaltrigen das Verhalten sowohl der überwachenden als auch der (potenziell) überwachten Nutzer beeinflusst.
- Definition und Abgrenzung von Peer Surveillance im Vergleich zur vertikalen Überwachung
- Analyse der Nutzungspraktiken von Nutzern, die andere überwachen
- Untersuchung der Anpassungsstrategien von Nutzern, die sich der Überwachung bewusst sind
- Der Einfluss sozialer Medien auf die Dynamik von Peer Surveillance
- Bedeutung von Privatsphäre und Selbstinszenierung im digitalen Raum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Peer Surveillance ein und definiert zentrale Begriffe wie horizontale und vertikale Überwachung. Sie skizziert die Forschungsfrage der Arbeit: Welche veränderten Nutzungspraktiken ergeben sich im Rahmen von Peer Surveillance? Der Kontext der intensiven Smartphone-Nutzung und die Präsenz sozialer Netzwerke im Alltag junger Menschen wird hervorgehoben, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen. Die Einleitung beschreibt den Aufbau der Arbeit und die Methodik, die zur Beantwortung der Forschungsfrage eingesetzt wird.
2. Mediatisierung: (Anmerkung: Kapitel 2 fehlt im bereitgestellten Text und kann daher nicht zusammengefasst werden.)
3. Surveillance Studies: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Forschungsstand zu Surveillance Studies. Es unterscheidet zwischen vertikaler und horizontaler Überwachung, wobei die vertikale Überwachung als klassisches Top-down-Modell und die horizontale Überwachung als revolutionäre, non-hierarchische Form dargestellt wird. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der Unterschiede zwischen diesen beiden Überwachungsformen und der Einordnung von Peer Surveillance innerhalb dieses Rahmens. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Forschung zu horizontaler Überwachung und verweist auf einschlägige wissenschaftliche Literatur.
4. Peer surveillance in Sozialen Netzwerken: Kapitel 4 untersucht Peer Surveillance im Kontext sozialer Netzwerke. Es analysiert die Nutzungspraktiken sowohl der überwachenden als auch der (potenziell) überwachten Nutzer. Die Analyse umfasst die Beweggründe für Peer Surveillance und die Strategien, die Nutzer zur Verwaltung ihrer Privatsphäre und Selbstpräsentation einsetzen, darunter die Erstellung pseudonymer Accounts und die Selbstüberwachung. Das Kapitel stützt sich auf empirische Studien und wissenschaftliche Literatur, um die Forschungsfrage der Arbeit zu beantworten.
Schlüsselwörter
Peer Surveillance, horizontale Überwachung, vertikale Überwachung, soziale Netzwerke, digitale Medien, Privatsphäre, Selbstüberwachung, Nutzungspraktiken, soziale Medien, Selbstpräsentation, empirische Forschung, ARD/ZDF-Onlinestudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Peer Surveillance in Sozialen Netzwerken
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die veränderten Nutzungspraktiken im Kontext von Peer Surveillance, insbesondere in sozialen Netzwerken. Im Fokus steht die Analyse, wie die allgegenwärtige Überwachung unter Gleichaltrigen das Verhalten sowohl der überwachenden als auch der (potenziell) überwachten Nutzer beeinflusst.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Definition und Abgrenzung von Peer Surveillance im Vergleich zur vertikalen Überwachung, die Analyse der Nutzungspraktiken von Nutzern, die andere überwachen, die Untersuchung der Anpassungsstrategien von Nutzern, die sich der Überwachung bewusst sind, den Einfluss sozialer Medien auf die Dynamik von Peer Surveillance und die Bedeutung von Privatsphäre und Selbstinszenierung im digitalen Raum.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Mediatisierung, Surveillance Studies (mit Unterkapiteln zu vertikaler und horizontaler Überwachung), Peer Surveillance in Sozialen Netzwerken (mit Unterkapiteln zu den Nutzungspraktiken überwachender und überwachter Nutzer, inklusive Privatsphäre-Management, Selbstüberwachung und der Erstellung pseudonymer Accounts), Diskussion und Fazit sowie Limitation und Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche veränderten Nutzungspraktiken ergeben sich im Rahmen von Peer Surveillance? Die Arbeit untersucht die Nutzungspraktiken sowohl der überwachenden als auch der (potenziell) überwachten Nutzer und analysiert deren Beweggründe und Strategien.
Welche Arten der Überwachung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen vertikaler Überwachung (klassisches Top-down-Modell) und horizontaler Überwachung (non-hierarchische Form). Peer Surveillance wird als eine Form der horizontalen Überwachung eingeordnet.
Welche Methoden werden in der Seminararbeit verwendet?
Die Methodik der Arbeit wird in der Einleitung beschrieben. Die Zusammenfassung der Kapitel deutet auf eine Literaturrecherche und die Analyse empirischer Studien hin (z.B. Verweis auf die ARD/ZDF-Onlinestudie).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Peer Surveillance, horizontale Überwachung, vertikale Überwachung, soziale Netzwerke, digitale Medien, Privatsphäre, Selbstüberwachung, Nutzungspraktiken, soziale Medien, Selbstpräsentation, empirische Forschung, ARD/ZDF-Onlinestudie.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die HTML-Datei beinhaltet Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung, Surveillance Studies und Peer Surveillance in Sozialen Netzwerken. Kapitel 2 (Mediatisierung) ist im bereitgestellten Text nicht enthalten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit befinden sich im Kapitel "Diskussion und Fazit" und im Kapitel "Limitation und Ausblick", die im bereitgestellten Text jedoch nicht explizit zusammengefasst sind.
- Quote paper
- Master of Arts Merle Wendt (Author), 2020, Medienwandel. Welche (veränderten) Nutzungspraktiken ergeben sich im Rahmen von peer surveillance/ sozialer Überwachung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1195487