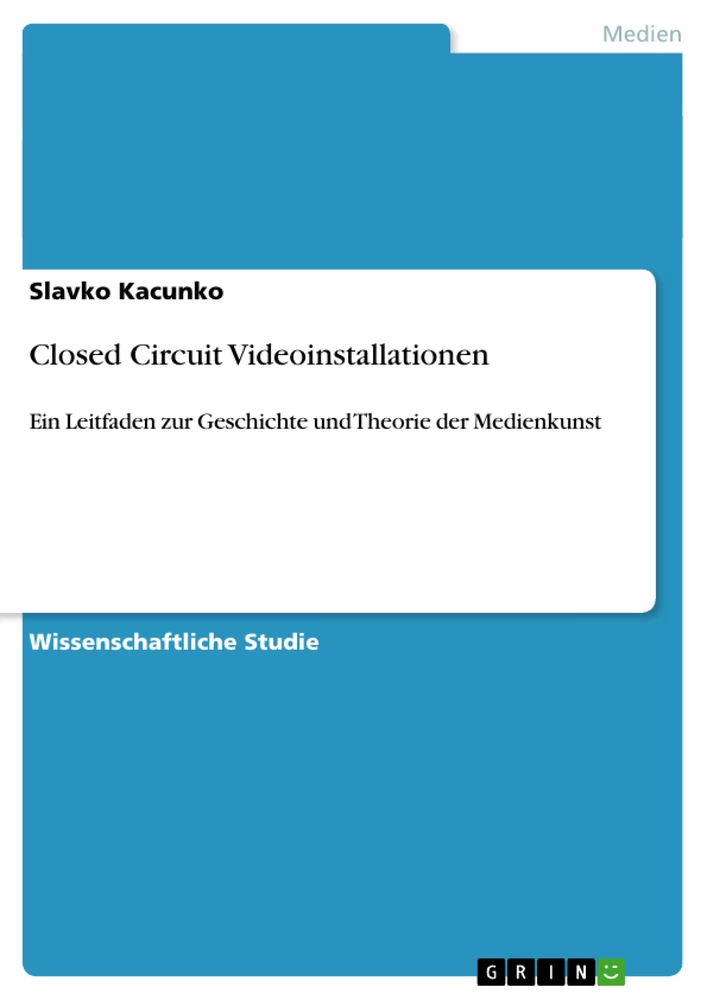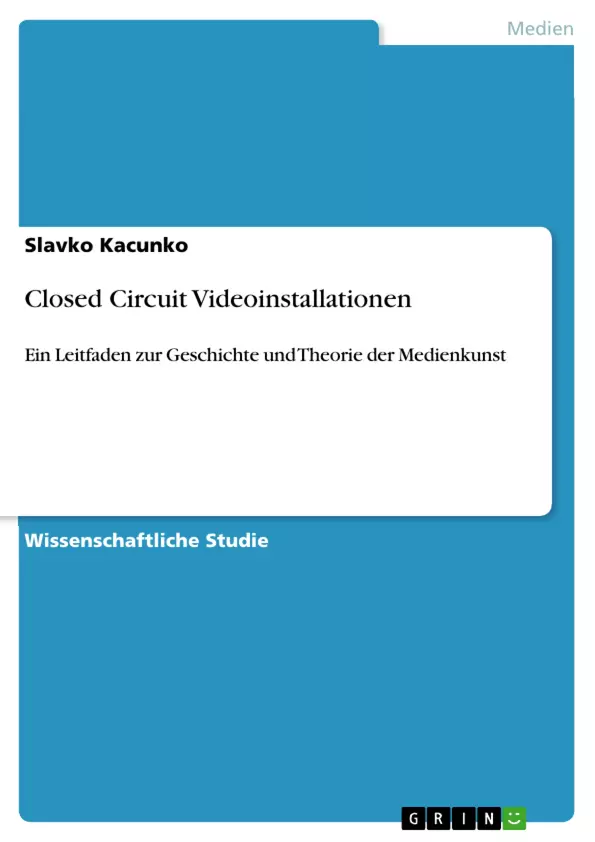Some reviews:
“Closed Circuit Installations have been a major innovation in the evolution of art: The observer became visually and acoustically part of the system he observed. The inclusion of the viewer in the viewed image was a radical transformation of the image and was one of the revolutionary beginnings of participatory, interactive, immersive and virtual environments. This book that you hold in hand is the pivotal source book about this heroic period.” (Peter Weibel, ZKM, Karlsruhe, Chairman)
„[...] Slavko Kacunko hat die große Diskrepanz zwischen dem theoretischen Überbau-Anspruch der meisten Autoren sowie der fehlenden Materialkenntnis erkannt und [...] Grundlagenarbeiten geleistet, die dem einzelnen Werk dient und dies nicht nur als Illustration einer Theorie benutzt [...] Slavko Kacunko hat mit diesem Werk eine Verbindung zwischen Kunst- und Medienwissenschaft geschaffen und damit eine theoretisch wie praktisch hochrangige Arbeit geleistet, die Maßstäbe setzt und der innerhalb der letzten Jahre meines Wissens nichts Vergleichbares an die Seite zu stellen ist.“(Wulf Herzogenrath, Kunsthalle Bremen, Director)
„[...] dafür möchte ich mich nicht nur herzlich bedanken, sondern ihnen zu diesem fulminanten werk herzlich und aufrichtig gratulieren. sie haben mit diesem 'opus magnun' zweifellos einen meilenstein in der gesamten bisherigen geschichte der medienkunst gesetzt“ (Richard Kriesche, Media-Artist, Professor, Curator and Autor)
[...] der Leitfaden zur Geschichte und Theorie der Medienkunst mit Bausteinen eines Künstlerlexikons, den Slavko Kacunko zu Closed Circuit Videoinstallationen verfasst hat, wird für die nächsten Jahrzehnte nicht nur wegen seines Umfangs ein Standardwerk sein. (Andrea Domesle, Critics, Camera Austria)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medienkunstgeschichte: Zustand und Zuständigkeiten
- Standortbestimmung: Bildkritik und Kulturkritik
- Struktur und Inhalte
- 1 Medienkunst: kategoriale Bestimmungen
- 1.1 Installation
- 1.2 Performance
- 1.3 Input/Output (Kybernetikmodell)
- 1.4 Feedback
- 1.5 Immediacy/Liveness
- 1.6 Interface
- 1.7 Interaction
- 1.8 Allgemeinere Begriffspaare
- 1.8.1 Kunst und „Medium“
- 1.8.2 „Repräsentation“ und „Präsentation“
- 1.8.3 Analog und „Digital“
- 2 Closed-Circuit Videoinstallationen: Ein theoretischer Einblick
- 2.1 Subjekt/Objekt-Verhältnis
- 2.2 Wirklichkeitskonstruktionen
- 2.3 Systemmodelle und Verhaltensmuster
- 2.4 Spielkonzepte und Lernprozesse
- 2.5 Datenerfassung und -kontrolle
- 2.6 Telekommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk bietet einen Leitfaden zur Geschichte und Theorie der Medienkunst, mit besonderem Fokus auf Closed-Circuit Videoinstallationen. Es untersucht die kategorialen Bestimmungen von Medienkunst und beleuchtet zentrale theoretische Konzepte.
- Kategoriale Bestimmungen von Medienkunst (Installation, Performance, Feedback etc.)
- Theoretische Erörterung von Closed-Circuit Videoinstallationen
- Analyse des Subjekt/Objekt-Verhältnisses in Medienkunst
- Untersuchung von Wirklichkeitskonstruktionen und Systemmodellen
- Bedeutung von Spielkonzepten und Lernprozessen in der Medienkunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein. Das Kapitel „Medienkunstgeschichte: Zustand und Zuständigkeiten“ bietet eine Standortbestimmung. Das Kapitel „Struktur und Inhalte“ gibt einen Überblick über die folgenden Kapitel. Kapitel 1 behandelt verschiedene kategoriale Bestimmungen der Medienkunst, von „Installation“ über „Performance“ bis hin zu „Interaction“. Kapitel 2 widmet sich Closed-Circuit Videoinstallationen, untersucht das Subjekt/Objekt-Verhältnis und Wirklichkeitskonstruktionen im Kontext dieser Kunstform, sowie Systemmodelle und Lernprozesse.
Schlüsselwörter
Medienkunst, Closed-Circuit Videoinstallationen, Installation, Performance, Interaction, Subjekt/Objekt-Verhältnis, Wirklichkeitskonstruktion, Systemmodelle, Lernprozesse, Kybernetik, Telekommunikation, Bildkritik, Kulturkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Closed-Circuit Videoinstallationen?
Dabei handelt es sich um Kunstwerke, bei denen der Betrachter durch Kameras und Monitore in Echtzeit Teil des Bildes wird. Dies war ein revolutionärer Beginn für partizipative und interaktive Medienkunst.
Welche zentralen Begriffe der Medienkunst werden im Buch erklärt?
Das Werk definiert Kategorien wie Installation, Performance, Feedback, Feedback-Schleifen, Interface und Interaktion im Kontext der Kunstgeschichte.
Wer ist der Autor dieses Standardwerks?
Das Buch wurde von Slavko Kacunko verfasst und gilt als Meilenstein in der Geschichte und Theorie der Medienkunst.
Welche Rolle spielt die Kybernetik in der Medienkunst?
Die Arbeit nutzt Kybernetikmodelle (Input/Output), um die Funktionsweise von Feedback-Systemen in Videoinstallationen theoretisch zu untermauern.
Wie verändert Closed-Circuit das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt?
Durch die Einbeziehung des Betrachters in das Bild wird die klassische Trennung zwischen dem Beobachter (Subjekt) und dem Kunstwerk (Objekt) aufgehoben; der Betrachter wird selbst zum Bildinhalt.
- Quote paper
- PD Dr. Phil. Habil. Slavko Kacunko (Author), 2005, Closed Circuit Videoinstallationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119719