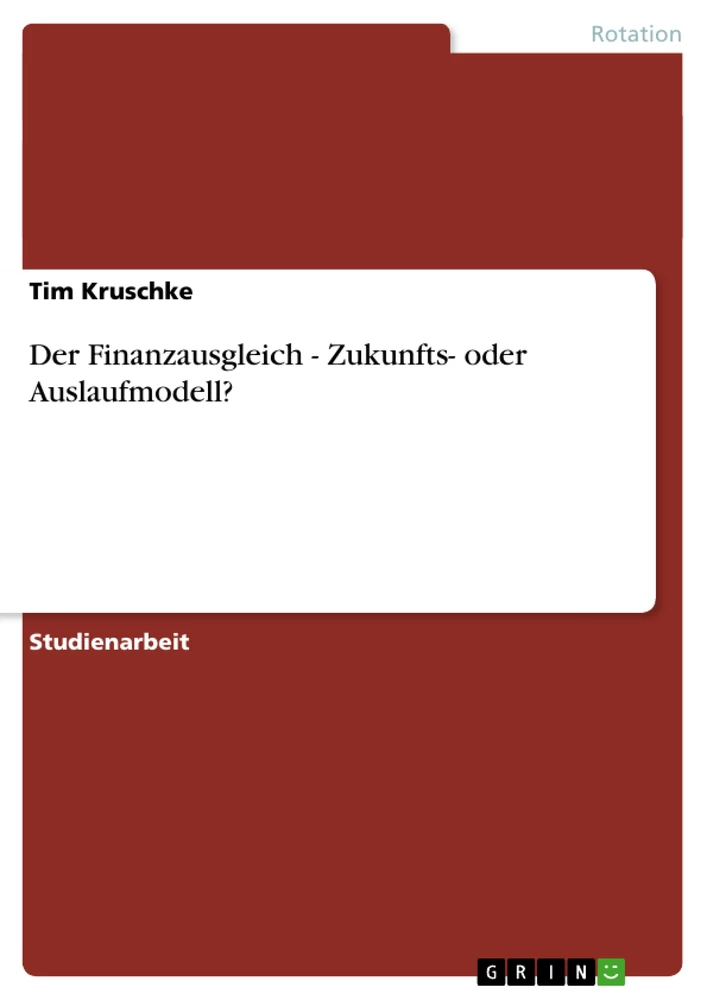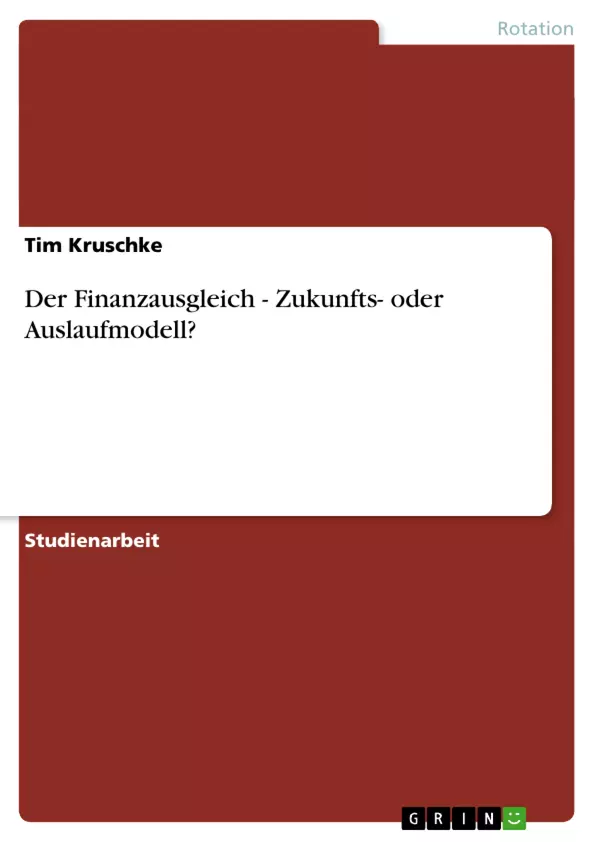Ein Sprichwort lautet: "Bei Geld hört die Freundschaft auf". Und so darf es nicht verwundern, dass eins der Kernstücke des deutschen Föderalstaates am meisten umstritten und umkämpft ist: die Finanzverfassung und der Finanzausgleich im besonderen. Am 01.01.1995 wurden die neuen Bundesländer vollständig in das bundesdeutsche Finanzausgleichsystem aufgenommen. Dies stellte einen einzigartigen finanziellen Kraftakt für die alten Länder und den Bund dar. Obwohl, zumindest in der Wissenschaft unumstritten, die deutsche Wiedervereinigung eigentlich umfassende Reformen am Finanzausgleichsystem erfordert hätte, fanden diese nicht statt. Stattdessen behalf man sich von 1990 bis 1994 mit einer Übergangslösung, dem Fonds "Deutsche Einheit" und erfand für die Zeit von 1995 bis 2004 eine "Krücke", die das bestehende Finanzausgleichsystem auf den Beinen halten sollte, den Solidarpakt. Bis 2004, so war man sich in der Politik sicher, wären alle (finanziellen) Brüche "verheilt" und die Bundesrepublik könnte zur Normalität übergehen. Renzsch (1995) bezeichnete diesen Vorgang als "Musterbeispiel für Problemabarbeitungsprozesse im deutschen Bundesstaat". Man hielt an Althergebrachtem fest und beschritt neue Wege nur dann und äußerst vorsichtig, wenn sie unumgänglich waren. Allerdings musste man relativ bald erkennen, dass der "Aufbau Ost" nicht die erhofften Fortschritte machte, und so wurde im vergangenen Jahr der Solidarpakt II und das Maßstäbegesetz, inkrafttretend am 01.01.2005, verabschiedet. Mit Hilfe dieses Gesetzespakets soll es nun möglich sein, die neuen Bundesländer bis zum Jahr 2020 an die alten heranzuführen.
Die vorliegende Arbeit soll das deutsche Finanzausgleichsystem mit seinen aktuell gültigen Regelungen darstellen und kritisch hinterfragen. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier der Frage, inwieweit es geeignet ist, das finanzielle Zusammenwachsen Deutschlands auszuhalten bzw. zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Finanzpolitische Reaktionen auf die Wiedervereinigung
- 1.1. Fonds „Deutsche Einheit“
- 1.2. Solidarpakt I
- 2. Geltendes Finanzausgleichsystem
- 2.1. Umsatzsteuervorwegausgleich
- 2.2. Länderfinanzausgleich im engeren Sinne
- 2.3. Bundesergänzungszuweisungen
- 3. Kritikpunkte und Reformvorschläge
- 3.1. Anforderungen an einen sinnvollen Finanzausgleich
- 3.2. Bestandsaufnahme
- 3.3. Reformoptionen
- 4. Zukunftsperspektive: Maßstäbegesetz und Solidarpakt II
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem deutschen Finanzausgleichssystem und dessen Eignung, das finanzielle Zusammenwachsen Deutschlands zu unterstützen. Ziel ist es, das aktuelle System darzustellen, seine Kritikpunkte zu beleuchten und mögliche Reformvorschläge zu präsentieren. Dabei wird ein Ausblick auf die zukünftige Finanzpolitik gegeben.
- Finanzpolitische Folgen der Wiedervereinigung
- Das aktuelle Finanzausgleichssystem
- Kritikpunkte am Finanzausgleichssystem
- Reformvorschläge und Optionen
- Zukunftsperspektive des Finanzausgleichs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Finanzausgleichs im deutschen Föderalstaat und skizziert die Problematik des finanziellen Zusammenwachsens nach der Wiedervereinigung. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den unmittelbaren finanzpolitischen Folgen der Wiedervereinigung und stellt den „Fonds Deutsche Einheit“ sowie den ersten Solidarpakt vor. Das zweite Kapitel erläutert die Funktionsweise des aktuellen Finanzausgleichssystems, inklusive Umsatzsteuervorwegausgleich, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen. Kapitel 3 analysiert Kritikpunkte am System und präsentiert verschiedene Reformvorschläge. Das vierte Kapitel bietet einen Ausblick auf die Zukunft des Finanzausgleichs mit dem Maßstäbegesetz und Solidarpakt II.
Schlüsselwörter
Finanzausgleich, Bundesrepublik Deutschland, Föderalismus, Wiedervereinigung, Solidarpakt, Reform, Maßstäbegesetz, finanzielle Leistungsfähigkeit, Bundesländer, finanzpolitische Zukunft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck des deutschen Finanzausgleichs?
Er soll die unterschiedliche Finanzkraft der Bundesländer ausgleichen, um überall in Deutschland vergleichbare Lebensverhältnisse und staatliche Leistungen zu ermöglichen.
Welche Rolle spielte der Solidarpakt nach der Wiedervereinigung?
Der Solidarpakt (I und II) war eine finanzielle „Krücke“, um die neuen Bundesländer an das Niveau der alten Länder heranzuführen und den Aufbau Ost zu finanzieren.
Aus welchen Stufen besteht das Finanzausgleichssystem?
Es umfasst den Umsatzsteuervorwegausgleich, den Länderfinanzausgleich im engeren Sinne sowie die Bundesergänzungszuweisungen.
Warum wird das aktuelle System oft kritisiert?
Kritiker bemängeln fehlende Anreize für Länder, eigene Einnahmen zu steigern, und die hohe Komplexität der Berechnungen.
Was regelt das Maßstäbegesetz?
Das Maßstäbegesetz legt die Kriterien fest, nach denen die finanziellen Mittel zwischen Bund und Ländern ab 2005 verteilt werden, um die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu sichern.
- Citation du texte
- Tim Kruschke (Auteur), 2002, Der Finanzausgleich - Zukunfts- oder Auslaufmodell?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11989