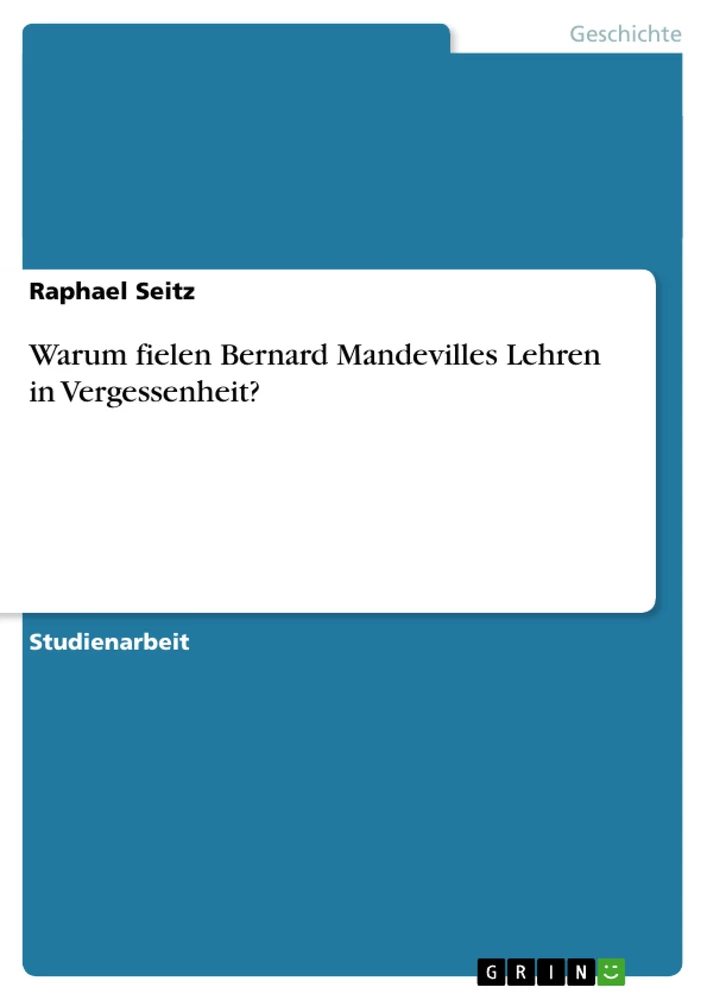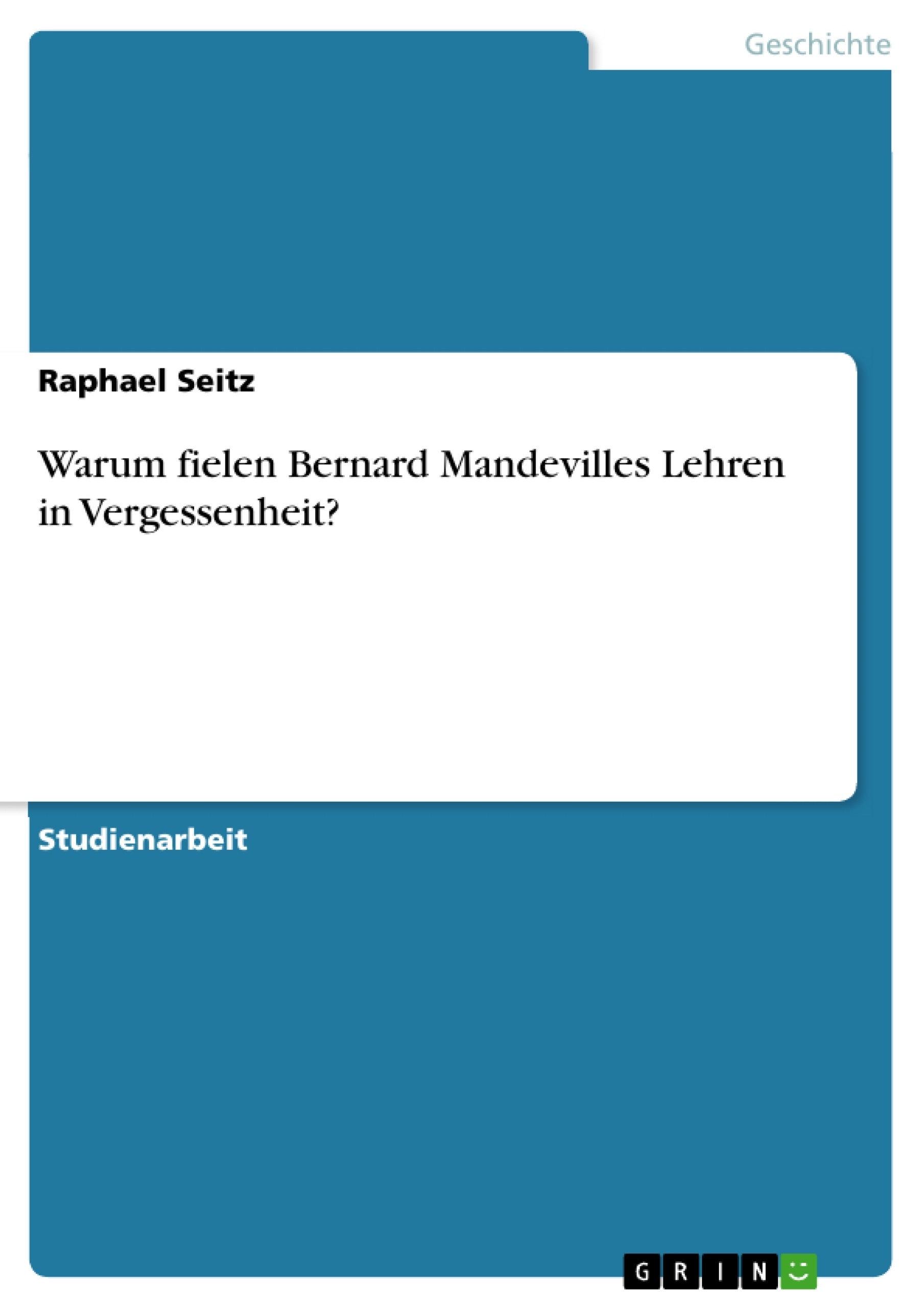Über Bernard Mandeville ist heutzutage nur noch wenig bekannt. In einer Zeit, in der die Gegensätze zwischen Arm und Reich in England immer größer wurden, sich der Kontrast zwischen wachsender Proletarisierung und Kriminalität einerseits und der Blütezeit der englischen Kultur und schönen Künste andererseits weiter verschärfte, wurde die Satire zum bevorzugten Stilmittel. Mandeville, der 1670 zunächst in Rotterdam geboren wurde und nach erfolgreichem Studienabschluss in Philosophie und Medizin, erst 1693 nach England übersiedelte, veröffentlichte 1705, zunächst anonym, sein bis heute bekanntestes Werk „Der unzufriedene Bienenstock“ als Satire. Da diese Sixpenny-Broschüre auf der einen Seite reißenden Absatz fand, er jedoch auf der anderen Seite die literarischen Kreise Londons mit dem zugrunde liegenden, tabulösen Thema gegen sich aufbrachte, wurden in den darauf folgenden Jahren, nun unter dem bis heute gebräuchlichen Titel „Die Bienenfabel, oder Private Laster, Öffentliche Vorteile“, weitere Auflagen herausgegeben. Diese versah Mandeville allerdings mit verschiedenen Essays und Anmerkungen zu fast jedem Vers der Fabel, die die eigentliche Grundlage seiner Gesellschaftskritik bildeten. Diese expliziten Ausführungen bezogen sich auf eine Art Gedicht oder Fabel in Reimform, das für sich alleine wohl kaum einen so hohen Aufmerksamkeitsfokus erreicht hätte.
In einem Bienenstock, der aber sehr wohl für die Menschheit (oder die Bevölkerung Englands) steht, herrschen Niederträchtigkeit, Betrug, Korruption und andere schlechte Dinge vor und doch gedeihen der Wohlstand und das Gesamtwohl der Bevölkerung. Ein jeder Bürger geht seinen privaten Lastern nach, die zusammen doch einen öffentlichen Nutzen hervorbringen: „Stolz, Luxus und Betrügerei / Muß sein, damit ein Volk gedeih“ (Mandeville [1724] 1980, S.92)
Von einem Moment zum anderen erkennt die Bevölkerung nun aber ihre eigene Sündhaftigkeit und führt ab sofort ein tugend- und ehrenhaftes Leben. Die Folgen daraus jedoch sind der allmähliche Zerfall des Wohlstands und der bestehenden Ordnung des Staates.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erklärung der Bienenfabel und Reaktionen
- Psychologische Verhaltensmuster
- Ursprung der sittlichen Tugend
- Eigenliebe und Selbsterhaltung in der menschlichen Natur
- Die Affinität zu Gesellschaft und Geselligkeit
- Ökonomische Betrachtung der Gesellschaft
- Voraussetzung für einen wohlhabenden Staat
- Mandevilles Plädoyer für die sozioökonomische Ungleichverteilung der Gesellschaft
- Schlussbemerkung: Würdigung für Mandevilles Mut
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das vergessene Werk von Bernard Mandeville, insbesondere seine berühmte Bienenfabel. Ziel ist es, Mandevilles Gesellschaftskritik zu analysieren und die Gründe für seine damalige und heutige relative Unbekanntheit zu ergründen. Die Arbeit beleuchtet seine psychologischen und ökonomischen Ansichten und deren Widerspruch zu den moralischen Normen seiner Zeit.
- Mandevilles Gesellschaftskritik in der Bienenfabel
- Die Rolle von privaten Lastern und öffentlichem Nutzen
- Psychologische Aspekte menschlichen Verhaltens und die Entstehung moralischer Normen
- Ökonomische Implikationen von Mandevilles Theorien
- Gründe für die Vergessenheit von Mandevilles Lehren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Leben und Werk von Bernard Mandeville ein und skizziert den Kontext seiner Gesellschaftskritik. Kapitel 2 erklärt die Bienenfabel und die heftigen Reaktionen darauf, die Mandeville teilweise vor Gericht brachten. Kapitel 3 analysiert Mandevilles psychologische Ansichten, insbesondere seine Kritik an der vermeintlichen Tugendhaftigkeit und der Rolle von Selbsttäuschung. Das vierte Kapitel befasst sich mit Mandevilles ökonomischen Theorien und seinen Ansichten zur sozioökonomischen Ungleichheit.
Schlüsselwörter
Bernard Mandeville, Bienenfabel, Gesellschaftskritik, Private Laster, Öffentliche Vorteile, Psychologie, Moral, Ökonomie, Sozioökonomische Ungleichheit, Tugend, Selbsttäuschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Bernard Mandevilles "Bienenfabel"?
Die Kernaussage lautet "Private Laster, öffentliche Vorteile" – Mandeville argumentiert, dass individueller Egoismus und Luxus den Wohlstand der gesamten Gesellschaft fördern.
Warum wurde Mandevilles Werk im 18. Jahrhundert als Tabubruch empfunden?
Weil er behauptete, dass nicht Tugend und Moral, sondern Untugenden wie Stolz und Betrug die Grundlage für wirtschaftliches Gedeihen und Fortschritt seien.
Was passiert im Bienenstock, als die Bienen plötzlich tugendhaft werden?
In der Fabel führt die plötzliche Ehrlichkeit zum wirtschaftlichen Niedergang, zum Verlust von Arbeitsplätzen und zum Zerfall der staatlichen Ordnung.
Welche psychologischen Ansichten vertrat Mandeville?
Er analysierte menschliches Verhalten als gesteuert durch Eigenliebe und Selbsterhaltungstrieb und sah moralische Normen oft als Ergebnis von gesellschaftlicher Dressur und Stolz.
Warum fielen Mandevilles Lehren weitgehend in Vergessenheit?
Seine radikale Ablehnung herkömmlicher Moralvorstellungen und sein Plädoyer für sozioökonomische Ungleichheit machten ihn zu einer umstrittenen Figur, deren Ansichten oft unterdrückt oder ignoriert wurden.
Wie hieß das Werk ursprünglich bei seiner Veröffentlichung 1705?
Es erschien zunächst anonym unter dem Titel "Der unzufriedene Bienenstock" (The Grumbling Hive).
- Citar trabajo
- Raphael Seitz (Autor), 2008, Warum fielen Bernard Mandevilles Lehren in Vergessenheit?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120054