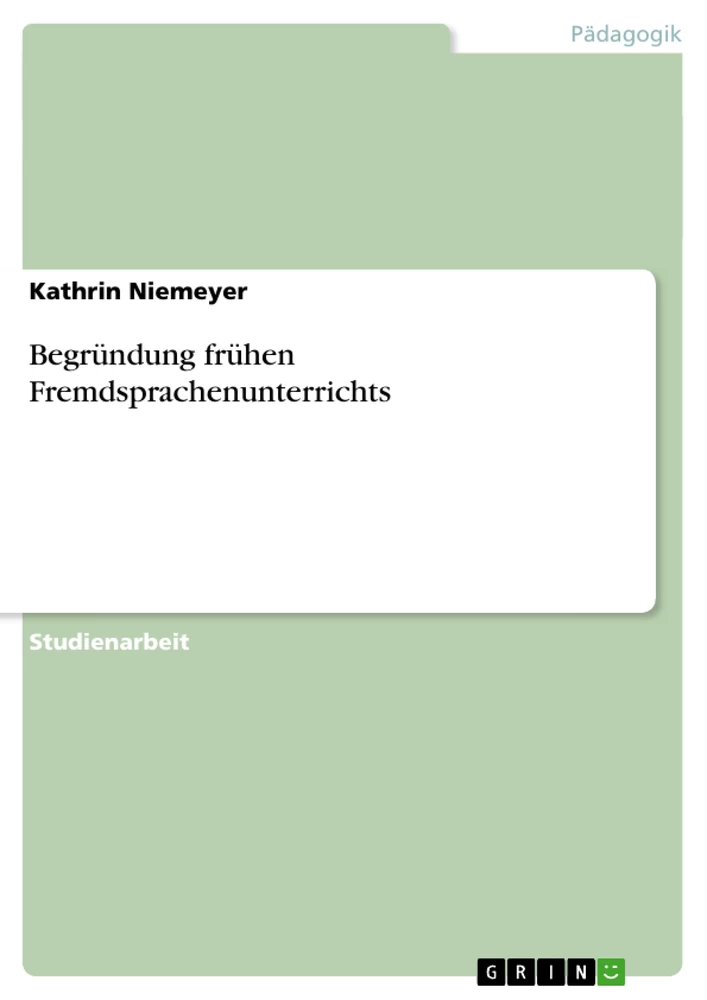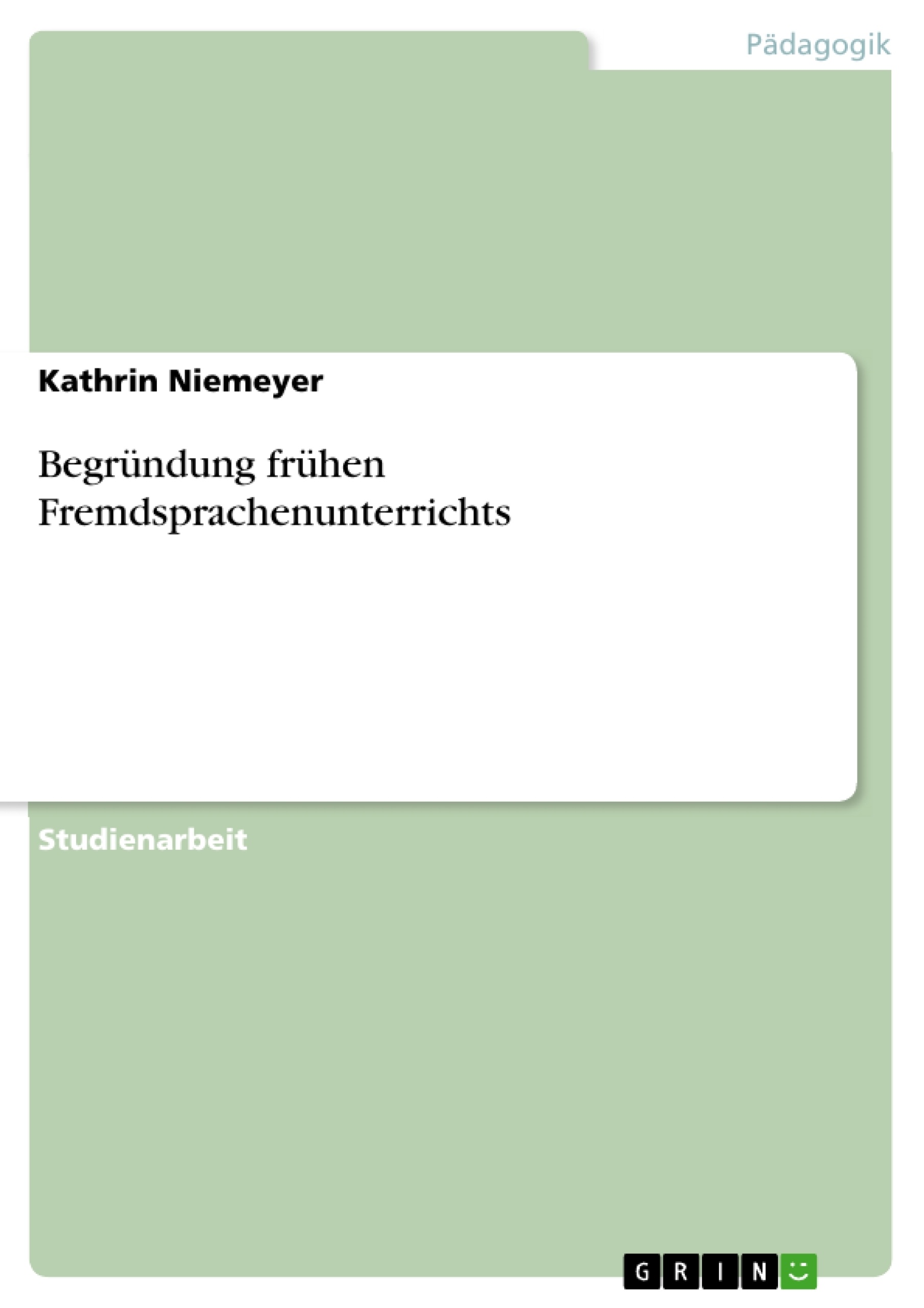Diese Arbeit analysiert aus gegebenem Anlass die Gründe, welche für einen frühen Fremdsprachenunterricht sprechen. Dabei werden (neuro-)physiologische und kognitive Faktoren ebenso berücksichtigt wie psychische und gesellschaftliche Aspekte. Darauf aufbauend werden pädagogische Konzepte dargestellt, welche sich aufgrund der dargestellten Zusammenhänge für den Einsatz in der Grundschule eignen. Der frühe Fremdsprachenunterricht hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Er ist inzwischen an den meisten öffentlichen deutschen Grundschulen eingeführt worden.
Englisch als „lingua franca“ gewinnt als eine internationale Verkehrssprache in einer globalisierten Welt eine zunehmende Bedeutung. Indem das Erlernen der Fremdsprache die Kommunikation zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern ermöglicht, kann sich die Bevölkerung dieser Länder zu einer europäischen Gemeinschaft vereinigen. Daneben profitiert auch der Einzelne in einer Gemeinschaft durch das lebenslange Erlernen von Fremdsprachen, indem er sich als ein aktives Mitglied in die Gemeinschaft einbringen kann. Deshalb wurde bereits 1995 die Bedeutung lebenslangen Fremdsprachenlernens vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat herausgestellt und in nachfolgenden Beschlüssen beständig wieder aufgegriffen. Damit war der Weg zur Umsetzung des frühen Fremdsprachenunterrichts in Deutschland bereitet. Indem Englisch in allen europäischen Ländern als erste Fremdsprache gelehrt und gelernt wird, erfolgt der frühe Fremdsprachenunterricht überwiegend in Englisch.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Empirische Befunde zum Spracherwerbsprozess
- Beschreibung des Spracherwerbsprozesses
- Faktoren, die den Spracherwerbsprozess beeinflussen
- Begründung frühen Fremdsprachenlernens
- Begründungen aufgrund (neuro-)physiologischer Faktoren
- Begründung aufgrund kognitiver Faktoren
- Begründung aufgrund psychologischer Faktoren
- Begründung aufgrund gesellschaftlicher Faktoren
- Konsequenzen für den Unterricht
- Konsequenzen aufgrund (neuro-)physiologischer Faktoren
- Konsequenzen aufgrund kognitiver Begründungen
- Konsequenzen aufgrund psychologischer Faktoren
- Konsequenzen aufgrund gesellschaftlicher Faktoren
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Begründung für frühen Fremdsprachenunterricht. Sie beleuchtet die empirischen Befunde zum Spracherwerbsprozess und analysiert die neurophysiologischen, kognitiven, psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die einen frühen Beginn unterstützen.
- Empirische Befunde zum Spracherwerbsprozess und seine Einflussfaktoren
- Neurophysiologische Begründungen für frühen Fremdsprachenunterricht
- Kognitive und psychologische Aspekte des frühen Fremdsprachenlernens
- Gesellschaftliche Relevanz des frühen Fremdsprachenunterrichts
- Didaktisch-methodische Konsequenzen für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die wachsende Bedeutung des frühen Fremdsprachenunterrichts in Deutschland. Das erste Kapitel beschreibt den Spracherwerbsprozess in seinen verschiedenen Phasen und benennt Einflussfaktoren. Kapitel zwei geht detailliert auf die neurophysiologischen, kognitiven, psychologischen und gesellschaftlichen Argumente für einen frühen Fremdsprachenbeginn ein. Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf und zeigen die Interdependenz der verschiedenen Einflussfaktoren.
Schlüsselwörter
Früher Fremdsprachenunterricht, Spracherwerbsprozess, (Neuro-)physiologische Faktoren, Kognitive Faktoren, Psychologische Faktoren, Gesellschaftliche Faktoren, Grundschule, Englisch, Empirische Befunde, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird ein früher Fremdsprachenunterricht in der Grundschule empfohlen?
Früher Fremdsprachenunterricht nutzt (neuro-)physiologische, kognitive und psychologische Vorteile von Kindern, um den Spracherwerbsprozess natürlicher und effektiver zu gestalten.
Welche Rolle spielt Englisch als „lingua franca“ in der heutigen Gesellschaft?
Englisch fungiert als internationale Verkehrssprache, die Kommunikation in einer globalisierten Welt ermöglicht und zur Vereinigung der europäischen Gemeinschaft beiträgt.
Welche Faktoren beeinflussen den Spracherwerbsprozess bei Kindern?
Neben neurophysiologischen Voraussetzungen spielen kognitive Fähigkeiten, psychologische Faktoren wie Motivation sowie das gesellschaftliche Umfeld eine entscheidende Rolle.
Gibt es spezifische pädagogische Konzepte für den frühen Fremdsprachenunterricht?
Ja, es werden Konzepte eingesetzt, die auf spielerischem Lernen und dem natürlichen Nachahmen basieren, um den Spracherwerb in der Grundschule optimal zu fördern.
Seit wann ist der Fremdsprachenunterricht an deutschen Grundschulen etabliert?
Nach Beschlüssen des Europäischen Parlaments im Jahr 1995 wurde der Weg für die Umsetzung bereitet; heute ist er an den meisten öffentlichen Grundschulen in Deutschland Standard.
Was sind die didaktischen Konsequenzen aus den neurophysiologischen Befunden?
Der Unterricht muss so gestaltet sein, dass er die hohe Plastizität des kindlichen Gehirns nutzt, oft durch immersive Methoden und eine hohe Frequenz an Sprachkontakt.
- Citation du texte
- Kathrin Niemeyer (Auteur), 2005, Begründung frühen Fremdsprachenunterrichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120471