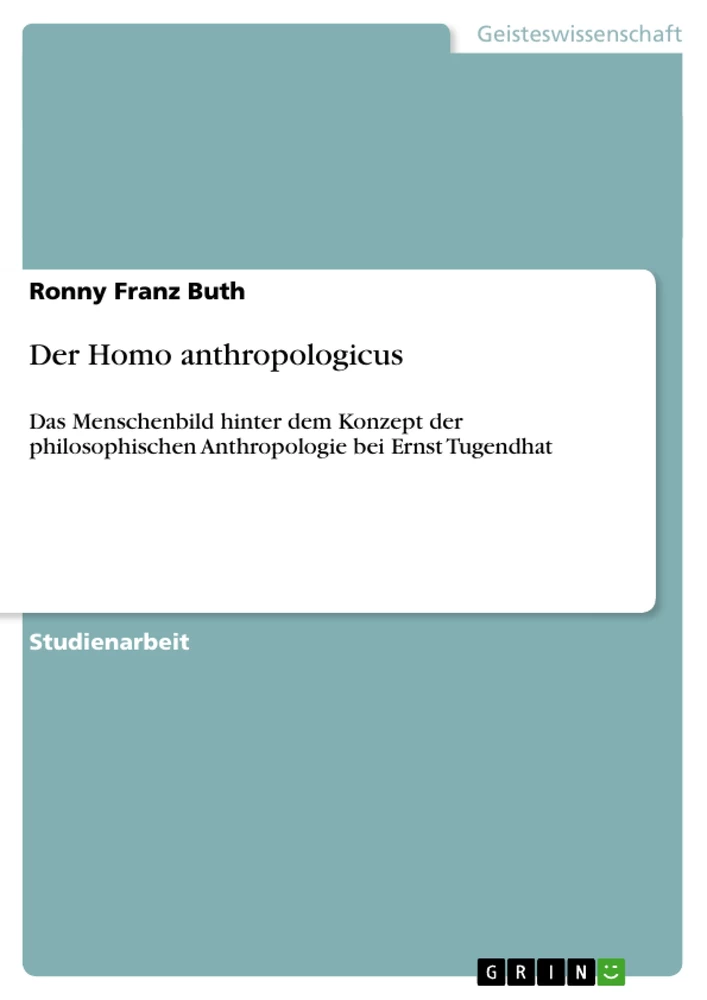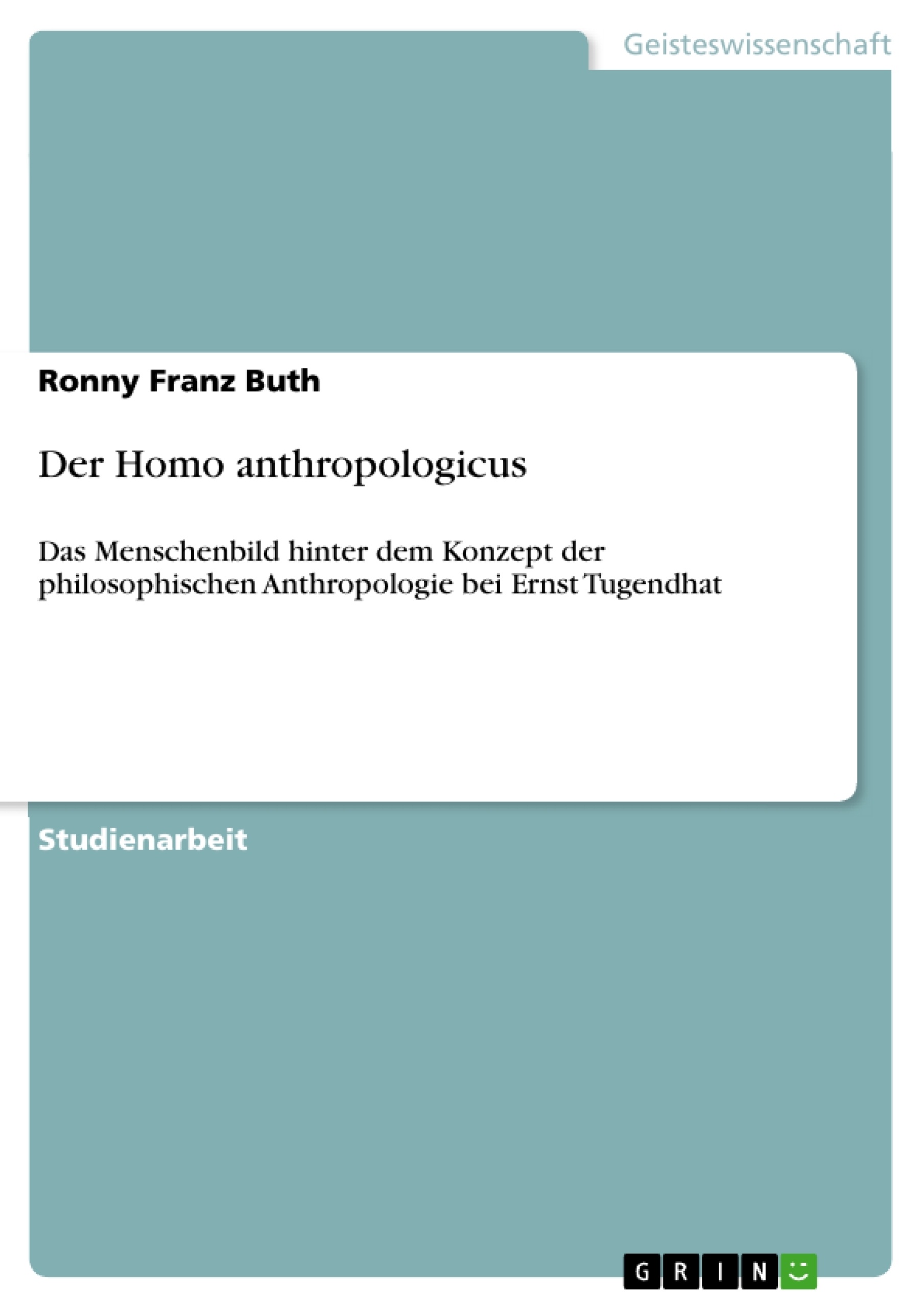Kulturelle Schlüsselbegriffe wie „Individualität“ und „Selbstfindung“ sind Indikatoren einer Gesellschaft, die sich von absolut gesetzten, autoritären Lebensmustern gelöst hat und in der ein jeder nach seinem persönlichen Lebensheil strebt. Diesbezügliche religiöse bzw. traditionelle Antworten, die sich in den letzten Jahrtausenden herausbildeten und vorherrschten, haben erheblich an Glaubwürdigkeit verloren, da sie dem langsam angewachsenen Primat der Vernunft nicht mehr standhalten konnten. Doch durch das Wegbrechen alter Erklärungsansätze entstand ein moralisches Vakuum, gekennzeichnet durch einen absoluten Werterelativismus, der zu einer Orientierungslosigkeit und einem starken Sinn-Bedürfnis führte. Wonach soll man sich richten bzw. welchem Vorbild folgen? Auf welcher Grundlage lässt sich ein Leben führen, das weder traditionsverfälscht, noch an höheren Mächten orientiert ist, sondern sich allein auf den Menschen beruft? Die Frage nach dem spezifisch menschlichen Wesen stellt sich daraufhin unausweichlich, denn nichts könnte besser als Ausgangspunkt für begründete Antworten dienen. Ein Grundkonsens über das Wesen des Menschen scheint damit als Richtschnur beim Aufbau eines säkularisierten Seins, aber auch Miteinanders unabdingbar. Sollte dieses Vorhaben gelingen, wird der Mensch zum selbstverantwortlichen Architekten seiner Umwelt, Geschichte und Identität, im individuellen wie im universellen Sinne.
Großen Anteil an dieser Unternehmung hat der Philosoph Ernst Tugendhat. Seit mehreren Jahren macht er den Menschen zum Thema seiner Arbeit und betreibt eine philosophische Anthropologie, die nach neuen, fundierten Antworten sucht. In seinem Aufsatz „Anthropologie als erste Philosophie“ bezieht sich Tugendhat direkt auf dieses Thema und versucht, über eine analytische Wesensbestimmung des Menschen, eine Antwort auf die Möglichkeit eines guten Lebens zu geben. Die Frage „Was sind wir als Menschen?“, die er als den zentralen Kern der Philosophie ansieht, gewinnt für ihn eine neue Aktualität und wird zum Ausgangspunkt für das heutige und zukünftige Menschsein.
Das Ziel dieser Hausarbeit besteht darin, Tugendhats fragmentarische Ausführungen zum Wesen des Menschen aus mehreren seiner Texte zusammenzutragen und anschließend komprimiert, allein mit dem Fokus auf das sich daraus ergebende Menschenbild darzustellen, da dies so bislang nicht existiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Philosophische Anthropologie bei Tugendhat
- Der philosophisch-anthropologische Mensch
- Der rationale Reflektierer
- Der Geerdete
- Der Getriebene
- Der Schöpfer
- Der Mystiker/ der Fühlende
- Schlussbetrachtungen
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, Ernst Tugendhats Auffassungen zum Wesen des Menschen aus verschiedenen Texten zusammenzufassen und daraus ein komprimiertes Menschenbild zu entwickeln. Es soll untersucht werden, wie Tugendhat seine Analyse durchführt, welche Voraussetzungen er nutzt und zu welchen Ergebnissen er gelangt. Abschließend erfolgt eine kritische Bewertung der Ergebnisse und Prüfung möglicher Alternativen.
- Tugendhats philosophische Anthropologie als naturalistisch-aufgeklärter Ansatz
- Die zentralen Fragen "Was sind wir als Menschen?" und "Wie ist es gut zu leben?"
- Die verschiedenen Facetten des philosophisch-anthropologischen Menschen bei Tugendhat
- Die Rolle von Vernunft und Emotion im Menschenbild
- Kritische Auseinandersetzung mit Tugendhats Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, ausgehend von der Auflösung traditioneller Werte und der daraus resultierenden Suche nach einem neuen, auf den Menschen selbst bezogenen Verständnis von Moral und gutem Leben. Tugendhats philosophische Anthropologie wird als relevanter Beitrag zu dieser Suche vorgestellt.
Philosophische Anthropologie bei Tugendhat: Dieses Kapitel charakterisiert Tugendhats Ansatz als naturalistisch-aufgeklärte Philosophie, die auf einer rationalen und empirischen Analyse des menschlichen Wesens basiert. Es wird auf die historischen Vorläufer und die zentrale Bedeutung der Fragen nach dem menschlichen Wesen und dem guten Leben eingegangen.
Der philosophisch-anthropologische Mensch: Dieser Abschnitt beginnt mit der Frage nach der Selbstverständnisses des Menschen in einer säkularisierten Welt. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten des Menschen nach Tugendhat, ohne jedoch bereits auf detaillierte Schlussfolgerungen einzugehen.
Schlüsselwörter
Philosophische Anthropologie, Ernst Tugendhat, Menschliches Wesen, Naturalismus, Aufklärung, Vernunft, Emotion, Säkularisierung, Gutes Leben, Selbstfindung, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der philosophischen Anthropologie bei Tugendhat?
Tugendhat sucht nach fundierten Antworten auf die Frage „Was sind wir als Menschen?“, um in einer säkularisierten Welt eine Grundlage für ein gutes Leben und moralisches Handeln zu finden.
Wie definiert Tugendhat den Menschen?
Er beschreibt den Menschen als ein Wesen mit verschiedenen Facetten: als rationalen Reflektierer, als Geerdeten, Getriebenen, Schöpfer und fühlendes Wesen (Mystiker).
Warum ist Tugendhats Ansatz „naturalistisch-aufgeklärt“?
Sein Ansatz beruht auf einer rationalen und empirischen Analyse des menschlichen Wesens, ohne sich auf höhere Mächte oder bloße Traditionen zu berufen.
Welche Rolle spielt die Reflexion im Menschenbild?
Der Mensch wird als „rationaler Reflektierer“ gesehen, der durch Selbsthinterfragung zum Architekten seiner eigenen Identität und Umwelt wird.
Was bedeutet „moralisches Vakuum“ in diesem Kontext?
Es bezeichnet die Orientierungslosigkeit, die durch das Wegbrechen traditioneller religiöser Erklärungsansätze entstanden ist und durch eine neue Bestimmung des Menschseins gefüllt werden soll.
- Citation du texte
- Ronny Franz Buth (Auteur), 2007, Der Homo anthropologicus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120472