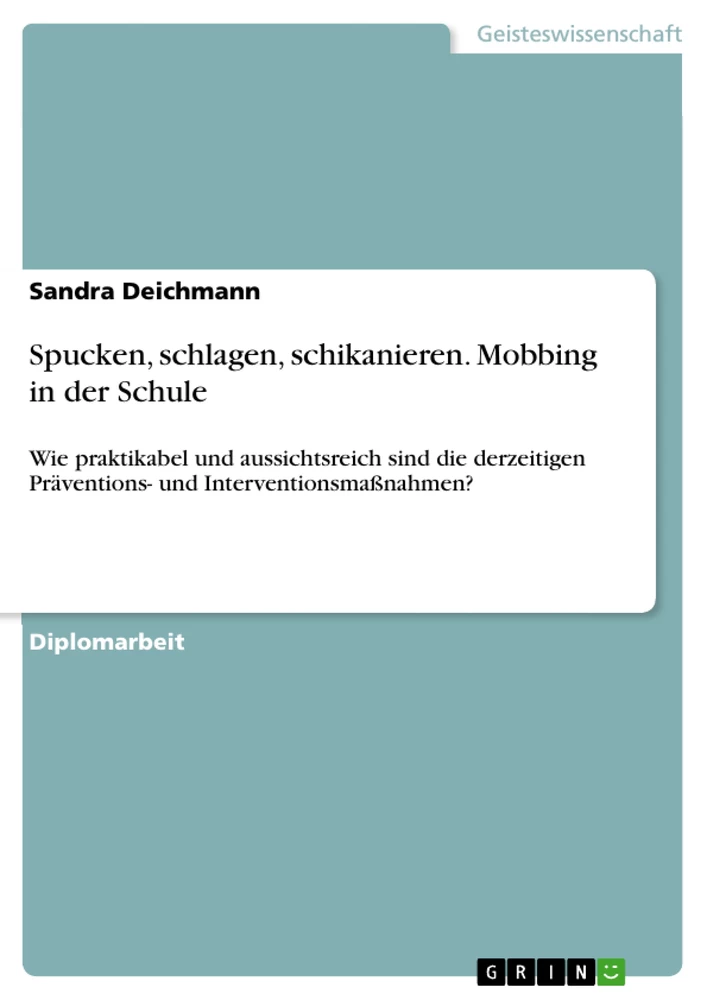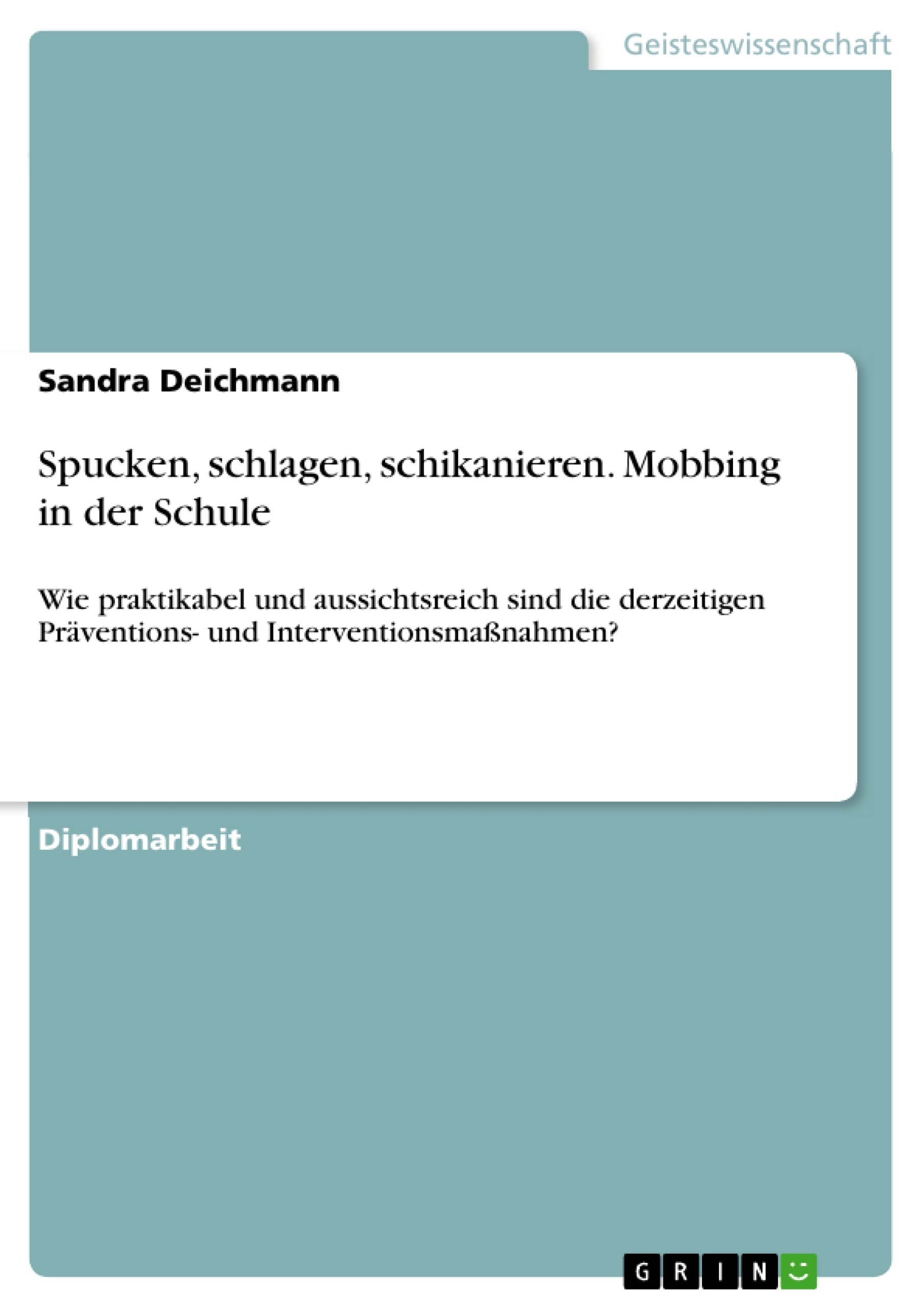Um Mobbing erfolgreich vorzubeugen oder in akuten Fällen wirksam intervenieren zu können, ist die umfassende Auseinandersetzung mit der Thematik
sowie den verfügbaren Präventions- und Interventionsansätzen eine unbedingte
Voraussetzung. Dies gestaltet sich allerdings durchaus nicht einfach, denn zahlreiche populärwissenschaftliche Texte streuen wissenschaftlich nicht gesicherte oder nicht haltbare Informationen und sorgen dadurch für reichlich Unklarheit.
Die vorliegende Arbeit möchte nicht nur dazu beitragen, wesentliche Informationen aus der Fülle der Mobbingliteratur und weiterer Quellen herauszufiltern, sondern die Leser selbst zu Experten machen, die in der Lage sind, die Problematik sowie die diversen Präventions- und Interventionsmaßnahmen selbst kritisch zu reflektieren.
In fünf Kapiteln werden zunächst die wesentlichen Eigenschaften der Mobbingproblematik und Erkenntnisse des aktuellen Forschungsstands sowie die wichtigsten Präventions- und Interventionsansätze vorgestellt. Sämtliche Maßnahmen, die in den beiden Kapiteln zu Prävention und Intervention beschrieben sind, werden direkt im Anschluss einer differenzierten Bewertung unterzogen. Jeweils am Ende dieser Kapitel, die den Kern der Arbeit bilden, finden sich übersichtliche Gegenüberstellungen aller erwähnten Konzepte sowie Ausführungen über die Rückschlüsse, die diese Vergleiche zulassen.
In diesem Zusammenhang wird auch ein eigenes Modell vorgestellt, das Lehrern, aber auch anderen Berufsgruppen, die mit Schülermobbing konfrontiert werden, eine Hilfestellung bei der Vorgehensweise in akuten Mobbingfällen bieten soll. Nicht zuletzt durch dieses Modell, sondern gleichsam durch einige zusätzliche Aspekte leistet diese Diplomarbeit einen interessanten Beitrag zur kontemporären Mobbingforschung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Grundlagen der Mobbingforschung
- 1.1 Etymologie des Mobbingbegriffs
- 1.2 Definitionen und Begünstigungsfaktoren von Aggression, Gewalt, Viktimisierung und Mobbing
- 1.3 Prävalenz der Mobbingproblematik
- 1.4 Erklärungsansätze zur Entstehung von Mobbing
- 1.5 Phasen im Mobbingprozess und Dynamikentwicklung
- 1.6 Rollen im Mobbingverlauf und ihre Stabilität
- 1.7 Rollenstereotype bei Tätern und Opfern
- 1.8 Arten und Folgen der Mobbingerfahrungen für die Beteiligten
- 1.9 Funktion der Eltern und Lehrer im Mobbinggeschehen
- 1.10 Rechtliche Aspekte
- 1.11 Zusammenfassung
- 2 Präventionsmaßnahmen
- 2.1 Präventionspädagogik als unspezifische Präventionsform
- 2.1.1 Aggressionstheorien als Grundlage
- 2.1.2 Die Bedeutung von Regeln
- 2.1.3 Soziale Kompetenzen
- 2.1.4 Gemeinsame Werte
- 2.1.5 Schulhauskultur
- 2.1.6 Präventionspädagogik als besondere Herausforderung
- 2.2 Grundelemente der Mobbingprävention
- 2.3 Methodische Elemente zur spezifischen Prävention im Unterricht
- 2.3.1 Literatur - drei exemplarische Darstellungen
- 2.3.1.1 Kirsten Boie: „,,Nicht Chicago. Nicht hier”
- 2.3.1.2 Michael Gutzschhahn: „,,Betreten verboten”
- 2.3.1.3 Bettina Mainberger: „Jede Menge Zoff - Was tun gegen Mobbing und Gewalt?”
- 2.3.2 Film „Wer küsst schon einen Leguan?”
- 2.3.3 Selbsterfahrung
- 2.3.3.1 Fragebogen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung
- 2.3.3.2 Rollenspiel / Theater
- 2.3.1 Literatur - drei exemplarische Darstellungen
- 2.4 Präventionsprogramme
- 2.4.1 Das Berner Gewaltpräventionsprogramm Be-Prox
- 2.4.2 Das Modell „Konflikt-KULTUR”
- 2.5 Nachhaltigkeit der Präventionsmaßnahmen
- 2.5.1 Allgemeine Kriterien zur nachhaltigen Wirkung von Prävention
- 2.5.2 Welchen Erfolg versprechen die vorgestellten Ansätze im Hinblick auf die Wirksamkeitskriterien?
- 2.5.3 Wie könnte ein nachhaltiges Präventionskonzept aussehen?
- 2.6 Grenzen der Mobbingprävention
- 2.7 Zusammenfassung
- 2.1 Präventionspädagogik als unspezifische Präventionsform
- 3 Interventionsansätze
- 3.1 Handlungsalternativen des Mobbingopfers
- 3.2 Interventionen der Eltern
- 3.3 Interventionsansätze für Lehrkräfte
- 3.3.1 Außenseiterintegration ohne Thematisierung des Mobbings
- 3.3.2 Einzel- und Elterngespräche
- 3.3.3 Klassengespräche mit Thematisierung des Mobbingfalles
- 3.3.4 Mediation
- 3.3.5 Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)
- 3.3.6 Olweus-Interventionsprogramm
- 3.3.7 No Blame Support Group Approach To Bullying
- 3.3.8 Schulwechsel von Täter oder Opfer
- 3.4 Intervention externer Fachkräfte
- 3.5 Praktikabilität und Erfolgsaussichten der einzelnen Ansätze im Überblick
- 3.6 Vielversprechende Kombinationsmöglichkeiten
- 3.7 Grenzen der Interventionsmöglichkeiten
- 3.8 Zusammenfassung
- 4 Regionalraumstudie
- 4.1 Allgemeine Informationen über den Landkreis Sigmaringen
- 4.2 Der untersuchte Regionalraum und die befragten Schulen
- 4.3 Das Kinoprojekt zur Mobbingprävention als Grundlage dieser Studie
- 4.4 Einflussfaktoren und Grundgedanken
- 4.5 Dokumentation der Durchführung
- 4.6 Ergebnisse der Studie
- 4.7 Auswertung und Interpretation der Studie in Bezug zum aktuellen Forschungsstand
- 4.8 Kritische Betrachtung
- 4.9 Zusammenfassung
- 5 Forschungszusammenhang
- 5.1 Induktive Lösungsansätze für einen besseren Umgang mit Mobbingsituationen unter Schülern
- 5.2 Ein Modell für Lehrkräfte zur Vorgehensweise im akuten Mobbingfall
- 5.3 Perspektiven der Mobbingprävention und -intervention in Anbetracht der Studienergebnisse
- 5.4 Beitrag der Gesamtarbeit zur Mobbingforschung
- 5.5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Praktikabilität und den Erfolg bestehender Präventions- und Interventionsmaßnahmen gegen Mobbing an Schulen. Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze und evaluiert deren Wirksamkeit.
- Analyse bestehender Mobbingforschung
- Bewertung von Präventionsmaßnahmen an Schulen
- Untersuchung verschiedener Interventionsansätze
- Auswertung einer Regionalraumstudie zum Thema Mobbing
- Entwicklung von Lösungsansätzen für den Umgang mit Mobbing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Mobbing ein. Kapitel 1 bietet einen Überblick über die Grundlagen der Mobbingforschung, einschließlich Definitionen, Prävalenz und Erklärungsansätze. Kapitel 2 befasst sich mit Präventionsmaßnahmen, darunter verschiedene pädagogische Ansätze und Programme. Kapitel 3 analysiert diverse Interventionsstrategien für Opfer, Eltern und Lehrkräfte. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse einer Regionalraumstudie, die den praktischen Umgang mit Mobbing in einer bestimmten Region untersucht. Kapitel 5 beleuchtet den Forschungszusammenhang und diskutiert Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Mobbing, Schule, Prävention, Intervention, Gewalt, Aggression, Viktimisierung, Regionalraumstudie, Präventionsprogramme, Interventionsansätze, Lehrkräfte, Eltern, Schüler.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Mobbing in der Schule?
Mobbing ist ein systematisches, über einen längeren Zeitraum anhaltendes Schikanieren, Ausgrenzen oder Demütigen eines Schülers durch einen oder mehrere andere Schüler.
Was ist der "No Blame Approach"?
Ein Interventionsansatz, der auf Schuldzuweisungen verzichtet und stattdessen eine Unterstützungsgruppe bildet, um das Problem gemeinsam zu lösen.
Welche Rollen gibt es im Mobbingprozess?
Neben Tätern und Opfern gibt es Mitläufer, Verstärker, unbeteiligte Zuschauer und potenzielle Verteidiger des Opfers.
Wie können Lehrer bei akutem Mobbing vorgehen?
Die Arbeit schlägt ein Modell vor, das Einzelgespräche, Klassenthematisierungen und gegebenenfalls Mediation oder Täter-Opfer-Ausgleich umfasst.
Welche langfristigen Folgen hat Mobbing?
Für Opfer kann es zu Depressionen, Schulangst und psychosomatischen Beschwerden führen; auch Täter verfestigen oft antisoziale Verhaltensmuster.
- Citar trabajo
- Sandra Deichmann (Autor), 2007, Spucken, schlagen, schikanieren. Mobbing in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120730