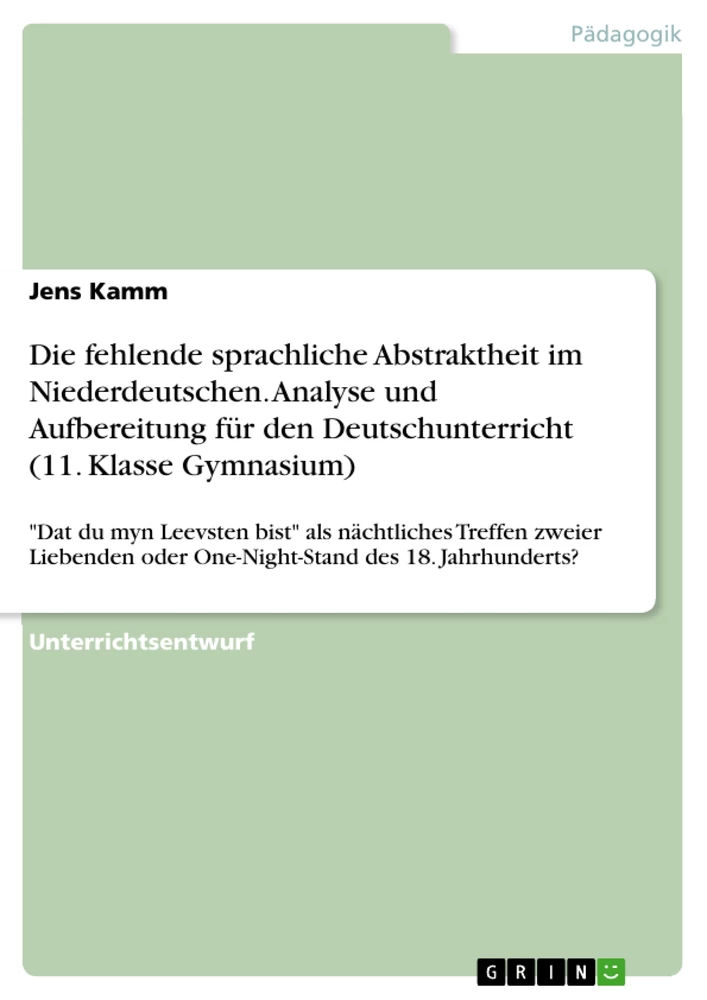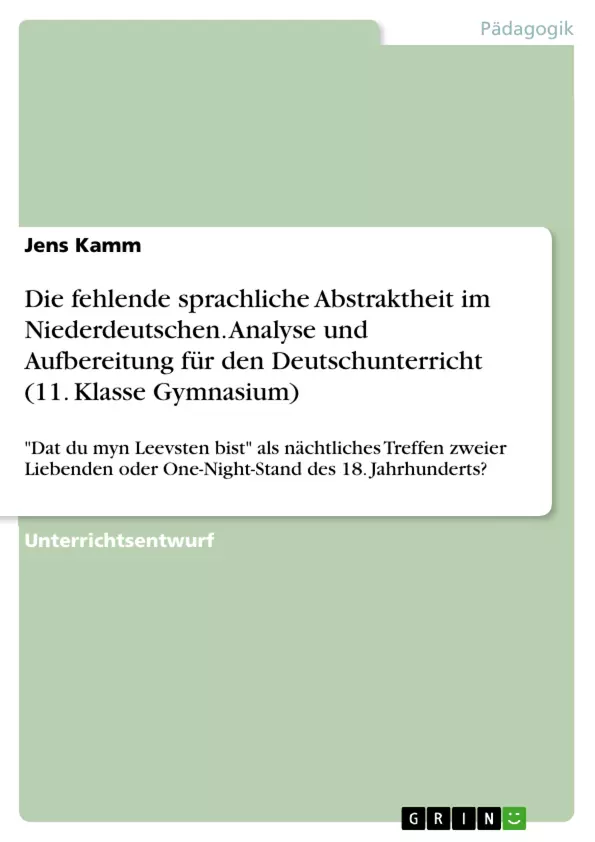Die Hausarbeit setzt sich mit der fehlenden Abstraktionsfähigkeit im Niederdeutschen auseinander und bereitet das Thema für eine 11. Klasse eines Gymnasiums auf. Dies wird in einem Vergleich der oralen niederdeutschen Dichtung mit der Bildungssprache Hochdeutsch dargestellt. Dazu wird das Volkslied "Dat du min Leevsten büst" mit Goethes Gedicht "Willkommen und Abschied" verglichen und erörtert, ob es einen Zusammenhang zwischen der fehlenden sprachlichen Abstraktheit des Niederdeutschen und der Einordnung von "Dat du min Leevsten büst" als erotisches Volkslied gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachentwicklung vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen
- Sprachliche Abstraktheit im gesellschaftlichen Kontext
- Sprachliche Abstraktheit in lyrischen Texten
- Dat du min Leevsten büst versus Willkommen und Abschied
- Willkommen und Abschied
- Dat du min Leevsten büst
- Historische Einordnung
- Schlumper-Liedchen
- Schriftliche Veröffentlichungen
- Erotische Anspielungen?
- Inhaltliche Rezeption
- Segg my wo du heest
- Fazit
- Darstellung des geplanten Unterrichts
- Lernziele
- Lerngruppenbeschreibung
- Didaktische Überlegungen
- Bisheriger Unterricht /Einbettung in den Unterrichtsverlauf
- Sachanalyse und methodische Überlegungen
- Einstieg
- Erarbeitung I und Zwischenreflexion
- Erarbeitung II und Zwischenreflexion
- Erarbeitung III und Zwischenreflexion
- Transfer
- Didaktische Reserve bzw. Hausaufgabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die fehlende sprachliche Abstraktheit im Niederdeutschen im Vergleich zum Hochdeutschen. Ziel ist es, anhand eines Unterrichtsvorhabens für die Jahrgangsstufe 11 eines Gymnasiums zu erörtern, ob diese fehlende Abstraktheit einen Einfluss auf die Rezeption und Einordnung des niederdeutschen Volksliedes „Dat du min Leevsten büst“ als erotisches Lied hat. Der Vergleich mit Goethes „Willkommen und Abschied“ soll dabei helfen, sprachliche Unterschiede und deren gesellschaftlichen Kontext zu beleuchten.
- Sprachentwicklung vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen
- Sprachliche Abstraktheit als linguistisches Phänomen
- Vergleichende Analyse von „Dat du min Leevsten büst“ und „Willkommen und Abschied“
- Didaktische Konzepte für den Umgang mit niederdeutscher Literatur im Unterricht
- Der Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf sprachliche Entwicklung und Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass die fehlende sprachliche Abstraktheit des Niederdeutschen zu seinem Rückgang gegenüber dem Hochdeutschen beigetragen hat. Dies wird anhand eines Vergleichs des niederdeutschen Volksliedes „Dat du min Leevsten büst“ mit Goethes „Willkommen und Abschied“ und einem geplanten Unterrichtsvorhaben für die Jahrgangsstufe 11 erörtert. Goethes Zitat über die „sinnliche Sicherheit“ des Niederdeutschen wird als Ausgangspunkt verwendet, um die Problematik der fehlenden Abstraktion zu beleuchten und deren mögliche Konsequenzen für die sprachliche und literarische Entwicklung zu untersuchen.
Sprachentwicklung vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Prozess, der zum Rückgang des Niederdeutschen und zur Dominanz des Hochdeutschen führte. Es wird der Einfluss des Niedergangs der Hanse auf die Verwendung des Niederdeutschen als Schriftsprache thematisiert und die Frage aufgeworfen, inwieweit die fehlende Abstraktheit des Niederdeutschen zusätzlich zu diesem Prozess beigetragen haben könnte. Der Fokus liegt auf der Verschiebung von einer überregionalen Schriftsprache hin zu einer regional begrenzten Umgangssprache.
Sprachliche Abstraktheit im gesellschaftlichen Kontext: Der Begriff „Abstraktion“ wird definiert und im Kontext der Sprachentwicklung erläutert. Es wird gezeigt, wie sprachliche Abstraktion komplexe Sachverhalte darstellen und interpretieren ermöglicht und wie der Mangel an Abstraktion die Möglichkeiten der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit einschränkt. Der gesellschaftliche Kontext, in dem sich Hochdeutsch und Niederdeutsch entwickelten, wird in Bezug auf die Notwendigkeit sprachlicher Abstraktion betrachtet.
Sprachliche Abstraktheit in lyrischen Texten: Dieses Kapitel begründet die Wahl lyrischer Texte für den Vergleich. Es wird die Bedeutung lyrischer Sprache für die Entwicklung von Bildungssprachlichkeit hervorgehoben und die Eignung der Liebeslyrik zur Untersuchung der Darstellung zwischenmenschlicher Beziehungen in unterschiedlichen Epochen und gesellschaftlichen Kontexten betont. Die methodische Vorgehensweise des Vergleichs von „Dat du min Leevsten büst“ und „Willkommen und Abschied“ wird vorbereitet.
Darstellung des geplanten Unterrichts: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den geplanten Unterricht zum Thema. Es werden die Lernziele definiert, die Lerngruppe charakterisiert und didaktische Überlegungen zum Unterrichtsverlauf, den Methoden und der Sachanalyse vorgestellt. Die einzelnen Phasen des Unterrichts (Einstieg, Erarbeitung, Transfer etc.) werden mit methodischen Hinweisen konkretisiert. Das Kapitel zeigt ein strukturiertes und methodisch fundiertes Unterrichtskonzept.
Schlüsselwörter
Niederdeutsch, Hochdeutsch, Sprachentwicklung, sprachliche Abstraktheit, Liebeslyrik, „Dat du min Leevsten büst“, „Willkommen und Abschied“, Goethe, Unterrichtsvorhaben, Didaktik, literarische Analyse, gesellschaftlicher Kontext, orale Dichtung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Sprachliche Abstraktheit im Vergleich von Niederdeutsch und Hochdeutsch
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss fehlender sprachlicher Abstraktheit im Niederdeutschen im Vergleich zum Hochdeutschen. Der Fokus liegt auf der Rezeption des niederdeutschen Volksliedes „Dat du min Leevsten büst“ und dessen Vergleich mit Goethes „Willkommen und Abschied“, um die Auswirkungen auf die Interpretation und Einordnung als erotisches Lied zu beleuchten.
Welche Texte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das niederdeutsche Volkslied „Dat du min Leevsten büst“ mit Goethes Gedicht „Willkommen und Abschied“. Der Vergleich dient dazu, die Unterschiede in der sprachlichen Abstraktheit und deren Auswirkungen auf die Interpretation der Texte zu analysieren.
Welche Aspekte der sprachlichen Abstraktheit werden untersucht?
Die Arbeit untersucht, wie die sprachliche Abstraktheit (oder deren Fehlen) die Möglichkeiten der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit beeinflusst und wie dies den gesellschaftlichen Kontext und die Rezeption der Texte prägt. Es wird der Einfluss auf die Interpretation von „Dat du min Leevsten büst“ als erotisches Lied erörtert.
Wie wird der Vergleich der Texte durchgeführt?
Der Vergleich erfolgt anhand einer literarischen und linguistischen Analyse der beiden Gedichte. Es werden die sprachlichen Mittel, der Ausdruck von Emotionen und die gesellschaftlichen Kontexte der Entstehung der Texte betrachtet.
Welche Rolle spielt die Sprachentwicklung vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Sprachentwicklung und untersucht, ob die fehlende Abstraktheit im Niederdeutschen zu dessen Rückgang gegenüber dem Hochdeutschen beigetragen hat. Der Einfluss des Niedergangs der Hanse und die Verschiebung von einer überregionalen Schriftsprache zu einer regional begrenzten Umgangssprache werden thematisiert.
Was ist der Zweck des geplanten Unterrichts?
Der geplante Unterricht für die Jahrgangsstufe 11 soll den Schülerinnen und Schülern die Unterschiede zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch verdeutlichen und die Bedeutung sprachlicher Abstraktheit im literarischen Kontext veranschaulichen. Er dient als praktisches Beispiel für die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse der Arbeit.
Welche didaktischen Methoden werden im geplanten Unterricht eingesetzt?
Das Kapitel „Darstellung des geplanten Unterrichts“ beschreibt detailliert die didaktischen Überlegungen, Lernziele und methodischen Ansätze. Es werden die einzelnen Phasen des Unterrichts (Einstieg, Erarbeitung, Transfer etc.) mit methodischen Hinweisen konkretisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Niederdeutsch, Hochdeutsch, Sprachentwicklung, sprachliche Abstraktheit, Liebeslyrik, „Dat du min Leevsten büst“, „Willkommen und Abschied“, Goethe, Unterrichtsvorhaben, Didaktik, literarische Analyse, gesellschaftlicher Kontext, orale Dichtung.
Welche Hypothese wird in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass die fehlende sprachliche Abstraktheit des Niederdeutschen zu seinem Rückgang gegenüber dem Hochdeutschen beigetragen hat und Einfluss auf die Interpretation von „Dat du min Leevsten büst“ hat.
Welche gesellschaftlichen Faktoren werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den gesellschaftlichen Kontext, in dem sich Hochdeutsch und Niederdeutsch entwickelten und wie dieser die Notwendigkeit und den Gebrauch sprachlicher Abstraktion beeinflusst hat. Der Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf die sprachliche Entwicklung und Rezeption wird untersucht.
- Quote paper
- Jens Kamm (Author), 2022, Die fehlende sprachliche Abstraktheit im Niederdeutschen. Analyse und Aufbereitung für den Deutschunterricht (11. Klasse Gymnasium), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1216212