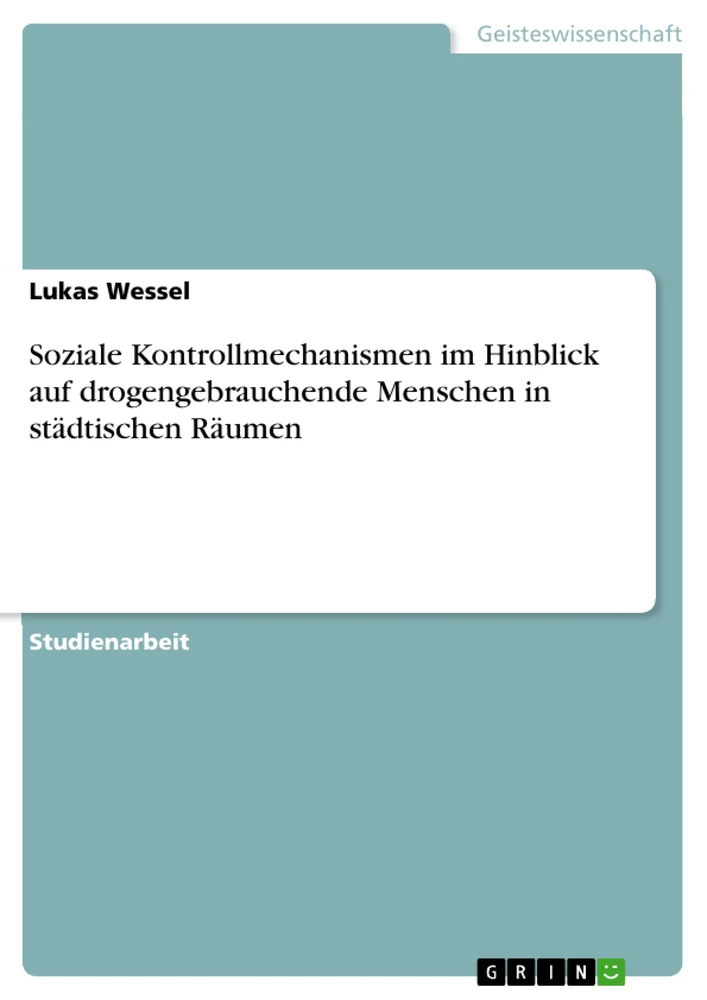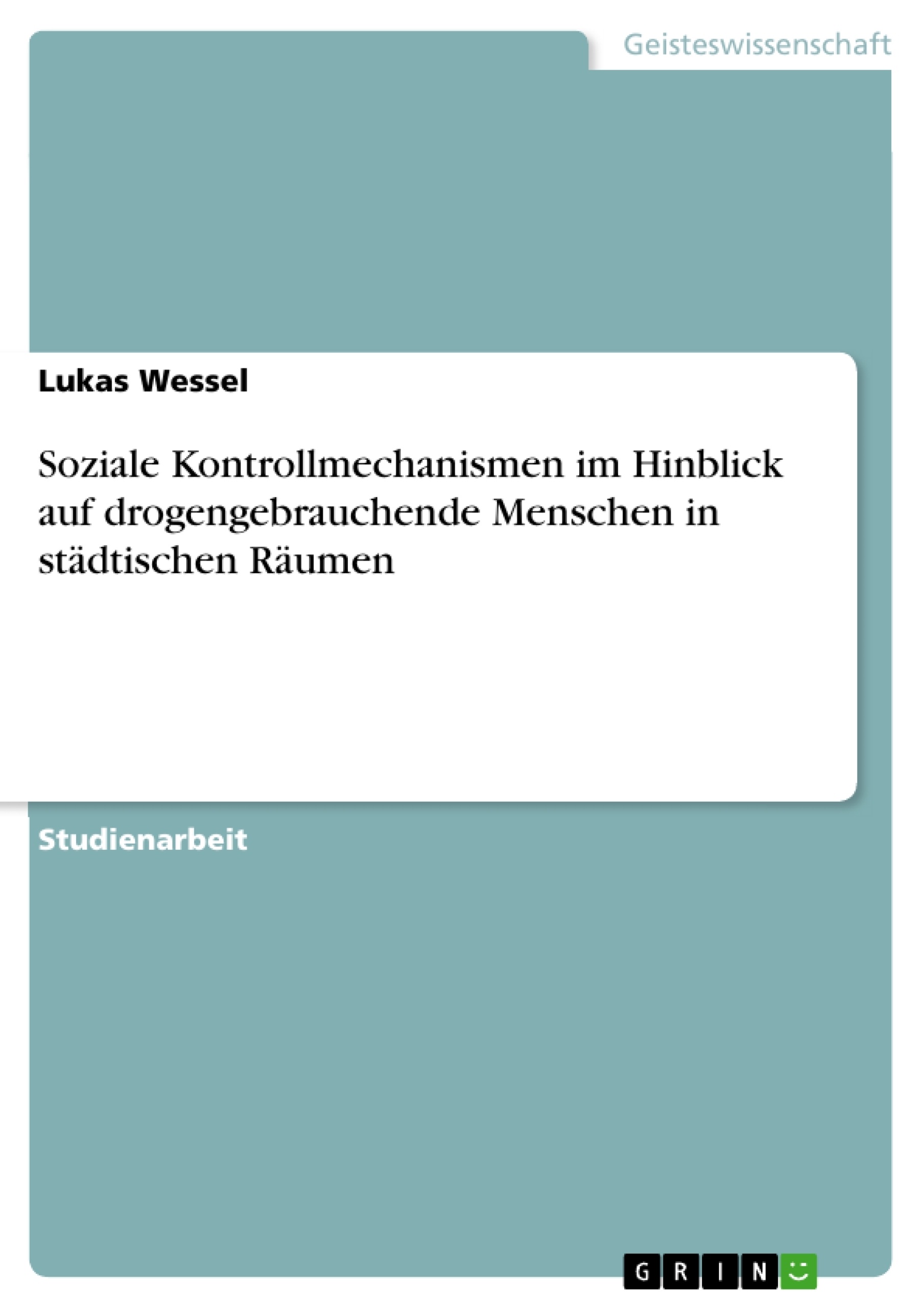Diese Arbeit thematisiert das Thema soziale Kontrolle in der neoliberalen Stadt und geht der Frage nach, welche spezifischen sozialen Kontrollmechanismen im Hinblick auf Szenen von Konsument_innen psychoaktiver Substanzen sich heute im städtischen Raum identifizieren lassen, auf welchem Raumverständnis und auf welchen ordnungspolitischen Ideologien diese beruhen und welche Folgen für die betroffenen Konsument_innen entstehen.
Verschiedene psychoaktive Substanzen haben die Geschichte der Menschheit schon lange begleitet. Der Konsum in vormodernen Gesellschaftsformen war in der Regel durch religiöse, rituelle oder medizinische Kontextualisierungen, damit verbundene tolerierte und reglementierte Handlungsalternativen und gemeinschaftlichen Konsum gekennzeichnet, wodurch soziale Kontrolle aus den spezifischen Konsumregeln der Gesellschaften heraus entstand und durch individuelle Zurechtweisung bei Regelverstößen durchgesetzt wurde.
Die Situation in spätkapitalistischen, neoliberalen Gesellschaften ist eine differente. Seit den Opiumkonferenzen im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts lässt sich der erste international geplante und aktive Versuch feststellen, den Konsum von psychoaktiven Substanzen allumfassend zu regulieren und zu kontrollieren. Dabei stellt die strafrechtliche Prohibition (bestimmter) psychoaktiver Substanzen ein sehr willkürliches und wirkmächtiges Phänomen der Menschheitsgeschichte dar, welches einen drastischen Einfluss auf die soziale Kontrolle des Gebrauchs psychoaktiver Stoffe und derer Konsument_innen hat. Doch soziale Kontrolle wird nicht nur durch die strafrechtliche Prohibition dieser Substanzen, sondern ebenfalls durch ein neoliberales Verständnis von (städtischem) Raum im Sinne einer unternehmerischen Stadt und spezifischen ordnungspolitischen Ideologien beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Soziale Kontrolle, Psychoaktive Substanzen und städtischer Raum
- 1.1 Soziale Kontrolle und psychoaktive Substanzen
- 1.2 Städtischer Raum im Neoliberalismus
- 2. Soziale Kontrollmechanismen im städtischen Raum
- 2.1 „Verdachtsunabhängig verdächtig“: Rechtliche Mechanismen
- 2.2 „Akzeptierende Vertreibung“: Personelle Mechanismen
- 2.3 „Smile, you're on CCTV\": Technische Mechanismen
- 2.4 „Designing out drugs“: Architektonische Mechanismen
- 3. Konsequenzen für rauschmittelkonsumierende Menschen
- 3.1 Exklusion und Segregation
- 3.2 Kriminalisierung
- 4. Schlussbetrachtung eines oktroyierten Herrschaftsverhältnisses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der sozialen Kontrolle von Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren, im städtischen Raum. Sie analysiert die spezifischen Kontrollmechanismen, die auf diese Szenen wirken, und untersucht das zugrundeliegende Raumverständnis und die ordnungspolitische Ideologie. Die Arbeit betrachtet auch die Folgen dieser Kontrollmechanismen für die betroffenen Konsument_innen.
- Soziale Kontrolle und psychoaktive Substanzen im Kontext des Neoliberalismus
- Analyse verschiedener sozialer Kontrollmechanismen im städtischen Raum
- Konsequenzen von Exklusion und Kriminalisierung für Konsument_innen psychoaktiver Substanzen
- Kritische Reflexion der sozialen Kontrolle als ein oktroyiertes Herrschaftsverhältnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Kontrolle von Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren, ein und stellt den historischen und aktuellen Kontext des Rauschmittelkonsums dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Etikettierungstheoretischen Ansatzes für die Analyse dieser Thematik und beschreibt den Einfluss des neoliberalen Raumverständnisses auf die soziale Kontrolle.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der theoretischen Einordnung der Begriffe „soziale Kontrolle“, „psychoaktive Substanzen“ und „städtischer Raum“. Es beleuchtet die Entwicklung des Konsums von psychoaktiven Substanzen in verschiedenen Gesellschaften und analysiert das Raumverständnis und die ordnungspolitischen Ideologien des Neoliberalismus.
Das zweite Kapitel identifiziert und analysiert explizite und implizite soziale Kontrollmechanismen im städtischen Raum. Es untersucht verschiedene Dimensionen dieser Mechanismen, wie rechtliche, personelle, technische und architektonische. Zur Illustration werden Beispiele aus der Stadt Essen herangezogen.
Kapitel drei analysiert die Folgen der sozialen Kontrolle und der damit verbundenen Ausschlussmechanismen auf Konsument_innen psychoaktiver Substanzen. Es beleuchtet die Prozesse der Exklusion und Segregation sowie die Folgen der Kriminalisierung.
Schlüsselwörter
Soziale Kontrolle, Psychoaktive Substanzen, Rauschmittel, Neoliberalismus, Städtischer Raum, Etikettierungstheorie, Exklusion, Segregation, Kriminalisierung, Herrschaftsverhältnis, Ordnungspolitik, Diskursanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist soziale Kontrolle in der „neoliberalen Stadt“?
Es beschreibt die Überwachung und Regulation des öffentlichen Raums nach ökonomischen Interessen, wobei „störende“ Gruppen wie Drogenkonsumenten oft verdrängt werden.
Welche Mechanismen werden gegen Drogenkonsumenten eingesetzt?
Die Arbeit nennt rechtliche (Verdachtskontrollen), personelle (akzeptierende Vertreibung), technische (Videoüberwachung) und architektonische (defensives Design) Mechanismen.
Welche Folgen hat diese Kontrolle für die Betroffenen?
Es führt zu sozialer Exklusion, Segregation und einer verstärkten Kriminalisierung, was die Lebenssituation der Konsumenten weiter verschlechtert.
Was besagt die Etikettierungstheorie in diesem Zusammenhang?
Sie erklärt, wie Menschen durch gesellschaftliche Zuschreibungen als „abweichend“ markiert werden, was wiederum ihr Verhalten und ihre Ausgrenzung im städtischen Raum beeinflusst.
Welches Beispiel wird zur Illustration herangezogen?
Die Arbeit nutzt Beispiele aus der Stadt Essen, um die Anwendung dieser Kontrollmechanismen in der Praxis zu verdeutlichen.
- Citar trabajo
- Lukas Wessel (Autor), 2019, Soziale Kontrollmechanismen im Hinblick auf drogengebrauchende Menschen in städtischen Räumen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1217601