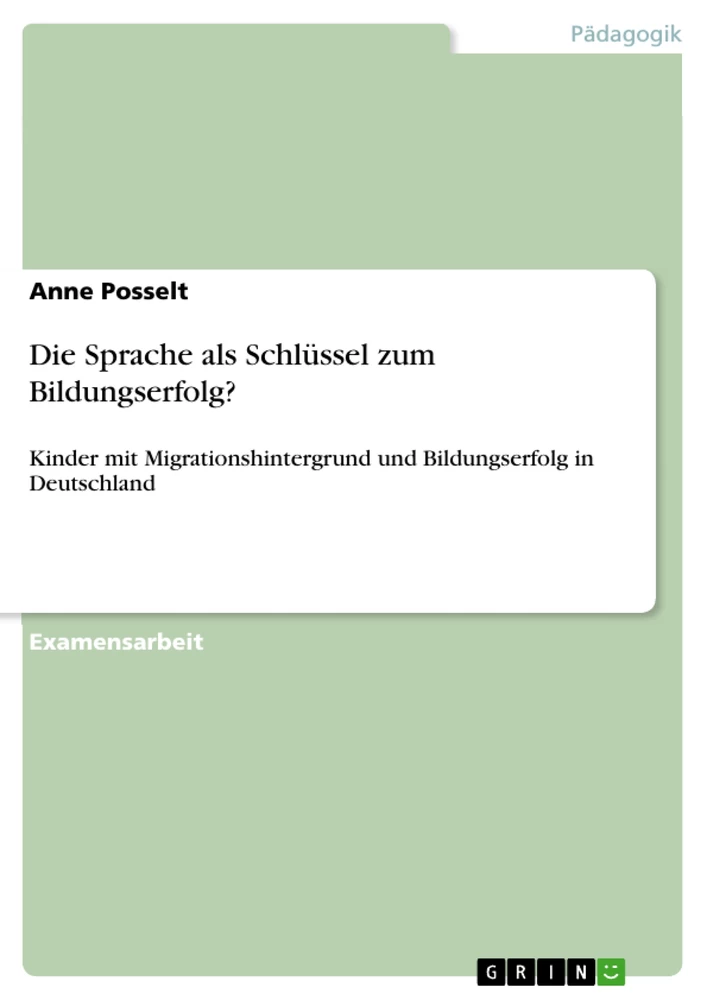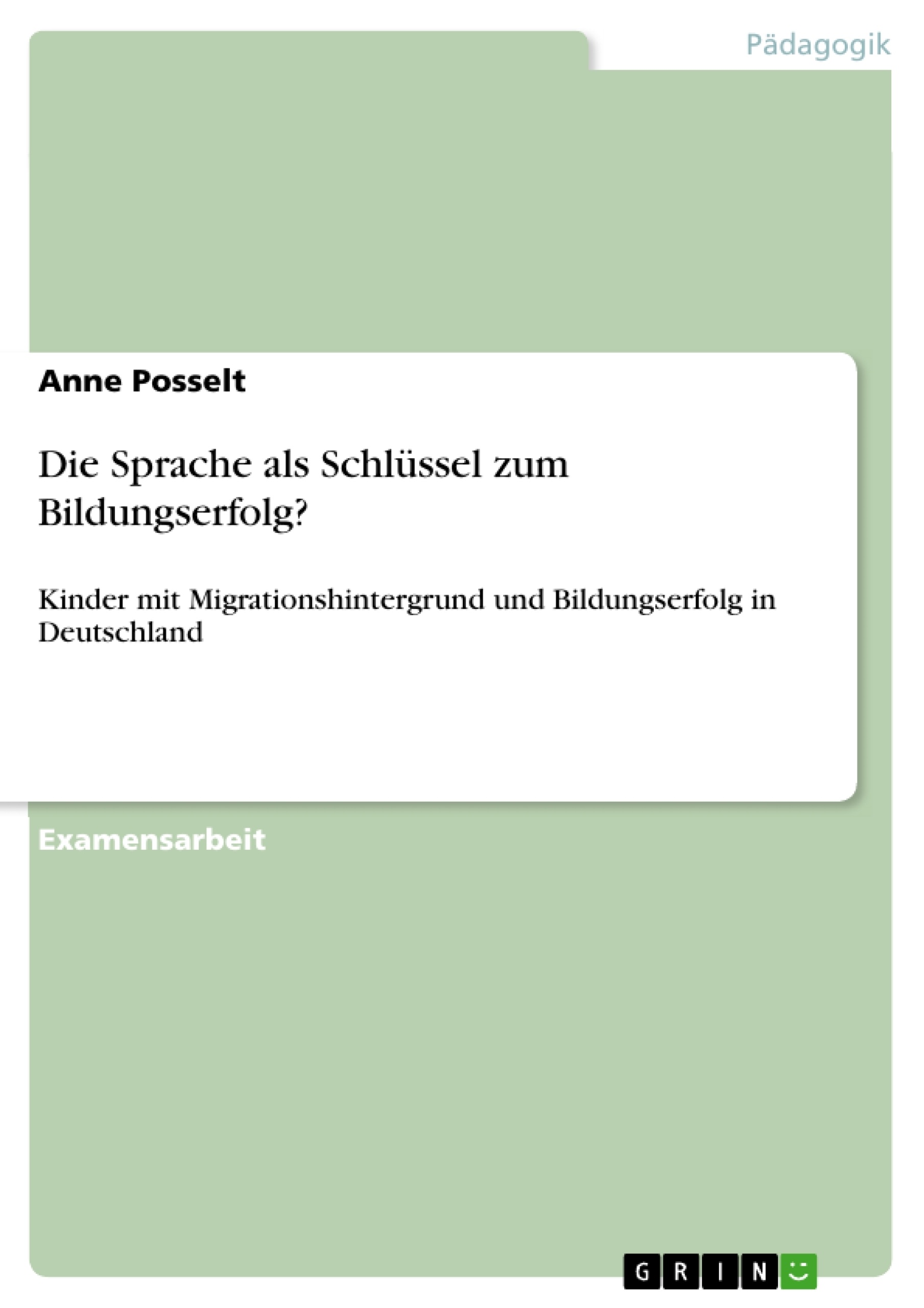Kein europäisches Land hat seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mehr Zuwanderer ohne Sprachkenntnisse des Gastlandes aufgenommen als Deutschland. Hauptgrund der Zuwanderung zuerst aus südeuropäischen Ländern, seit den 70er Jahren vor allem aus der Türkei, war der Arbeitsmarktbedarf nach „[...] billigen Arbeitskräften für schlecht angesehene Tätigkeiten [...]“ , für die nicht genügend Deutsche zur Verfügung standen. Anfangs kamen hauptsächlich Männer zwischen zwanzig und vierzig Jahren ohne Familienangehörige als Gastarbeiter nach Deutschland mit der auch bei den damaligen Bundesregierungen verfolgten Annahme, dass diese nach einigen Jahren Arbeit in Deutschland wieder in das jeweilige Heimatland zurückkehren würden. Doch bereits seit Ende der 60er Jahre begannen einige dieser Arbeitskräfte ihre Familien nachzuholen. Diese Kinder unterlagen der deutschen Schulpflicht, wodurch sich deren Integration und die Vermittlung der deutschen Sprache in den folgenden Jahren als zunehmend wichtige Aufgaben für die Schulen erwiesen.
Bedingt durch wirtschaftliche Krisen erfolgte ein Anwerbungsstopp für Gastarbeiter und seit 1973 wurde versucht, die Zuwanderung von Familienangehörigen zu begrenzen. Trotz dieser Maßnahmen stieg die Zahl der Zuwanderer unter anderem durch Spätaussiedler aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion. Weiterhin wuchs die Anzahl derjenigen, die aufgrund des deutschen Asylrechts oder als (Bürger)Kriegsopfer Aufenthaltsgenehmigungen erhielten. Hierzu zählten vor allem Kurden, Libanesen, (Kosovo-)Albaner, Afghanen und Kriegsflüchtlinge aus Sri Lanka. 2004 lebten ca. 7,3 Millionen Ausländer in Deutschland, wovon ungefähr die Hälfte ehemalige Gastarbeiter und ihre Angehörigen waren.
Ergebnisse der PISA- und IGLU-Studien der letzten Jahre ergaben, dass der Bildungserfolg in Deutschland sehr stark von der sozialen Herkunft eines Kindes abhängig ist. Dies gilt natürlich auch für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Diese erreichen im Vergleich mit deutschen Kindern prozentual deutlich niedrigere oder gar keine Schulabschlüsse. Sie werden überproportional häufig von der Einschulung zurückgestellt oder auf eine Förderschule verwiesen. Fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlicher mit Migrationshintergrund besuchen die Hauptschule, ca. 20% erreichen keinen Schulabschluss und 40% bleiben ohne berufliche Qualifizierung.
Mit dieser Arbeit möchte ich nach Ursachen für das schulische Scheitern von Migrantenkindern suchen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Erstsprache/Muttersprache
- Mehrsprachigkeit/Bilingualismus
- Starke und schwache Sprache
- Fremdsprache
- „Ausländer“, „Migranten“ und „Menschen mit Migrationshintergrund“
- Mehrsprachigkeit
- Allgemeiner Spracherwerb
- Zweitspracherwerb
- Simultaner Sprachwechsel/Code-Switching und Interferenzen
- Mehrsprachigkeit bei Kindern: Überforderung oder positive kognitive Fähigkeit
- Zusammenfassung
- Die Bildungssituation für Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland
- Allgemeines zum deutschen Bildungssystem
- Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem
- Zum Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund in den neuen Bundesländern
- Erklärungsansätze für die Überrepräsentation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an Schulen für Lernhilfe
- Zusammenfassung
- Erklärungsansätze für den mangelnden Bildungserfolg für Kinder mit Migrationshintergrund
- Institutionelle Diskriminierung
- Der soziokulturelle Faktor
- Faktor Sprache
- Deutsch als Zweitsprache und bilinguale Alphabetisierung
- Muttersprachlicher Unterricht
- Zusammenfassung
- Verfahren zur Sprachstanderhebung und Sprachförderung
- Entstehung von Sprachstanderhebungsverfahren
- Problematik der Maßstäbe
- Anforderungen an Sprachstanderhebungsverfahren
- Kriterien für die Entwicklung von Tests zur Sprachstanddiagnose
- Verfahren und Methoden
- Heidelberger Sprachentwicklungstest
- Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertagesstätten (SISMIK)
- Zusammenfassung
- Beurteilung des Sprachstanderhebungsverfahrens Fit in Deutsch
- Allgemeines zu „Fit in Deutsch“
- Untersuchung des Verfahrens „Fit in Deutsch“
- Auswertung der Untersuchung: „Fit in Deutsch“ als angemessene Lösung für frühzeitige Erkennung und Förderung von Sprachdefiziten?
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Sprache auf den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland. Sie analysiert die Herausforderungen und Faktoren, die zum mangelnden Bildungserfolg beitragen, und beleuchtet verschiedene Sprachförderungsansätze.
- Der Einfluss von Sprachkenntnissen auf den Bildungserfolg
- Institutionelle und soziokulturelle Barrieren für den Bildungserfolg
- Die Rolle der Mehrsprachigkeit im Spracherwerbsprozess
- Analyse von Sprachstanderhebungsverfahren
- Bewertung von Sprachfördermaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Sprache und Bildungserfolg bei Kindern mit Migrationshintergrund. Kapitel 4 definiert zentrale Begriffe wie Erstsprache, Mehrsprachigkeit und Migrationshintergrund. Kapitel 5 beleuchtet den allgemeinen und den Zweitspracherwerb sowie die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit. Kapitel 6 beschreibt die Bildungssituation von Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland und deren Überrepräsentation in Förderschulen. Kapitel 7 analysiert Erklärungsansätze für den mangelnden Bildungserfolg, fokussiert auf institutionelle Diskriminierung, soziokulturelle Faktoren und den sprachlichen Faktor, einschließlich Deutsch als Zweitsprache und muttersprachlichem Unterricht. Kapitel 8 befasst sich mit Verfahren zur Sprachstanderhebung und -förderung, inklusive einer Diskussion der Anforderungen an solche Verfahren und einer Vorstellung des Heidelberger Sprachentwicklungstests (HSET) und des SISMIK-Verfahrens. Kapitel 9 evaluiert das niedersächsische Sprachstanderhebungsverfahren "Fit in Deutsch".
Schlüsselwörter
Bildungserfolg, Kinder mit Migrationshintergrund, Mehrsprachigkeit, Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Sprachförderung, Sprachstanderhebung, institutionelle Diskriminierung, soziokulturelle Faktoren, Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET), SISMIK, Fit in Deutsch.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Sprache tatsächlich der Schlüssel zum Bildungserfolg?
Ja, die Arbeit untersucht die These, dass mangelnde Sprachkenntnisse im Deutschen eine der Hauptursachen für das schulische Scheitern von Migrantenkindern sind.
Was versteht man unter institutioneller Diskriminierung im Bildungssystem?
Es handelt sich um Strukturen innerhalb des Schulsystems, die Kinder mit Migrationshintergrund benachteiligen, beispielsweise durch eine Überrepräsentation an Förderschulen.
Welche Rolle spielt die Mehrsprachigkeit bei Kindern?
Die Arbeit diskutiert, ob Mehrsprachigkeit eine Überforderung darstellt oder als positive kognitive Fähigkeit gewertet werden kann, die den Spracherwerb unterstützt.
Was sind Sprachstanderhebungsverfahren?
Das sind Tests und Methoden wie der Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET) oder SISMIK, mit denen festgestellt wird, wie gut ein Kind eine Sprache beherrscht, um gezielte Förderung zu ermöglichen.
Was ist das Verfahren "Fit in Deutsch"?
Es ist ein niedersächsisches Verfahren zur Sprachstandsfeststellung, das in der Arbeit kritisch auf seine Eignung zur frühzeitigen Erkennung von Defiziten geprüft wird.
Wie beeinflusst die soziale Herkunft den Bildungserfolg in Deutschland?
Studien wie PISA zeigen, dass der Bildungserfolg in Deutschland stark von der sozialen Herkunft abhängt, was Kinder mit Migrationshintergrund oft doppelt benachteiligt.
- Citar trabajo
- Anne Posselt (Autor), 2008, Die Sprache als Schlüssel zum Bildungserfolg?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121993