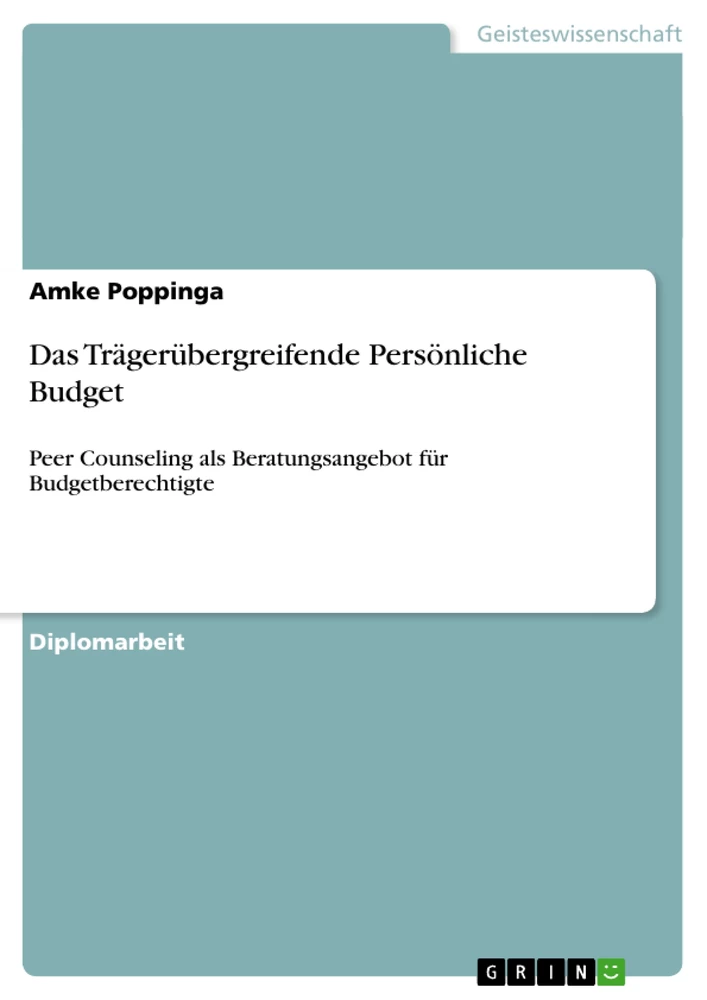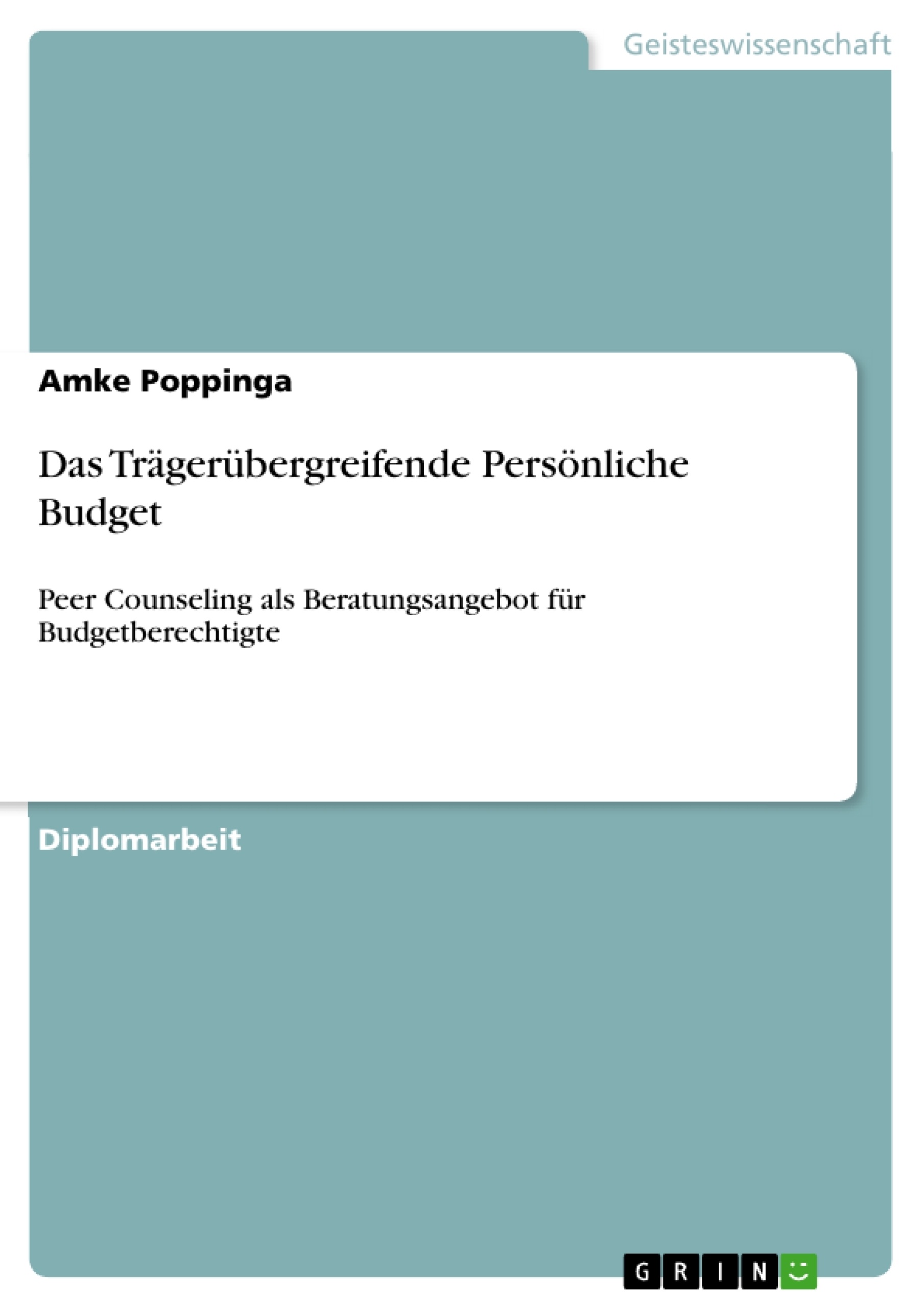Die Versorgung eines Menschen mit Behinderung kann unterschiedlich geregelt sein. Oftmals erhält der behinderte Mensch als Leistungsberechtigter eine Leistung von einem Leistungserbringer, die der zuständige Leistungsträger bezahlt. Dieses klassische Leistungsdreieck wird Sachleistungsmodell genannt. Der behinderte Mensch erhält eine Versorgungssicherheit, die ihm wenig Einflussnahme ermöglicht. Als Alternative zu diesem Fürsorgeprinzip gibt es seit dem 1. Juli 2004 das Trägerübergreifende Persönliche Budget, auf das die leistungsberechtigte Person seit dem 01.01.2008 einen Rechtsanspruch hat. Aufgrund der geringen Erfahrungswerte können über mögliche Auswirkungen nur Vermutungen gemacht werden. Fürsprecher betonen die gesteigerte Selbstbestimmung der Budgetnutzer. Gegner sind misstrauisch und fürchten dahinter verborgende Sparmaßnahmen des Staates auf Kosten der Menschen mit Behinderung. Unbestritten ist, dass ein Mehr an Selbstbestimmung gleichzeitig ein erhöhtes Maß an Verantwortung beinhaltet. Das Trägerübergreifende Persönliche Budget muss verwaltet werden. Es müssen so genannte Zielvereinbarungen mit den Leistungsträgern geschlossen werden, die individuelle Bestimmungen über Einsatzbereiche, etc. beinhalten. Kostenvoranschläge verschiedener Leistungserbringer sollten eingefordert und verglichen werden, um das Geld möglichst effizient einsetzen zu können. Fraglich ist, inwieweit Budgetnehmer die Verwaltung selbstständig leisten können bzw. wollen und in welcher Form Beratung und Unterstützung erforderlich ist. Das Trägerübergreifende Persönliche Budget kann nur angenommen und langfristig konstruktiv umgesetzt werden, wenn Unsicherheiten und Missverständnissen entgegengewirkt wird und Gesetzesgrundlagen eindeutig sind. Dann könnenLeistungsbringer, Leistungsträger und Leistungsberechtigte effektiv zusammen arbeiten.
Es wurden im Rahmen dieser Diplomarbeit exemplarisch sechs Interviews mit Peer Counselorn geführt, die Budgetberatung leisten, um einen möglichst praxisnahen Eindruck zu bekommen und abschließend beurteilen zu können, ob und in welchem Umfang Beratung und Unterstützung notwendig ist und ob Peer Counseling ein geeignetes Angebot ist. Hieraus sollen Kritikpunkte, Verbesserungsvorschläge, etc. erwachsen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Trägerübergreifende Persönliche Budget
- 2.1. Leistungsberechtigter – Leistungsträger – Leistungserbringer
- 2.1.1. Der veränderte Rechtsanspruch
- 2.1.2. Das veränderte Leistungsdreieck
- 2.1.3. Die Leistungsberechtigten
- 2.1.4. Budgetfähige Leistungen
- 2.1.5. Die Leistungsträger
- 2.1.6. Die Sonderstellung der Pflegekassen
- 2.2. Die Zielsetzung
- 2.2.1. Selbstbestimmung vs. Kosteneinsparung
- 2.2.2. Zum Misstrauen der Kritiker gegenüber der gesetzlich verankerten Zielsetzung
- 2.2.3. Voraussetzungen zur Erreichung des Ziels der erhöhten Selbstbestimmung
- 2.3. Der Weg vom Antrag bis zum Bescheid
- 2.3.1. Der Antrag
- 2.3.2. Das Bedarfsfeststellungsverfahren
- 2.3.3. Die Zielvereinbarung
- 2.3.4. Der Bewilligungsbescheid
- 2.4. Die Budgetassistenz
- 2.4.1. Budgetberatung
- 2.4.2. Budgetunterstützung
- 2.4.3. Die Budgetassistenz und rechtliche Betreuung
- 2.4.4. Die Finanzierung der Budgetassistenz
- 2.1. Leistungsberechtigter – Leistungsträger – Leistungserbringer
- 3. Peer Counseling
- 3.1. Peer Counseling - Die Definition
- 3.2. Peer Counseling – Die Geschichte
- 3.2.1. Die Independent Living Bewegung
- 3.2.2. Die Selbstbestimmt Leben Bewegung
- 3.2.3. Die Self Advocacy Bewegung
- 3.2.4. Disability Studies
- 3.3. Peer Counselor - Die Ausbildung
- 3.4. Peer Counseling und Soziale Arbeit
- 3.4.1. Peer Counseling und Beratung
- 3.4.1.1. Peer Counseling und die Klientenzentrierte Gesprächsführung
- 3.4.2. Die Abgrenzung von Peer Counselorn und Dipl. Sozpäd./-arbeitern
- 3.4.1. Peer Counseling und Beratung
- 3.5. Peer Counseling als Beratungsangebot für Budgetberechtigte
- 4. Interviews mit Peer Counselorn
- 4.1. Vorbereitung der Interviews
- 4.1.1. Suche der Interviewpartner
- 4.1.2. Wahl der Methode
- 4.2. Durchführung der Interviews
- 4.3. Analyse der Interviews
- 4.3.1. Aussagen zu Voraussetzungen, durch die das Trägerübergreifende Persönliche Budget zu mehr Selbstbestimmung führen kann
- 4.3.1.1. Bedarfsdeckung
- 4.3.1.2. Das Integrierte Budget
- 4.3.1.3. Entbürokratisierung
- 4.3.1.4. Zweckgebundenheit
- 4.3.1.5. Öffentlichkeitsarbeit
- 4.3.1.6. Motivation
- 4.3.2. Aussagen zum Beratungsangebot für Budgetberechtigte
- 4.3.2.1. Verantwortung des Budgetberechtigten
- 4.3.2.2. Zielgruppe
- 4.3.2.3. Umfang
- 4.3.2.4. Finanzierung
- 4.3.3. Aussagen zu Peer Counseling als Beratungsangebot für Budgetberechtigte
- 4.3.3.1. Parteilichkeit
- 4.3.3.2. Niedrigschwelligkeit
- 4.3.3.3. Qualifikation
- 4.3.3.4. Eigene Betroffenheit
- 4.3.1. Aussagen zu Voraussetzungen, durch die das Trägerübergreifende Persönliche Budget zu mehr Selbstbestimmung führen kann
- 4.1. Vorbereitung der Interviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Peer Counseling als Beratungsangebot für Menschen mit einem Trägerübergreifenden Persönlichen Budget (TPB). Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser Beratungsform im Kontext des TPB zu beleuchten.
- Das Trägerübergreifende Persönliche Budget und seine Auswirkungen auf Selbstbestimmung
- Peer Counseling als Beratungsansatz und seine Eignung für die Zielgruppe
- Analyse der Erfahrungen von Peer Counselorn in der Beratung von Budgetberechtigten
- Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung des TPB
- Herausforderungen und Potenziale von Peer Counseling im Kontext des TPB
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bildet eine Einleitung in die Thematik. Kapitel 2 beschreibt das Trägerübergreifende Persönliche Budget, seine rechtlichen Grundlagen, Zielsetzungen und den Ablauf des Prozesses von der Antragstellung bis zur Bewilligung. Es werden die verschiedenen Akteure (Leistungsberechtigte, Leistungsträger, Leistungserbringer) und die Rolle der Budgetassistenz detailliert dargestellt. Kapitel 3 definiert Peer Counseling, beleuchtet seine Geschichte und Entwicklung, insbesondere im Kontext der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, und diskutiert seine Einbettung in die Soziale Arbeit. Die Kapitel 4 beschreibt die Durchführung und Auswertung von Interviews mit Peer Counselorn.
Schlüsselwörter
Trägerübergreifendes Persönliches Budget, Peer Counseling, Selbstbestimmung, Budgetberatung, Soziale Arbeit, Behinderung, Partizipation, Interviewforschung.
- Quote paper
- Amke Poppinga (Author), 2008, Das Trägerübergreifende Persönliche Budget , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122878