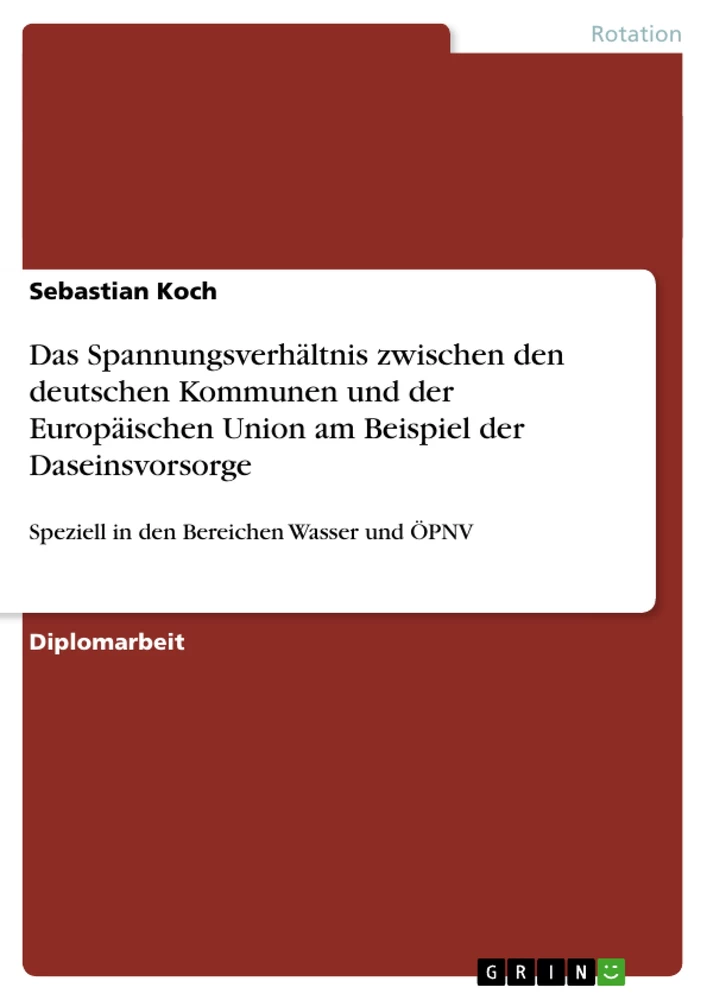In den Fokus europäischer Wettbewerbspolitik geriet in den letzten Jahren verstärkt auch ein Bereich, welcher traditionell in die Verantwortung der Mitgliedsstaaten fällt: Die Daseinsvorsorge. Gemeint sind hiermit, grob beschrieben, Leistungen wie die Wasserversorgung oder der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), welche in Deutschland traditionell die Kommunen den Bürgern bereitstellen und so einen immensen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. Überwiegend werden diese Leistungen durch kommunale Unternehmen, sei es in öffentlich-rechtlicher Form, in Privatrechtsform oder in gemischtwirtschaftlicher Form, erbracht. Daseinsvorsorgeleistungen gelten allgemein als der substanziellen Kernbestand der kommunalen Selbstverwaltung, welche den deutschen Kommunen durch Art. 28 Abs. 2 GG ausdrücklich zugesichert wird. Der fortschreitende Prozess der europäischen Integration wirkt jedoch in vielfältiger Weise immer stärker auf die kommunale Selbstverwaltung und die kommunale Daseinsvorsor-ge einschließlich ihrer Wahrnehmung durch kommunale Unternehmen rechtlich und tat-sächlich ein.
Auf der einen Seite steht also die EU, namentlich in Gestalt der Kommission und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), welche in der traditionellen deutschen Organisation und Finanzierung von Daseinsvorsorgeleistungen eine Gefahr für den europäischen Binnenmarkt ohne Wettbewerbsbeschränkungen befürchten. Auf der anderen Seite se-hen sich die deutschen Kommunen immer öfter durch EU-rechtliche Vorgaben in ihrer Organisationshoheit beschnitten und argumentieren nicht selten mit dem ihnen zuge-sagten Recht auf kommunale Selbstverwaltung durch das Grundgesetz (GG) sowie dem Subsidiaritätsprinzip. Daraus ergibt sich eine Interessenlage, die im Gegensatz zu den europäischen Liberalisierungsbemühungen steht, denn das von den Kommunen verfolg-te Ziel ist eine möglichst effektive Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse und nicht das Be-stehen im Wettbewerb. Dreh- und Angelpunkt in diesem Konflikt stellt das europä-ische Beihilfenrecht dar.
Im Streit um die Daseinsvorsorge zwischen der EU und den deutschen Kommunen lassen sich so zwei Konfliktlinien ausmachen. Einerseits geht es um die ordnungspoli-tische Debatte, also wie viel Markt und wie viel Gestaltung durch den Staat wird angestrebt. Andererseits, und diese Konfliktlinie soll vorrangig Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein, ergibt sich die Frage nach der Kompetenzaufteilung zwischen nationaler und europäischer Ebene.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung
- Fragestellungen
- Aufbau der Arbeit
- Daseinsvorsorge aus theoretischer Sicht
- Die Lehre Forsthoffs
- Grundüberlegungen
- Vom Ordnungsgaranten zum Leistungsträger
- Die Absicht Forsthoffs
- Kritische Würdigung der Lehre Forsthoffs
- Daseinsvorsorge aus heutiger Sicht
- Aktuelles Begriffsverständnis
- Von der Daseinsvorsorge zum „Gewährleistungsstaat“
- Die Lehre Forsthoffs
- Daseinsvorsorge in der Bundesrepublik Deutschland
- Die historische Entwicklung
- Die Organisation
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Kommunale Unternehmen
- Die Wasserversorgung
- Die Wasserversorgung als Daseinsvorsorgeaufgabe
- Die Organisation der Wasserversorgung
- Die nationale Liberalisierungsdebatte
- Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)
- Die Bedeutung des ÖPNV als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Die Organisation und die Finanzierung des ÖPNV
- Daseinsvorsorge in der Europäischen Union
- Die Tradition (en) in der EU
- Unterschiedliche Daseinsvorsorgekonzepte
- Frankreich
- Großbritannien
- Daseinsvorsorge aus Sicht der Europäischen Kommission
- Der gemeinschaftliche Begriff der Daseinsvorsorge
- Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
- Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
- Regelungen zur Daseinsvorsorge im europäischen Recht
- Daseinsvorsorge im europäischen Primärrecht
- Folgerungen für die deutsche Wasserversorgung
- Folgerungen für den deutschen ÖPNV
- Die Tradition (en) in der EU
- Der Einfluss europäischer Wettbewerbspolitik auf die kommunale Daseinsvorsorge in den Bereichen Wasser und ÖPNV
- Die Wasserversorgung
- Die Wasserversorgung im Blickfeld der EU
- Die tatsächliche Entwicklung in der EU
- Der ÖPNV
- Das Urteil „Altmark Trans“
- Die Debatte um die neue Verordnung zum ÖPNV
- Auswirkungen auf den kommunalen ÖPNV
- Die Wasserversorgung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen deutschen Kommunen und der Europäischen Union im Kontext der Daseinsvorsorge, insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung und öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Ziel ist es, die rechtlichen und organisatorischen Herausforderungen aufzuzeigen, die sich aus der europäischen Wettbewerbspolitik für die kommunale Daseinsvorsorge ergeben.
- Die theoretische Einordnung der Daseinsvorsorge
- Die historische Entwicklung der Daseinsvorsorge in Deutschland
- Die Organisation der Wasserversorgung und des ÖPNV in Deutschland
- Die europäische Rechtslage zur Daseinsvorsorge
- Der Einfluss der EU-Wettbewerbspolitik auf die kommunale Daseinsvorsorge
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfragen vor. Kapitel 2 befasst sich mit der theoretischen Betrachtung der Daseinsvorsorge, Kapitel 3 beschreibt die historische Entwicklung und Organisation der Daseinsvorsorge in Deutschland, mit besonderem Fokus auf Wasserversorgung und ÖPNV. Kapitel 4 analysiert die Daseinsvorsorge aus europäischer Perspektive. Kapitel 5 untersucht den Einfluss der europäischen Wettbewerbspolitik auf die kommunale Daseinsvorsorge in den Bereichen Wasser und ÖPNV.
Schlüsselwörter
Daseinsvorsorge, Europäische Union, Kommunen, Wasserversorgung, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Wettbewerbspolitik, Liberalisierung, EU-Recht, kommunale Unternehmen.
- Citation du texte
- Sebastian Koch (Auteur), 2008, Das Spannungsverhältnis zwischen den deutschen Kommunen und der Europäischen Union am Beispiel der Daseinsvorsorge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122924