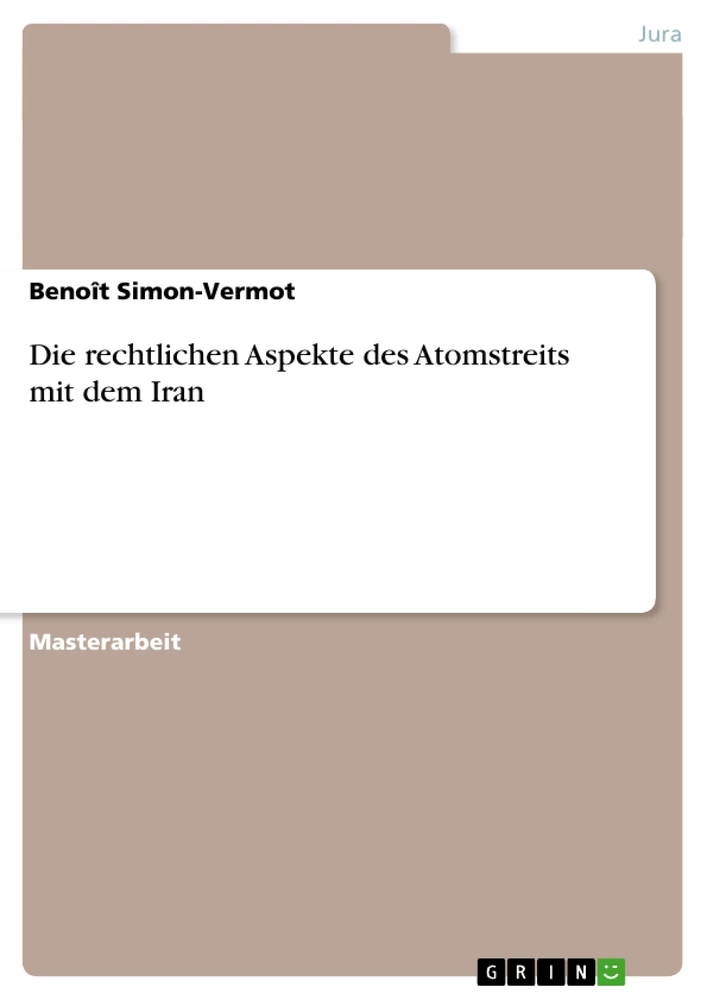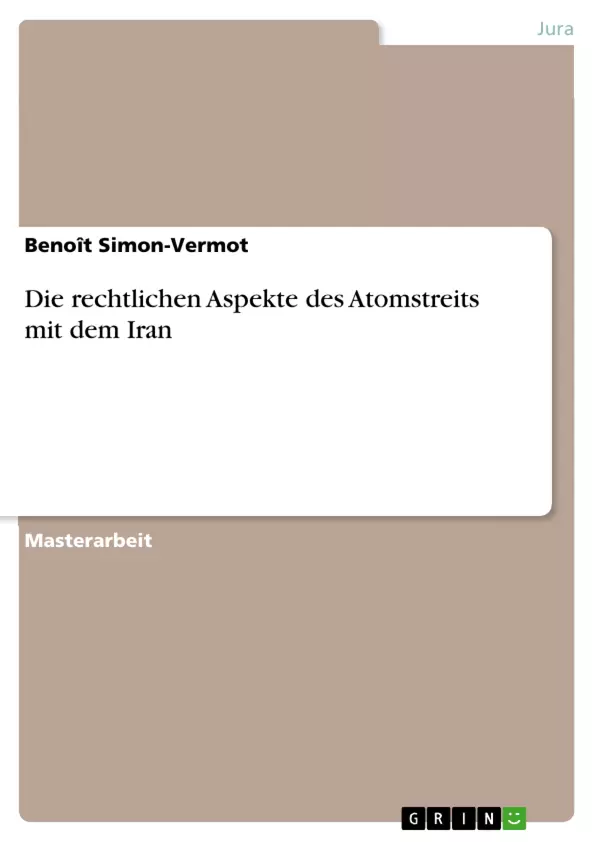Am 6. August 1945 wurde in Hiroshima zum ersten Mal eine Uranbombe während eines militärischen Konflikts eingesetzt. Am 8. Dezember 1953 stellte der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Dwight D. Eisenhower, vor der Generalversammlung der Vereinigten Nationen (UNGA) sein Programm „Atoms for Peace“ dar, in welchem er inter alia die Schaffung einer internationalen Kernenergieorganisation vorschlug. Mit diesem Entwurf wollte er sowohl die friedliche Verwendung der Kernenergie fördern als auch ihre militärische Nutzung verhindern. Am 29. Juli 1957 trat die Satzung der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) in Kraft.
Diese geschichtlichen Meilensteine zeigen die zwei
Facetten der Kernenergie, die in dieser Master-Arbeit analysiert und diskutiert werden: Einerseits die für friedliche Zwecke wichtige Energieform und andererseits das für Massenvernichtungswaffen (WMD) verwendete Rohstoff. Da die beiden Nutzungen der Atomkraft die gleichen technischen, technologischen und wissenschaftlichen Grundsätze haben, entsteht eine gewisse „Zweideutigkeit“ bei deren Erforschung, Erzeugung und Verwendung. Dagegen werden die friedlichen und militärischen Facetten der Atomenergie unter dem Gesichtspunkt des Völkerrechts deutlich unterschiedlich behandelt.
Um die Problematik der Atomkraft klar zu erfassen, müssen zunächst verschiedene Betrachtungsweisen kurz erwähnt werden. So spielen, neben den rechtlichen Aspekten, auch Politik und Wirtschaft eine Rolle im Kontext der zivilen und militärischen Kernenergienutzung, indem die Atomkraft die geostrategischen, politischen und ökonomischen Beziehungen innerhalb der Regionen und zwischen Staaten beeinflussen kann. Mit dem staatlichen Besitz von Atomwaffen sind ferner verschiedene Prinzipien, Werte und Vorteile verbunden, wie z.B. Prestige, Sicherheit, Macht, Einfluss, Abschreckungsinstrument oder auch nationale Unabhängigkeit. Demgegenüber sind aber die negativen Seiten des Kernwaffenbesitzes zu erwähnen, wie die Eskalationsrisiken und -gefahren, der zwischenstaatliche Vertrauensmangel oder -verlust, der Rüstungswettlauf oder das beträchtliche Zerstörungspotential der WMD.
Inhaltsverzeichnis
- I. Internationales Regime der Nuklearen Nichtverbreitung: Historische Entwicklung und rechtliche Grundlagen
- 1. Historische Entwicklung: Die wichtigen Etappen
- 1.1. Die Initiativen der Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg
- 1.2. Die Weiterentwicklung des Regimes der Nichtverbreitung
- 1.3. Die Konsolidierung des Regimes der Nichtverbreitung
- 1.4. Von den 1980er Jahren bis heute
- 2. Die rechtlichen Grundlagen des internationalen Regimes der Nichtverbreitung
- 2.1. Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT)
- 2.2. Safeguards Agreements mit der IAEA
- 2.3. Zusatzprotokolle zum Übereinkommen über Sicherungsmassnahmen
- 2.4. Weitere Rechtsgrundlagen
- 1. Historische Entwicklung: Die wichtigen Etappen
- II. Der Iran als Mitglied des internationalen Regimes der Nichtverbreitung: Rechtliche Beziehungen, Rechte und Verpflichtungen
- 1. Rechtliche Beziehungen im Rahmen des Rechtsregimes
- 2. Rechte und Verpflichtungen des Irans
- 3. Probleme und Widersprüche innerhalb des internationalen Rechtsregimes oder zwischen diesem Regime und anderen völkerrechtlichen Normen
- III. Problematik der (Non-)Compliance des Irans mit dem internationalen Regime der Nichtverbreitung
- 1. Compliance oder Non-Compliance: Kontrollinstrumente und Massnahmen im Rechtsregime der Nichtverbreitung
- 2. Externe Massnahmen im Falle einer Non-Compliance
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die rechtlichen Aspekte des Atomstreits mit dem Iran. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen des internationalen Nichtverbreitungsregimes und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten des Iran. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Evaluierung der Compliance des Irans mit diesen internationalen Verpflichtungen und den daraus resultierenden Reaktionen der internationalen Gemeinschaft.
- Das internationale Nichtverbreitungsregime für Kernwaffen
- Die rechtlichen Verpflichtungen des Iran im Rahmen des NPT
- Die Auslegung der Rechte des Iran auf friedliche Nutzung der Kernenergie
- Die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft auf die iranische Atomprogramm
- Die Rolle der IAEA und des UN-Sicherheitsrats
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I beleuchtet die historische Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen des internationalen Regimes der Nuklearen Nichtverbreitung. Kapitel II analysiert die rechtlichen Beziehungen, Rechte und Pflichten des Irans im Kontext dieses Regimes, unter Berücksichtigung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT) und der Safeguards Agreements mit der IAEA. Kapitel III befasst sich mit der Problematik der Compliance des Irans mit dem internationalen Regime, untersucht Kontrollmechanismen und die Reaktion der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Rolle der IAEA und des UN-Sicherheitsrats.
Schlüsselwörter
Atomstreit, Iran, Nichtverbreitung von Kernwaffen, NPT, IAEA, UN-Sicherheitsrat, Völkerrecht, Compliance, friedliche Nutzung der Kernenergie, Safeguards Agreements, Sanktionen.
- Quote paper
- M.A. HSG in International Affairs and Governance Benoît Simon-Vermot (Author), 2007, Die rechtlichen Aspekte des Atomstreits mit dem Iran, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123242