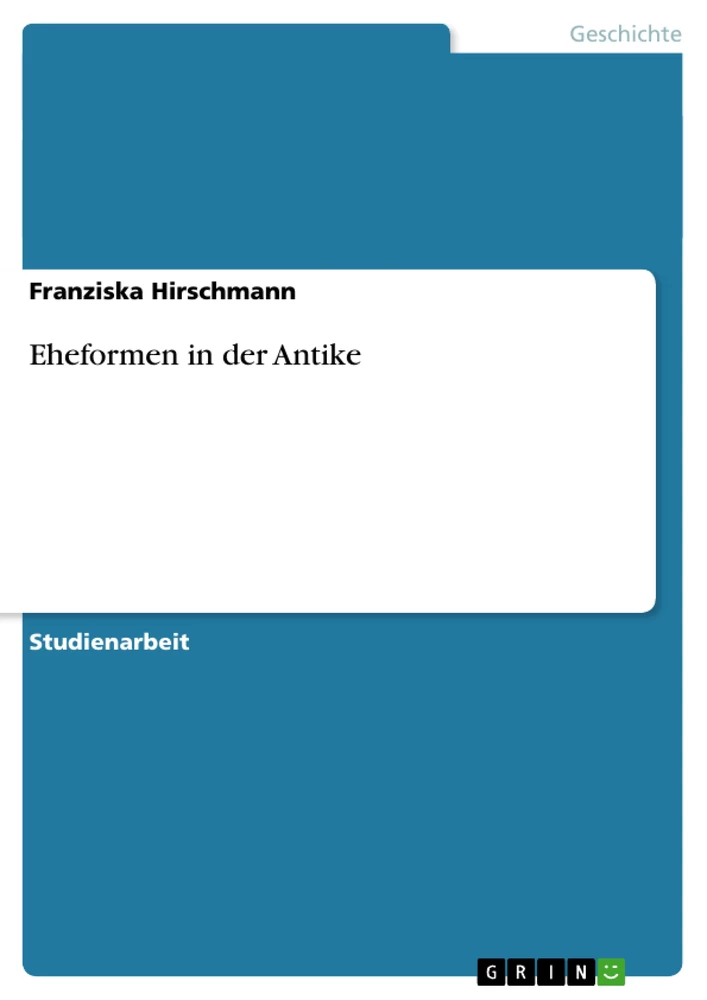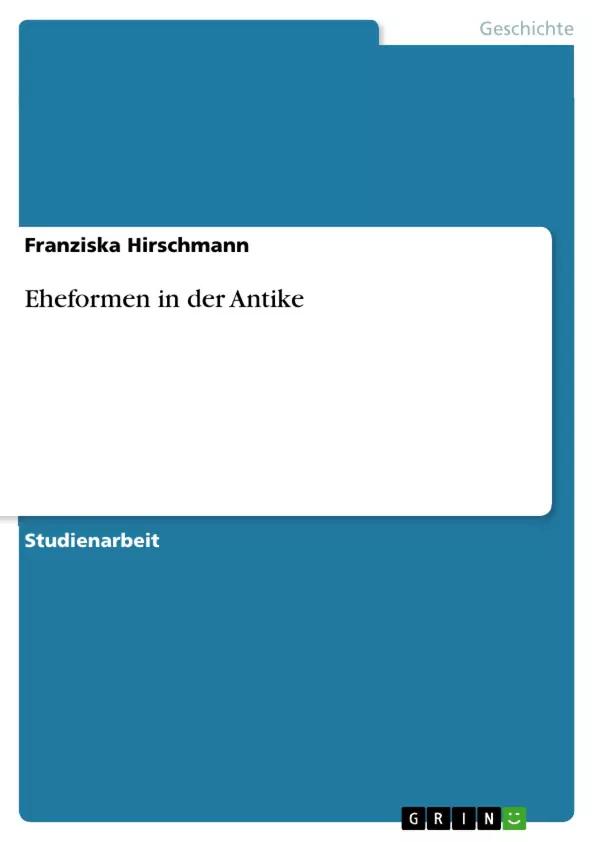In der Antike gab es nicht nur die von den Römern und Griechen praktizierte Monogamie,
sondern daneben auch weitere Eheformen. In einer Reihe von Kulturen existierte Polygamie
– eine Form der Ehe, bei der ein Partner ständig mit mehreren Partnern des anderen
Geschlechts zusammenlebt. Aufgrund ihrer Kontakte zu anderen Kulturen der antiken Welt,
wussten Griechen und Römer sehr wohl, dass neben ihrer monogamen Eheform auch
Polygynie – die eheliche Verbindung eines Mannes mit mehreren Frauen – und die seltenere
Form der Polyandrie – die eheliche Verbindung einer Frau mit mehreren Männern praktiziert
wurden. Auch war in einigen Kulturen die Geschwisterehe üblich.
Polygamie ist nach wie vor ein aktuelles Thema, denn sie wird auch heute noch
beispielsweise in Tibet praktiziert. Hier sind sowohl Polygynie als auch in anderen Gegenden
Polyandrie verbreitet. Üblich ist, dass bei der Polygynie ein reicher Mann mehrere
Schwestern heiraten kann und dass bei der Polyandrie eine Frau mehrere, meistens zwei,
Brüder heiratet. Die Eheform der Polyandrie hat ihren Ursprung in der tibetischen Feudalzeit.
So konnte ein männliches Familienmitglied zur Sklavenarbeit herangezogen werden, während
das Land der Familie weiterhin von dem weiteren männlichen Familienmitglied bestellt
werden konnte.1
Im Folgenden sollen exemplarisch anhand mehrerer Kulturen verschiedene polygamische
Eheformen der Antike beleuchtet werden. Zentrale Fragen, die beantwortet werden sollen,
sind zum einen, welche Gründe Polygamie hat und zum anderen, unter welchen Bedingungen
und Voraussetzungen sie auftritt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Polyandrie bei den Kelten
- 2. Polyandrie bei den Spartanern
- 3. Polygynie in Mesopotamien
- 4. Polygynie bei den Makedoniern
- 5. Polygynie bei den Persern
- 6. Geschwisterehe in Ägypten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene polygame Eheformen in der Antike. Sie beleuchtet die Gründe für Polygamie und die Bedingungen ihres Auftretens in verschiedenen antiken Kulturen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Verbreitung polygamer Praktiken und der damit verbundenen politischen, sozialen, rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen, ohne diese jedoch detailliert für jede Kultur zu analysieren.
- Polyandrie bei verschiedenen antiken Völkern (Kelten, Spartaner)
- Polygynie in Mesopotamien, Makedonien und Persien
- Geschwisterehe im alten Ägypten
- Vergleichende Analyse der verschiedenen polygamischen Eheformen
- Untersuchung der zugrundeliegenden soziokulturellen und politischen Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der polygamischen Eheformen in der Antike ein und stellt fest, dass neben der monogamen Ehe, die von Römern und Griechen praktiziert wurde, auch Polygynie und Polyandrie in verschiedenen Kulturen vorkamen. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen nach den Gründen und Bedingungen für das Auftreten von Polygamie und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der exemplarisch verschiedene Kulturen beleuchtet. Die Einleitung verweist auf die Schwierigkeiten, aufgrund der Quellenlage eine detaillierte Analyse der politischen, sozialen, rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen für jede untersuchte Kultur zu liefern.
1. Polyandrie bei den Kelten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Caesars Bericht über polygame Ehen bei den Kelten Großbritanniens, wo Frauen gleichzeitig mit mehreren Männern, oft Brüdern oder Vätern mit Söhnen, verheiratet waren. Die Autorin verweist auf die mögliche matriarchalische Organisation der Inselkelten als Erklärung für diesen Sonderfall, der im Gegensatz zur monogamen Lebensweise der Festlandkelten steht. Der Bezug zum altirischen Recht, das Polygynie, nicht aber Polyandrie vorsah, wird ebenfalls erwähnt, um die Ausnahmecharakteristik der britischen keltischen Polyandrie zu betonen.
2. Polyandrie bei den Spartanern: (Es fehlt der Text zu diesem Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
3. Polygynie in Mesopotamien: (Es fehlt der Text zu diesem Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
4. Polygynie bei den Makedoniern: (Es fehlt der Text zu diesem Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
5. Polygynie bei den Persern: (Es fehlt der Text zu diesem Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
6. Geschwisterehe in Ägypten: (Es fehlt der Text zu diesem Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Polygamie, Polyandrie, Polygynie, Antike, Kelten, Spartaner, Mesopotamien, Makedonien, Perser, Ägypten, Geschwisterehe, Eheformen, Quellenkritik, soziale Strukturen, politische Systeme, matriarchalisch, patriarchisch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Polygame Eheformen in der Antike
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht verschiedene polygame Eheformen in der Antike, fokussiert auf Polyandrie und Polygynie in unterschiedlichen antiken Kulturen wie den Kelten, Spartanern, Mesopotamiern, Makedoniern, Persern und Ägypten (Geschwisterehe). Sie beleuchtet die Gründe für das Auftreten dieser Praktiken und die dazugehörigen politischen, sozialen, rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen. Eine detaillierte Analyse für jede Kultur wird aufgrund von Quellenbeschränkungen nicht angestrebt.
Welche polygame Eheformen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl Polyandrie (eine Frau mit mehreren Männern verheiratet) als auch Polygynie (ein Mann mit mehreren Frauen verheiratet). Konkret werden Beispiele aus verschiedenen antiken Kulturen untersucht, darunter Polyandrie bei den Kelten und Spartanern und Polygynie in Mesopotamien, Makedonien und Persien. Zusätzlich wird die Geschwisterehe im alten Ägypten thematisiert.
Welche Kulturen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert polygame Eheformen bei den Kelten (insbesondere in Großbritannien), den Spartanern, in Mesopotamien, bei den Makedoniern, den Persern und im alten Ägypten (im Kontext der Geschwisterehe). Die Analyse konzentriert sich auf exemplarische Fälle und bietet keine erschöpfende Darstellung jeder Kultur.
Welche Aspekte werden neben den Eheformen betrachtet?
Neben der Beschreibung der verschiedenen polygamischen Eheformen untersucht die Arbeit die soziokulturellen und politischen Faktoren, die mit diesen Praktiken in Verbindung stehen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die detaillierte Analyse dieser Faktoren aufgrund der Quellenlage eingeschränkt ist.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die bereitgestellte HTML-Datei enthält eine Zusammenfassung der Einleitung. Für die Kapitel über Polyandrie bei den Spartanern, Polygynie in Mesopotamien, Polygynie bei den Makedoniern, Polygynie bei den Persern und Geschwisterehe in Ägypten fehlt der Text und somit die jeweilige Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Polygamie, Polyandrie, Polygynie, Antike, Kelten, Spartaner, Mesopotamien, Makedonien, Perser, Ägypten, Geschwisterehe, Eheformen, Quellenkritik, soziale Strukturen, politische Systeme, matriarchalisch, patriarchisch.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit gestellt?
Zentrale Forschungsfragen sind die Gründe und Bedingungen für das Auftreten von Polygamie in verschiedenen antiken Kulturen. Die Arbeit versucht, die Verbreitung polygamer Praktiken und die damit verbundenen politischen, sozialen, rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen darzustellen.
Welche methodischen Einschränkungen werden genannt?
Die Arbeit weist auf die Schwierigkeiten hin, aufgrund der vorhandenen Quellenlage eine detaillierte Analyse der politischen, sozialen, rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen für jede untersuchte Kultur zu liefern. Die exemplarische Betrachtung verschiedener Kulturen spiegelt diese Einschränkung wider.
- Citation du texte
- M.A. Franziska Hirschmann (Auteur), 2007, Eheformen in der Antike, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123275