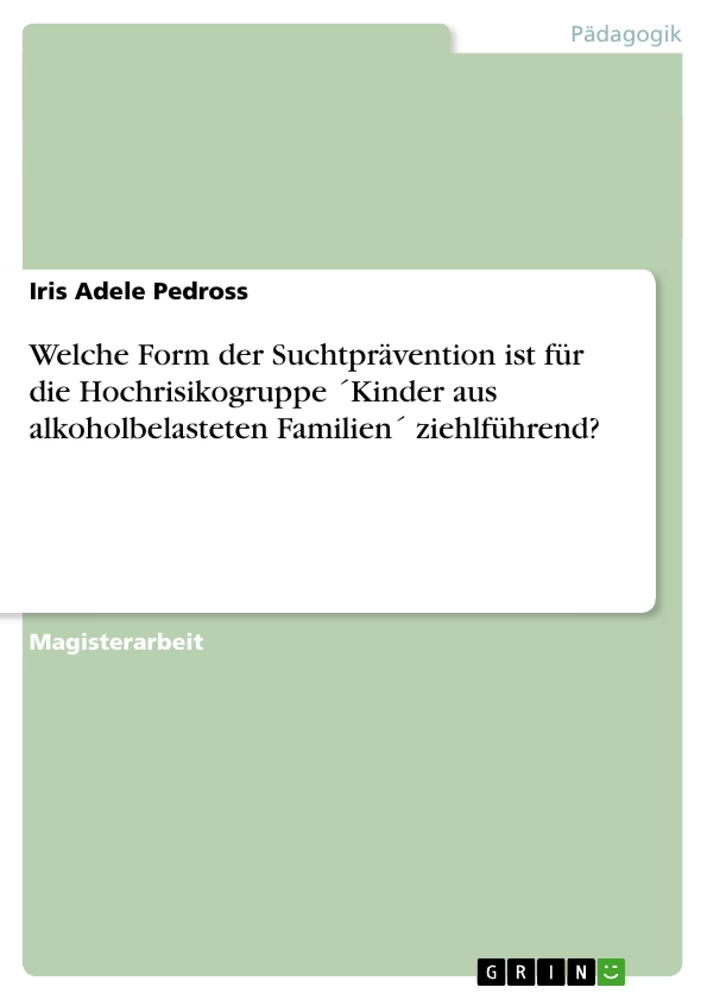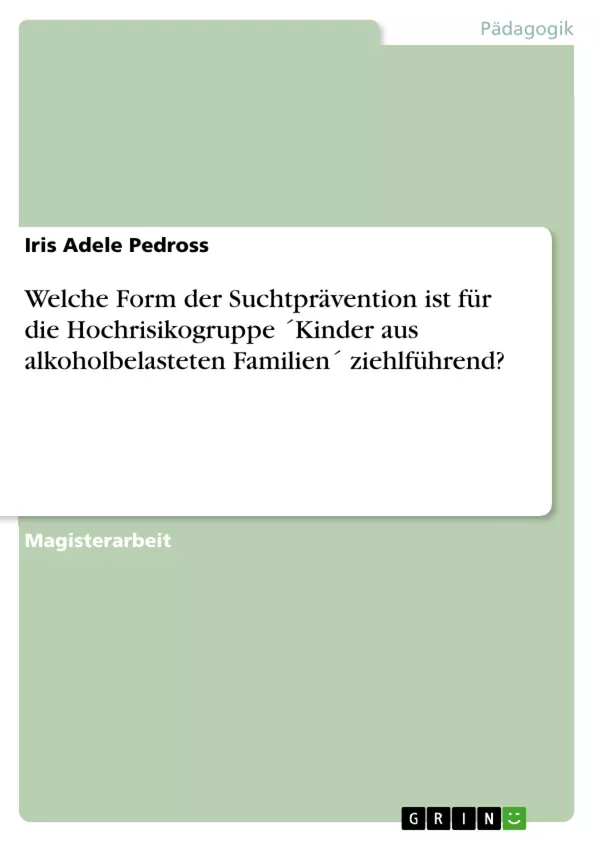Kinder aus alkoholbelasteten Familien gelten als Hochrisikogruppe in Bezug
auf die Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung. Es besteht zudem ein
erhöhtes Risiko, eine psychische, soziale und/oder somatische Störung im
Kindes-, und Jugend- sowie im Erwachsenenalter zu entwickeln. Mit der Frage,
welche Unterstützung im Rahmen der Suchtprävention angemessen erscheint
bzw. für die Zielgruppe „Kinder und Jugendliche aus alkoholbelasteten
Familien“ am wirksamsten ist, beschäftigt sich die gegenständliche
Diplomarbeit. Mit Hilfe einer ExpertInnenbefragung bei MitarbeiterInnen einer
Fachstelle für Prävention- und Gesundheitsförderung wird beleuchtet, ob
generalpräventive Maßnahmen für die Risikogruppe ausreichend sind oder ob
es zielgenaue selektive Präventionsmaßnahmen benötigt. Mit der Darstellung
und Diskussion der Ergebnisse sollen Impulse für die suchtpräventive Arbeit mit
der Zielgruppe: „Kinder aus alkoholbelasteten Familien“ beigesteuert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Forschungsinteresse und Einschränkung des Themenfeldes
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Forschungsverlauf
- 1.4 Gliederung der Arbeit
- 2 Theoretischer Teil
- 2.1 Inhalte und Strategien der Suchtprävention
- 2.1.1 Definition Suchtprävention
- 2.1.2 Entwicklung der modernen Suchtprävention
- 2.1.3 Präventionstypen
- 2.1.4 Zielgruppe der Suchtprävention
- 2.1.5 Ziele der Suchtprävention
- 2.1.6 Ansätze und Strategien der modernen Suchtprävention
- 2.2 Suchtprävention für die Risikogruppe „Kinder aus alkoholbelasteten Familien"
- 2.2.1 „Encare“(European Network for Children Affected by Risky Environments)
- 2.2.2 Kurzbeschreibung des Forschungsprojekts: „Kinder aus suchtbelasteten Familien - Theorie und Praxis der Prävention”
- 2.2.3 MultiplikatorInnenschulung - Curriculum
- 2.2.4 Direkte Angebote für Kinder aus alkoholbelasteten Familien
- 2.3 Theoretisches Hintergrundwissen zum spezifischen Thema
- 2.3.1 Alkohol im Kontext Familie
- 2.3.2 Psychopathologische Auswirkungen der elterlichen Alkoholabhängigkeit
- 2.3.3 Transmission der Alkoholabhängigkeit
- 2.3.4 Resilienz
- 3 Praktischer Teil
- 3.1 Grounded Theory
- 3.1.1 Kurz zur Grounded Theory
- 3.1.2 Vertiefung zur Grounded Theory
- 3.2 Datenerhebung
- 3.2.1 ExpertInneninterviews
- 3.2.2 Interviewleitfaden
- 3.2.3 Zugang zum Feld
- 3.2.4 Durchführung der Interviews
- 3.2.5 Transkription
- 3.3 Präzisierung der Fragestellungen
- 3.4 Datenauswertung - Anwendung der Grounded Theory
- 3.4.1 Kodieren
- 3.4.2 Eingrenzung der Zielsetzung
- 3.4.3 Theoretisches Sampling/Kontrastieren
- 3.4.4 Identifikation der zentralen Kernkategorie (selektives Kodieren)
- 3.4.5 Integration der Theorie
- 4 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5 Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Kategorie: Bewertung eines spezifischen Präventionsansatzes
- 5.1.1 Gefahr der Stigmatisierung
- 5.1.2 Berücksichtigung von Resilienzfaktoren
- 5.2 Kategorie: Erreichbarkeit der Zielgruppe durch ein direktes Angebot
- 5.2.1 Direktes generalpräventives Angebot
- 5.2.2 Direktes spezifisches Angebot bei gleichzeitiger therapeutischer Unterstützung der Eltern
- 5.3 Kategorie: Sinnhaftigkeit einer themen-spezifischen Fortbildung für MultiplikatorInnen
- 5.3.1 Sinnvoll im Sinne von Sensibilisierungsarbeit jedoch bei gleichzeitiger Bedenken
- 5.3.2 Ein spezifisches Angebot wird als nicht sinnvoll erachtet
- 6 Theoretisches Kontrastieren
- 7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Wirksamkeit verschiedener Suchtpräventionsansätze für Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Ziel ist es, herauszufinden, welche Maßnahmen am effektivsten sind und welche Aspekte bei der Entwicklung und Umsetzung von Präventionsprogrammen berücksichtigt werden sollten. * Wirksamkeit generalpräventiver Maßnahmen * Wirksamkeit selektiver Präventionsmaßnahmen * Bedeutung von Resilienzfaktoren * Rolle von Multiplikatoren in der Präventionsarbeit * Herausforderungen bei der Erreichbarkeit der ZielgruppeZusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt das Forschungsinteresse, die Fragestellung und den Forschungsverlauf. Kapitel 2 bietet einen theoretischen Überblick über Suchtprävention, verschiedene Präventionstypen und bestehende Programme für Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Es werden zudem relevante theoretische Konzepte wie Resilienz und die Transmission von Alkoholabhängigkeit behandelt. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Arbeit, insbesondere die Anwendung der Grounded Theory und die Durchführung von ExpertInneninterviews. Die Kapitel 4 und 5 präsentieren und diskutieren die Ergebnisse der Studie, wobei auf die Bewertung verschiedener Präventionsansätze, die Erreichbarkeit der Zielgruppe und die Rolle von Multiplikatoren eingegangen wird.Schlüsselwörter
Suchtprävention, Kinder aus alkoholbelasteten Familien, Hochrisikogruppe, generalpräventive Maßnahmen, selektive Präventionsmaßnahmen, Resilienz, ExpertInneninterviews, Grounded Theory, MultiplikatorInnen, Stigmatisierung.Häufig gestellte Fragen
Warum gelten Kinder aus alkoholbelasteten Familien als Hochrisikogruppe?
Sie haben ein deutlich erhöhtes Risiko, selbst eine Abhängigkeit oder psychische, soziale und somatische Störungen zu entwickeln.
Was ist das Ziel dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht, welche Suchtpräventionsmaßnahmen für Kinder aus alkoholbelasteten Familien am wirksamsten sind und ob spezifische Angebote nötig sind.
Was ist der Unterschied zwischen generalpräventiven und selektiven Maßnahmen?
Generalpräventive Maßnahmen richten sich an alle Kinder, während selektive Maßnahmen gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse von Risikogruppen zugeschnitten sind.
Welche Rolle spielen Resilienzfaktoren in der Prävention?
Resilienzfaktoren helfen Kindern, trotz der belastenden familiären Situation gesund zu bleiben, und sind ein zentraler Aspekt moderner Präventionsansätze.
Wie wurden die Daten für diese Arbeit erhoben?
Es wurden ExpertInneninterviews mit MitarbeiterInnen einer Fachstelle für Prävention durchgeführt und mittels der Grounded Theory ausgewertet.
Besteht bei spezifischen Angeboten die Gefahr der Stigmatisierung?
Ja, die Arbeit diskutiert kritisch, ob gezielte Angebote für diese Gruppe zu einer ungewollten Stigmatisierung der betroffenen Kinder führen können.
- Citation du texte
- Magistra Iris Adele Pedross (Auteur), 2008, Welche Form der Suchtprävention ist für die Hochrisikogruppe ´Kinder aus alkoholbelasteten Familien´ ziehlführend?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123421