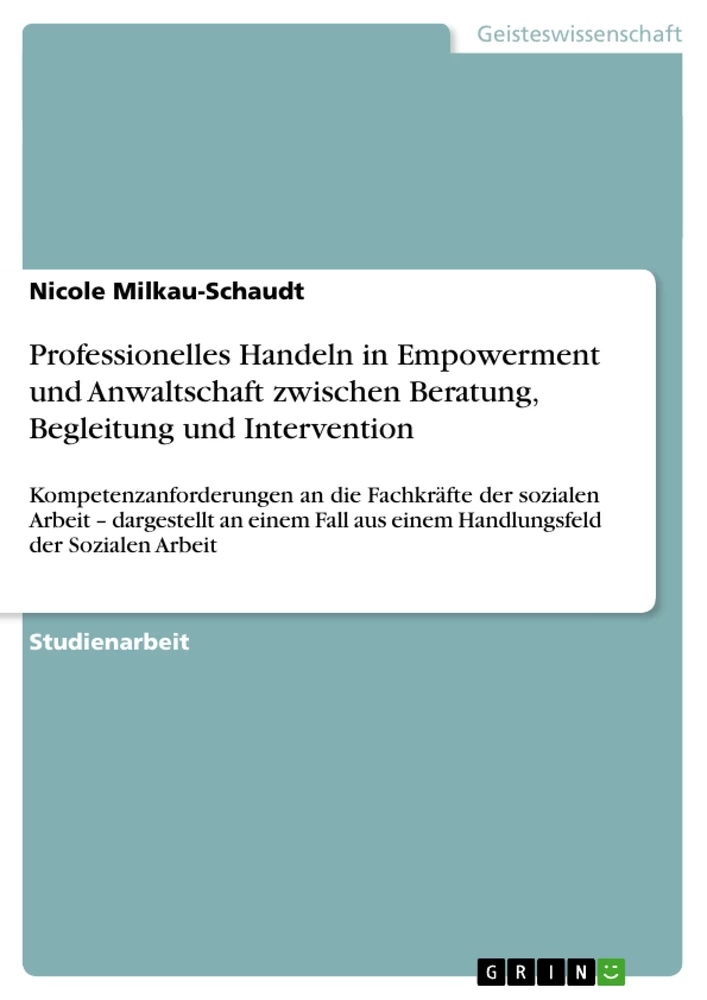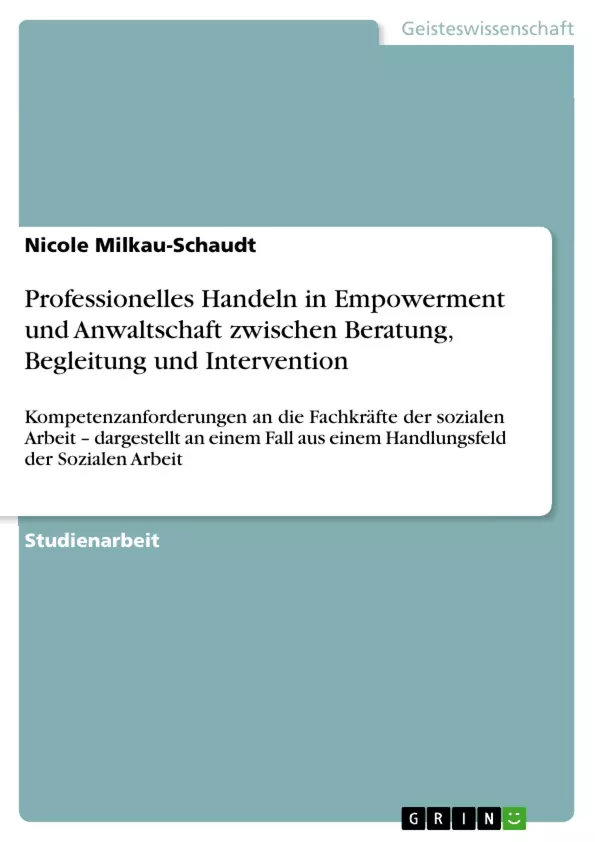In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit den Kompetenzanforderungen an
Fachkräfte der Sozialen Arbeit beschäftigen, welche Empowerment in ihre Arbeit
integrieren möchten.
Ich habe mir diese Fragestellung ausgesucht, da ich es anstrebe im Bereich der
Frauenarbeit tätig zu werden und ich mich immer wieder mit damit beschäftige was in
bestimmten Handlungsfeldern machbar ist und welche Voraussetzungen gegeben
sein müssen, damit etwas gelingen kann. Durch die Bearbeitung der Parteilichkeit in
der zweiten Teilprüfungsleistung sehe ich dies nun als Erweiterung und Ergänzung.
Beginnend mit einem kurzen Rückblick auf Empowerment, folgt die Überlegung
welche allgemeinen Kompetenzen im Bereich der Sozialen Arbeit notwendig sind,
welche dies explizit im Arbeitsfeld von Empowerment und Anwaltschaft darstellen
und warum eben diese so wichtig sind.
Mit Hilfe des Beispiels einer Einrichtung für Frauen in schwierigen Lebenssituationen
möchte ich die erörterten Kompetenzen in die Praxis übertragen. Ich ermesse, wie
dies konkret aussehen könnte – und auch, ob empowermentorientiertes Handeln
denn überhaupt uneingeschränkt möglich ist. Den Abschluss bildet ein persönliches
Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzer Rückblick: Empowerment
- Allgemeine Kompetenzanforderungen an die Fachkräfte der Sozialen Arbeit
- Kompetenzanforderungen an die Fachkräfte im Bereich Empowerment und Anwaltschaft
- Kompetenzanforderungen auf intrapersoneller Ebene
- Kompetenzanforderungen auf der Beziehungsebene zwischen Fachkraft und Betroffenen
- Kompetenzanforderungen auf der institutionellen Ebene
- Empowerment am Beispiel: Der Tagestreff „Femmetastisch“ für Frauen in schwierigen Lebenssituationen
- Kompetenzanforderungen an die Mitarbeiterinnen
- Wo liegen die Schwierigkeiten in der Umsetzung von Empowerment?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kompetenzanforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die Empowerment in ihre Praxis integrieren möchten. Der Fokus liegt auf der Analyse der notwendigen Kompetenzen auf intrapersonaler, zwischenmenschlicher und institutioneller Ebene. Ein Fallbeispiel – der Tagestreff „Femmetastisch“ – illustriert die praktischen Herausforderungen und Möglichkeiten empowermentorientierten Handelns.
- Kompetenzanforderungen im Kontext von Empowerment und Anwaltschaft
- Intrapersonale Kompetenzen der Fachkraft (Selbstreflexion, Perspektivwechsel)
- Beziehungsarbeit im Empowerment (Gleichberechtigung, Vertrauen, Ressourcenaktivierung)
- Institutionelle Rahmenbedingungen für Empowerment
- Praktische Herausforderungen bei der Umsetzung von Empowerment
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 bietet einen kurzen Überblick über das Konzept des Empowerment. Kapitel 3 behandelt allgemeine Kompetenzanforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit. Kapitel 4 analysiert spezifische Kompetenzanforderungen im Bereich Empowerment und Anwaltschaft, unterteilt nach intrapersonaler, Beziehungsebene und institutioneller Ebene. Kapitel 5 präsentiert den Tagestreff „Femmetastisch“ als Fallbeispiel und beleuchtet die dort relevanten Kompetenzanforderungen und Herausforderungen der Umsetzung von Empowerment.
Schlüsselwörter
Empowerment, Anwaltschaft, Soziale Arbeit, Kompetenzanforderungen, Fachkräfte, Ressourcenaktivierung, Selbstbestimmung, Partizipation, Beziehungsgestaltung, Institutionelle Ebene, Fallbeispiel, „Femmetastisch“, Frauen in schwierigen Lebenssituationen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kompetenzanforderungen für Empowerment in der Sozialen Arbeit?
Fachkräfte benötigen intrapersonelle Kompetenzen wie Selbstreflexion, Beziehungs-Kompetenzen zur Ressourcenaktivierung und institutionelles Wissen zur Förderung der Partizipation.
Was versteht man unter „Anwaltschaft“ in diesem Kontext?
Anwaltschaft bedeutet, sich parteilich für die Rechte und Interessen der Betroffenen einzusetzen, besonders wenn diese ihre Anliegen nicht selbst vertreten können.
Warum ist Ressourcenaktivierung ein Kern von Empowerment?
Statt Defizite zu fokussieren, geht es darum, die vorhandenen Stärken und Fähigkeiten der Klienten zu entdecken und für ein selbstbestimmtes Leben zu nutzen.
Was illustriert das Beispiel des Tagestreffs „Femmetastisch“?
Es zeigt die praktische Umsetzung von Empowerment für Frauen in schwierigen Lebenslagen und beleuchtet die täglichen Herausforderungen und Grenzen dieses Ansatzes.
Gibt es Grenzen für empowermentorientiertes Handeln?
Ja, institutionelle Zwänge, rechtliche Rahmenbedingungen oder mangelnde Ressourcen können die Möglichkeiten zur vollständigen Selbstbestimmung der Klienten einschränken.
- Citation du texte
- Nicole Milkau-Schaudt (Auteur), 2008, Professionelles Handeln in Empowerment und Anwaltschaft zwischen Beratung, Begleitung und Intervention , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123759