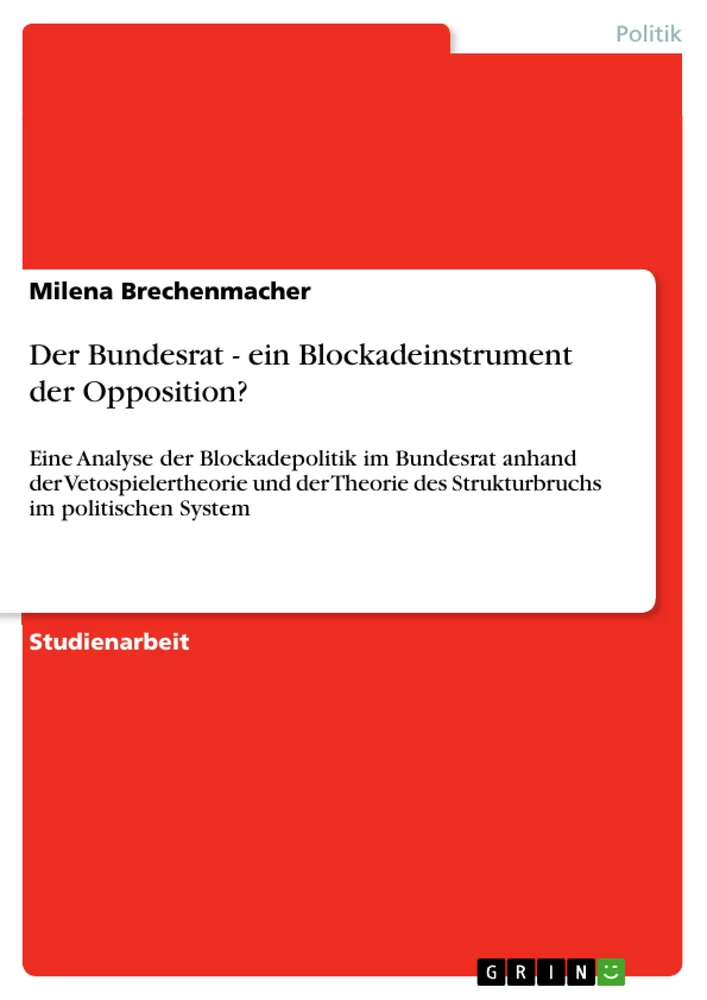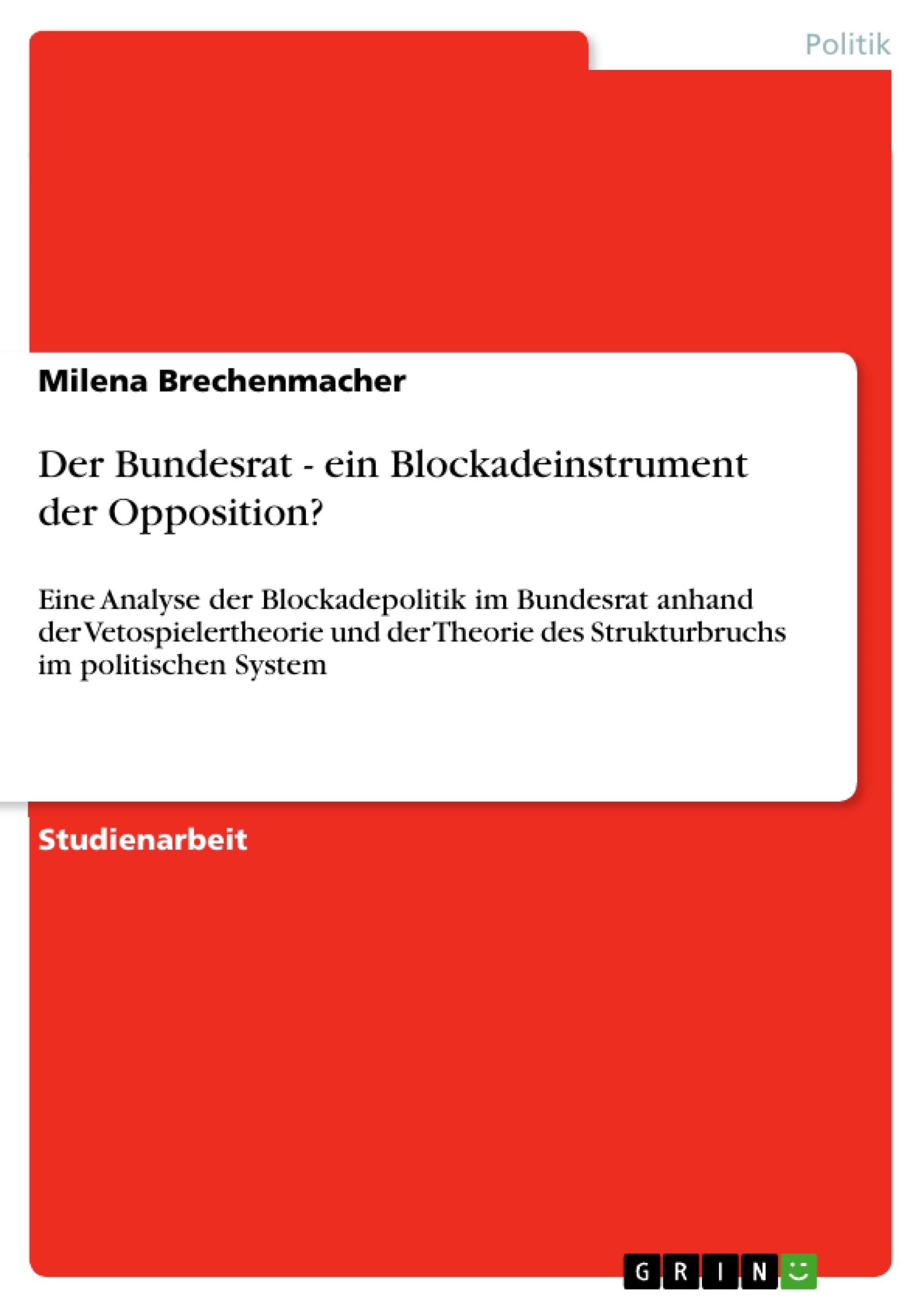In dieser Arbeit sollen zwei theoretische Konzepte, auf ihre Erklärungskraft hinsichtlich der Blockadepolitik im Bundesrat, untersucht werden. Die Leistungsfähigkeit der Theorien, die Entstehung von Blockaden hinreichend zu erklären soll exemplarisch an zwei Beispielen, den Steuerreformen von 1992 und 1998, aufgezeigt werden. [...]
Im ersten Teil der Arbeit wird untersucht, inwieweit sich Blockaden im Bundesrat mit der Vetospielertheorie von George Tsebelis (Tsebelis 1995; 2002) erklären lassen.
Zunächst werden die Grundzüge der Theorie, sowie eine Erweiterung des Konzepts durch Uwe Wagschal (2005), dargestellt. Anschließend wird erläutert, inwiefern der Bundesrat als Vetospieler bezeichnet werden kann. Zuletzt soll am Beispiel der Steuerreformen von 1992 und 1998 dargelegt werden, ob sich Blockaden mit diesem Konzept hinreichend erklären lassen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit wird, ausgehend von der Theorie des Strukturbruchs im politischen System von Gerhard Lehmbruch (Lehmbruch 2000), ein zweiter theoretischer Erklärungsrahmen für die Blockaden im Bundesrat aufgestellt. Es soll ebenfalls untersucht werden, ob sich die Vorgänge der Steuerreformen mit diesem Konzept erklären lassen.
Wie oben beschrieben, werden in dieser Arbeit zwei Steuerreformen exemplarisch zur Veranschaulichung von Blockaden im Bundesrat behandelt. Eine der beiden Reformen scheiterte am Veto des Bundesrates, die andere konnte trotz erheblichen Widerstandes durchgesetzt werden. Auf diese beiden Reformen wird in den einzelnen Kapiteln der Arbeit Bezug genommen. Im Folgenden sollen diese beiden Steuerreformen vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Bundesrat als Vetospieler
- Die Vetospielertheorie nach George Tsebelis
- Der Bundesrat - institutioneller und kompetitiver parteipolitischer Vetospieler?
- Die Bedeutung des Indikators Kohäsion für Blockaden im Bundesrat
- Der Bundesrat im Mittelpunkt inkongruenter Handlungslogiken
- Die Theorie des Strukturbruchs im politischen System nach Gerhard Lehmbruch
- Die Logik des föderalen Systems: Zwang zu Kooperation und Verhandlung
- Die Logik des Parteiensystems: Kompetitives Verhalten der Parteien
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Blockadepolitik im Bundesrat anhand zweier Steuerreformen der 1990er Jahre. Sie analysiert, inwieweit die Vetospielertheorie von George Tsebelis und die Theorie des Strukturbruchs von Gerhard Lehmbruch diese Blockaden erklären können.
- Analyse der Blockadepolitik im Bundesrat
- Anwendung der Vetospielertheorie auf den Bundesrat
- Anwendung der Theorie des Strukturbruchs auf den Bundesrat
- Fallstudien: Steuerreformen 1992 und 1998
- Bewertung der Erklärungskraft beider Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen von Blockaden im Bundesrat und die gewählte Methodik vor. Sie führt die Steuerreformen von 1992 und 1998 als Fallbeispiele ein.
Der Bundesrat als Vetospieler: Dieses Kapitel beschreibt die Vetospielertheorie von Tsebelis und untersucht, ob der Bundesrat als Vetospieler im politischen System fungiert. Es wird die Anwendbarkeit der Theorie auf die beiden Fallstudien beleuchtet.
Der Bundesrat im Mittelpunkt inkongruenter Handlungslogiken: Dieses Kapitel präsentiert die Theorie des Strukturbruchs nach Lehmbruch und analysiert, wie die Logiken des föderalen und des Parteiensystems im Bundesrat interagieren und zu Blockaden führen können. Die Anwendung auf die Fallstudien wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Bundesrat, Vetospielertheorie, Tsebelis, Strukturbruch, Lehmbruch, Steuerreformen, Blockadepolitik, Föderalismus, Parteiensystem, Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Bundesrat ein Blockadeinstrument der Opposition?
Die Arbeit untersucht diese Frage anhand politikwissenschaftlicher Theorien und der Analyse von Steuerreformen in den 1990er Jahren.
Was besagt die Vetospielertheorie von George Tsebelis?
Sie erklärt politische Blockaden durch die Anzahl der Akteure (Vetospieler), deren Zustimmung für eine Status-quo-Änderung notwendig ist.
Was versteht Gerhard Lehmbruch unter dem „Strukturbruch“?
Der Strukturbruch beschreibt den Konflikt zwischen der Logik des föderalen Systems (Kooperationszwang) und der Logik des Parteiensystems (Wettbewerb).
Welche Fallbeispiele werden zur Veranschaulichung genutzt?
Die Arbeit analysiert die Steuerreformen von 1992 und 1998, von denen eine am Veto des Bundesrates scheiterte.
Wie beeinflusst die Parteipolitik die Arbeit des Bundesrates?
Durch unterschiedliche Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat kann der Bundesrat zum kompetitiven parteipolitischen Vetospieler werden.
- Citation du texte
- Milena Brechenmacher (Auteur), 2008, Der Bundesrat - ein Blockadeinstrument der Opposition? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124024