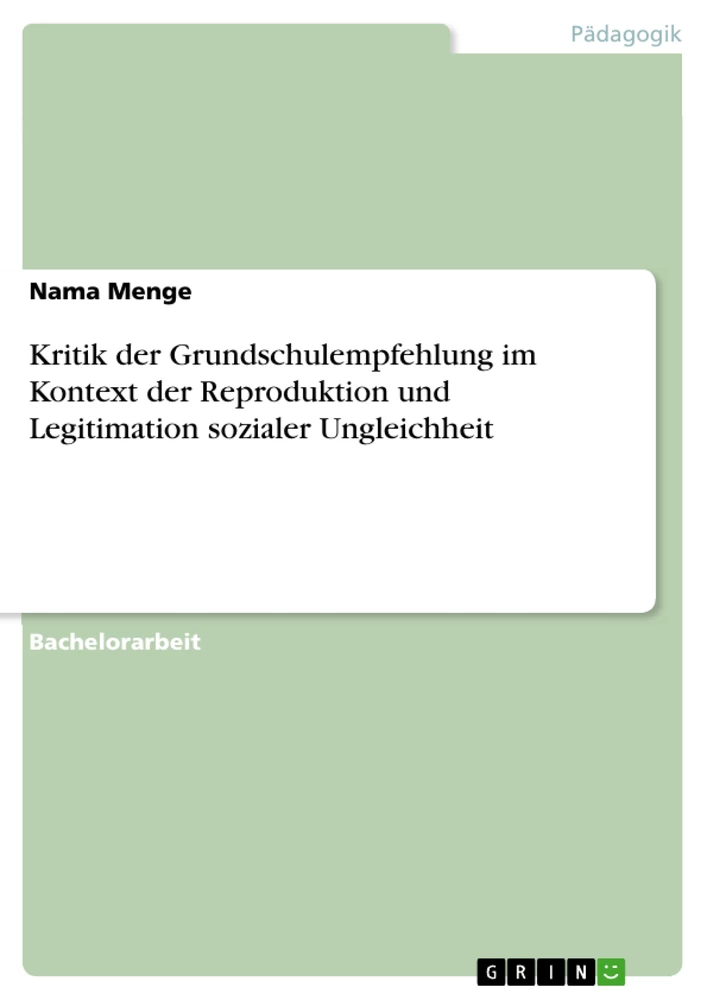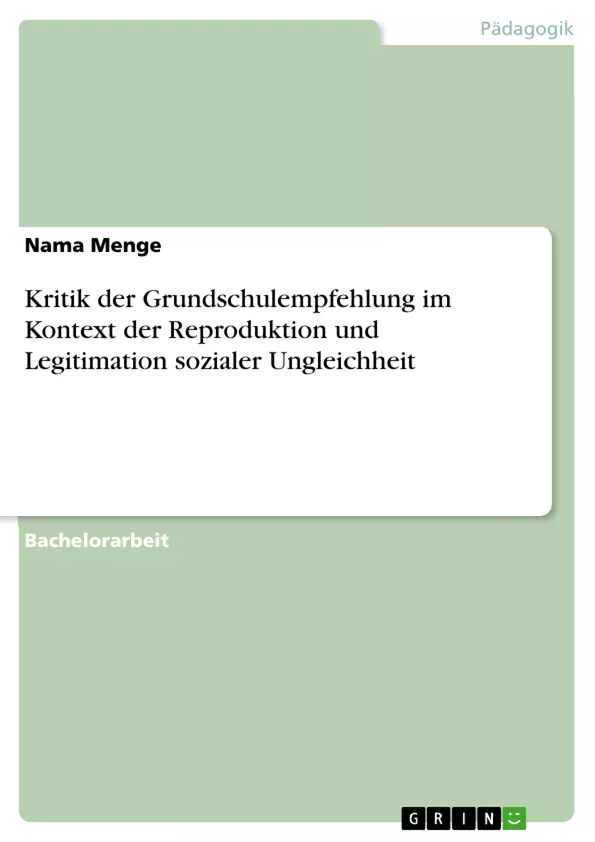Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Rolle die Grundschulempfehlung bei der Reproduktion und Legitimation sozialer Ungleichheit spielt und wie genau sie diese fördert.
Spricht man über soziale Ungleichheiten, so spricht man zwingend über sozio-ökonomische Schichten. Hinter diesen verbergen sich mehrere Faktoren, die definierend und maßgebend sind. Vor allem das kulturelle Kapital und der Habitus sind für diese Untersuchung von großer Bedeutung, da sie auf den Bildungsweg und den Bildungserfolg einen großen Einfluss haben. Daher fängt diese Arbeit mit der Abhandlung über den Habitus und das kulturelle Kapital.
Folgend werden die Grundschulempfehlung, ihre Entstehungsgeschichte und der rechtliche Rahmen, Abläufe und Prozesse behandelt. Es gibt viele Begrifflichkeiten, die die grundschulische Empfehlung der Schulform der Sekundarstufe I bezeichnen. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, werden in dieser Arbeit die Begriffe Grundschulempfehlung, Übergangsempfehlung, Schulformempfehlung etc. als Sammelbegriffe verwendet. Bildung ist Ländersache. Alle Bundesländer haben unterschiedliche Schulstrukturen. Die einzige Schulform der Sekundarstufe I, die in allen Teilen Deutschlands vertreten ist, ist das Gymnasium. Die Anzahl und die Art der Alternativen sind jedoch unterschiedlich. Nichtdestotrotz bleibt das Gymnasium die beliebteste Schulform. Da es unter den Bundesländern einen Trend zur Zweigliedrigkeit gibt, konzentriert sich diese Arbeit vor allem auf die Wahl zwischen einem Gymnasium und einer alternativen nichtgymnasialen Schulform.
Abschließend wird das Phänomen Grundschulempfehlung mit den Theorien des Habitus und des kulturellen Kapitals nach der Frage des genauen Beitrags zur Reproduktion und Legitimation sozialer Ungleichheit untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien von Bourdieu als Grundlage für die weitere Untersuchung
- 2.1. Das kulturelle Kapital
- 2.2. Habitus
- 3. Grundschulempfehlung - Geschichte und rechtlicher Rahmen
- 3.1. Die Entstehung der Grundschule und der Grundschulempfehlung
- 3.2. Rechtlicher Rahmen
- 4. Die Rolle der Grundschulempfehlung in der Reproduktion und Legitimation sozialer Ungleichheit
- 4.1. Kritik des rechtlichen Rahmens
- 4.2. Die Rolle des Schüler*innenhabitus
- 4.3. Die Bedeutung der Lehrer*innen und ihres Habitus für den Übergang
- 4.3.1. Das pädagogische Urteil
- 4.3.2. Bezug auf Noten als Fairness-Faktor?
- 4.4. Direkter und indirekter Einfluss der Eltern
- 4.5. Wie die Sekundarschulen ihre Schülerschaft wählen
- 4.6. Gibt es einen Unterschied bezüglich des Verbindlichkeitscharakters?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Rolle der Grundschulempfehlung bei der Reproduktion und Legitimation sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. Dabei wird die Frage beleuchtet, wie die Grundschulempfehlung die Chancenungleichheit zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft verstärkt und damit die Bildungsungleichheit reproduziert.
- Die Bedeutung des kulturellen Kapitals und des Habitus nach Pierre Bourdieu für die Bildungschancen von Kindern
- Die historische Entwicklung und der rechtliche Rahmen der Grundschulempfehlung in Deutschland
- Die Kritik am rechtlichen Rahmen der Grundschulempfehlung im Hinblick auf die Förderung von sozialer Ungleichheit
- Die Rolle des Schüler*innenhabitus und der Lehrer*innen sowie deren Habitus für die Entscheidungsfindung bei der Grundschulempfehlung
- Der Einfluss von Eltern und Sekundarschulen auf die Wahl der Schulform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik der Bildungsungleichheit in Deutschland und führt in die Thematik der Grundschulempfehlung ein. Kapitel 2 stellt die Theorien von Pierre Bourdieu, insbesondere das kulturelle Kapital und den Habitus, als Grundlage für die Untersuchung der Grundschulempfehlung vor. Kapitel 3 befasst sich mit der Entstehung und dem rechtlichen Rahmen der Grundschulempfehlung. In Kapitel 4 wird die Rolle der Grundschulempfehlung in der Reproduktion und Legitimation sozialer Ungleichheit genauer betrachtet, indem die Kritik am rechtlichen Rahmen, der Einfluss des Schüler*innenhabitus und der Lehrer*innen, die Bedeutung der Eltern und die Auswahlverfahren an Sekundarschulen untersucht werden. Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Grundschulempfehlung, soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, kulturelles Kapital, Habitus, Reproduktion, Legitimation, Schüler*innenhabitus, Lehrer*innenhabitus, rechtlicher Rahmen, Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Grundschulempfehlung die soziale Ungleichheit?
Sie wirkt oft als Weichenstellung, die Kinder aus bildungsfernen Schichten trotz gleicher Leistung seltener für das Gymnasium empfiehlt.
Was versteht Pierre Bourdieu unter "kulturellem Kapital"?
Es umfasst Bildung, Wissen und kulturelle Güter, die innerhalb der Familie weitergegeben werden und den Schulerfolg maßgeblich bestimmen.
Welche Rolle spielt der Habitus der Lehrer?
Der Habitus der Lehrkräfte beeinflusst deren pädagogisches Urteil, was unbewusst zur Bevorzugung von Kindern mit ähnlichem sozialen Hintergrund führen kann.
Sind Noten ein objektiver Fairness-Faktor?
Die Arbeit hinterfragt dies kritisch, da auch die Notengebung bereits durch soziale Erwartungshaltungen beeinflusst sein kann.
Warum ist die Wahl zwischen Gymnasium und nichtgymnasialer Form so zentral?
Aufgrund des zweigliedrigen Schulsystems in vielen Bundesländern entscheidet dieser Übergang massiv über die späteren Berufs- und Lebenschancen.
- Quote paper
- Nama Menge (Author), 2022, Kritik der Grundschulempfehlung im Kontext der Reproduktion und Legitimation sozialer Ungleichheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1243308