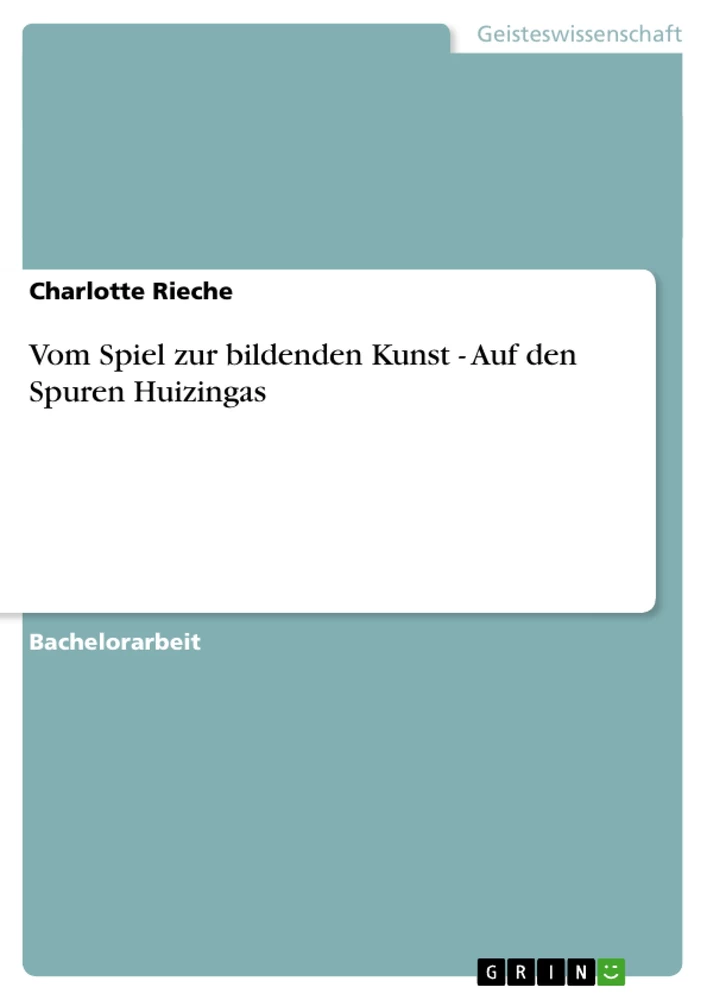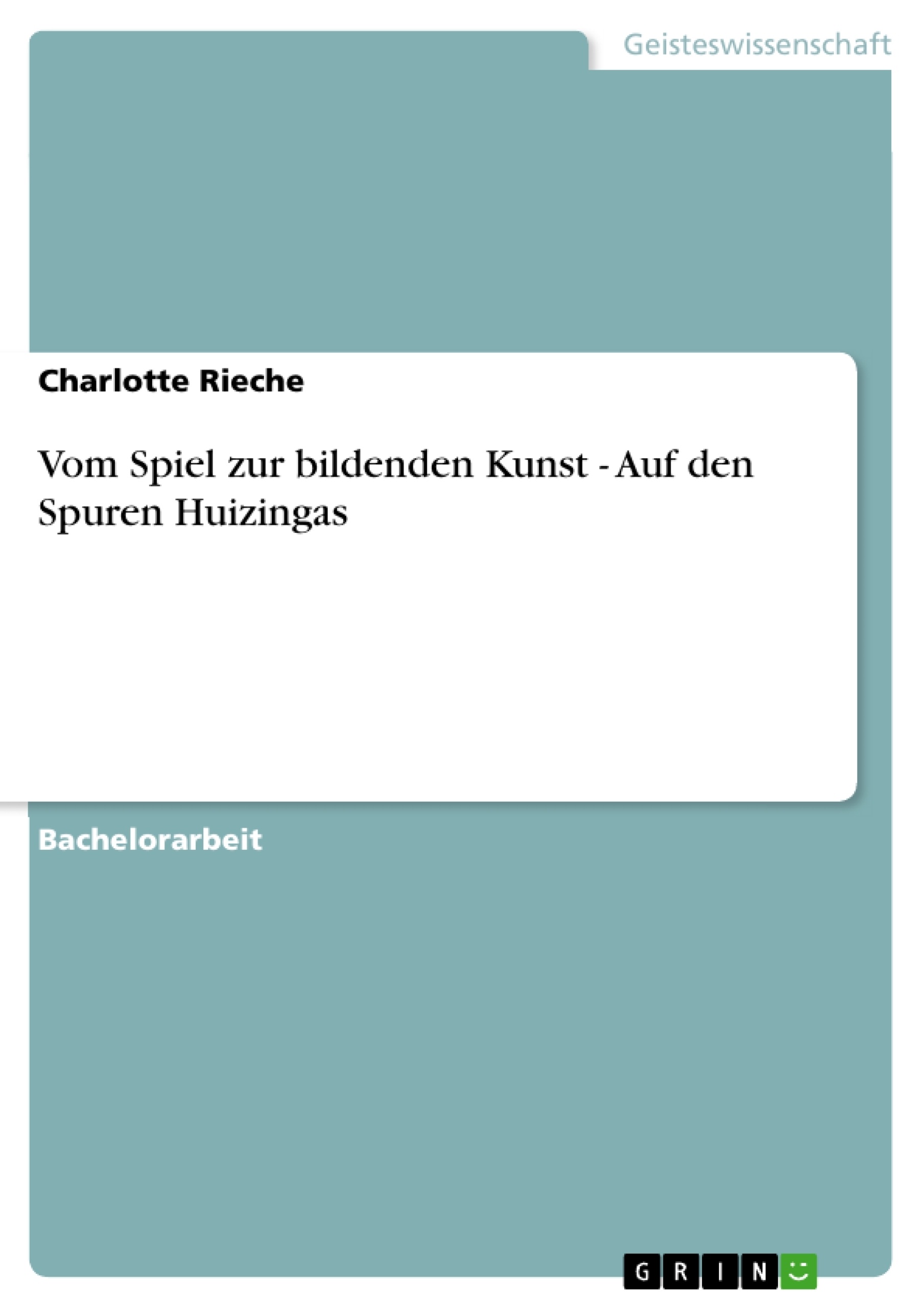1. Einleitung
Das Spiel ist nach Johan Huizinga in nahezu allen Kulturformen zu finden. Einzig die bildende Kunst stellt eine Ausnahme dar. Ihr spricht er den Spielcharakter ab. Dies reizt zum Widerspruch und so soll in folgender Arbeit, 70 Jahre nach Huizingas Schrift, der Versuch unternommen werden, seine Spieltheorie auch auf Bereiche der bildenden Kunst auszuweiten. Unter Berücksichtigung und nach Untersuchung sowohl philosophischer als auch kunstgeschichtlicher Erscheinungen der bildenden Kunst kann das Spielhafte auch in diesem, von ihm ohne Spielcharakter befundenen Bereich einer Gesellschaft, entdeckt werden.
Beschäftigt man sich mit dem Spiel unter medienphilosophischen und kulturellgesellschaftlichen Aspekten, kommt man nicht umhin, sich auch mit den Betrachtungen des Geschichtswissenschaftlers Johan Huizinga auseinanderzusetzen. Da ihm die Begriffe eines „Homo sapiens“ (der vernünftige Mensch) und in Ergänzung eines „Homo faber“ (der tätige Mensch) die Gattung Mensch nicht ausreichend „griffen“, begründete er in seinem kulturphilosophischen
Werk „Homo Ludens – Vom Ursprung der Kultur im Spiel“1 den spielenden
Menschen. Mit dieser Schrift schuf Huizinga ein bis heute sehr bedeutendes Werk der Spielforschung. 1938 schreibt Johan Huizinga vom Ursprung der Kultur im Spiel, dem Fortschritt der Kultur durch Spiel und die zu anderen Kulturformen vergleichsweise geringe Spielhaftigkeit der bildenden Künste. Huizinga definiert aus seinem ganz persönlichen, durch jahrelange Beschäftigung mit dem Thema gebildeten Standpunkt eine eigene Auffassung von Spiel und wie es in dieser Definition Trieb- und Lenkwerk der kulturellen Entwicklung menschlicher
Gemeinschaften ist. Während er gesellschaftliche Aktionsfelder wie Recht, Glauben, Krieg und Wissen in einen logischen Kontext zur Spielhaltung des Menschen bringt, spricht er den Produkten, dem Produzieren und der Rezeption der bildenden Künste eine einleuchtende und logische Zuordnung zum Spiel ab.
Mit nachstehender Untersuchung Huizingas philosophischer Betrachtungen möchte ich gerade diesen Aspekt aufgreifen und, ausgehend von seiner Grundidee, einen Bogen über Spielcharakter und spielerische Ausdruckformen der Bildenden Kunst spannen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Johan Huizingas Spieltheorie
- Das Leben Johan Huizingas
- Homo Ludens - Besonderheiten des neuen kulturanthropologischen Ansatzes Huizingas
- Der Begriff des Spiels nach Huizinga
- Spiel und kulturelle Erscheinungsformen
- Spiel im kulturellen Kontext Huizingas Zeit
- Die Spielformen der Kunst und Huizingas Ausschluss von Spiel als Bestandteil bildender Kunst
- Kulturphilosophische und kulturtheoretische Untersuchung zur bildenden Kunst
- Was ist Kunst? - Der Begriff der bildenden Kunst
- Kunst nach Immanuel Kant
- Kunst nach Herbert Mainusch
- Das Kunstwerk und seine Wirkung
- Magrittes Pfeife und der sichtbare Gedanke
- Das Leben und das Kunstverständnis René Magrittes
- Magrittes Pfeife („Der Verrat der Bilder“)
- Joan Miró, Paul Klee und das Spiel in der Malerei
- Zusammenfassung zur bildenden Kunst
- Spiel und bildende Kunst - Der Versuch einer Symbiose
- Binden, Verstecken, Verrätseln und Verkleiden - Das Spielmoment im Kunstschaffen
- Suchen, Lösen, Spüren und Betreten - Die Spielhaltung bei der Rezeption
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Spieltheorie Johan Huizingas und deren Anwendbarkeit auf die bildende Kunst. Huizinga schließt die bildende Kunst von seinem Spielbegriff aus, was diese Arbeit hinterfragt und versucht, die Spielhaftigkeit in diesem Bereich aufzuzeigen.
- Johan Huizingas Spieltheorie und der "Homo Ludens"
- Philosophische und kulturtheoretische Ansätze zur bildenden Kunst
- Analyse konkreter Kunstwerke im Hinblick auf ihre Spielhaftigkeit (z.B. Magritte)
- Das Spielmoment im Kunstschaffen und in der Kunstwahrnehmung
- Ein erweiterter Spielbegriff für die bildende Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Fragestellung. Kapitel 2 präsentiert Huizingas Leben und seine Spieltheorie, mit Fokus auf seine Ausschluss der bildenden Kunst von seinem Spielbegriff. Kapitel 3 untersucht kulturphilosophische und kulturtheoretische Ansätze zur bildenden Kunst, unter Einbezug von Kant und Mainusch, und analysiert ausgewählte Kunstwerke von Magritte, Miró und Klee. Kapitel 4 versucht, eine Symbiose zwischen Huizingas Spieltheorie und der bildenden Kunst herzustellen, indem es die Spielhaftigkeit im Kunstschaffen und der Rezeption beleuchtet.
Schlüsselwörter
Johan Huizinga, Homo Ludens, Spieltheorie, bildende Kunst, Kunstphilosophie, Kulturtheorie, René Magritte, Joan Miró, Paul Klee, Spielhaftigkeit, Kunstgenuss, Kunstschaffen.
- Citation du texte
- Charlotte Rieche (Auteur), 2008, Vom Spiel zur bildenden Kunst - Auf den Spuren Huizingas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124708