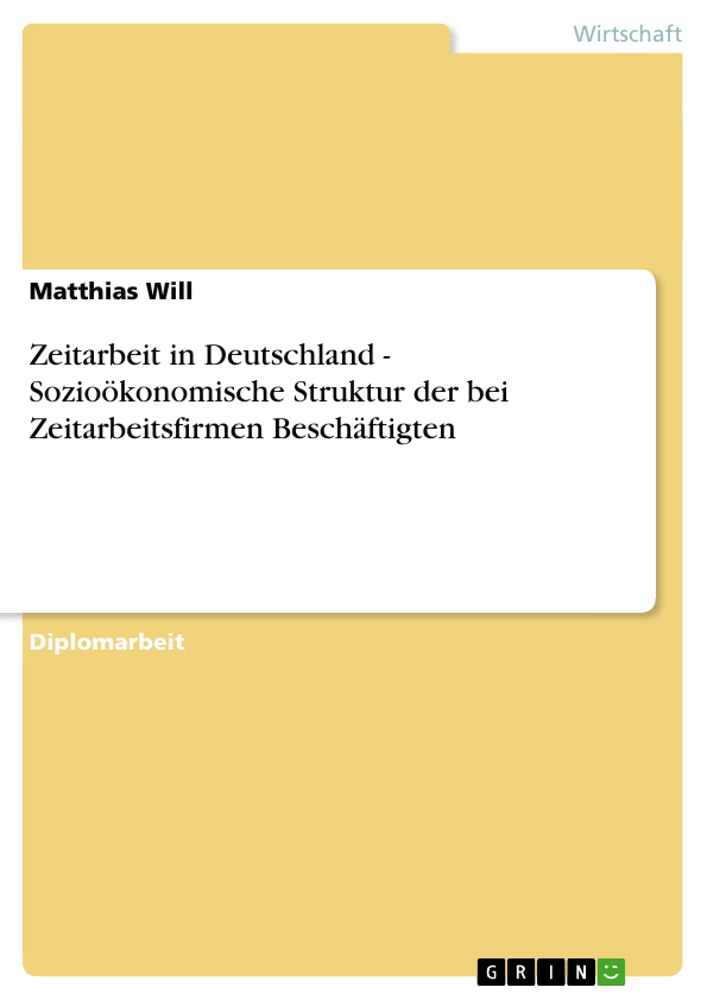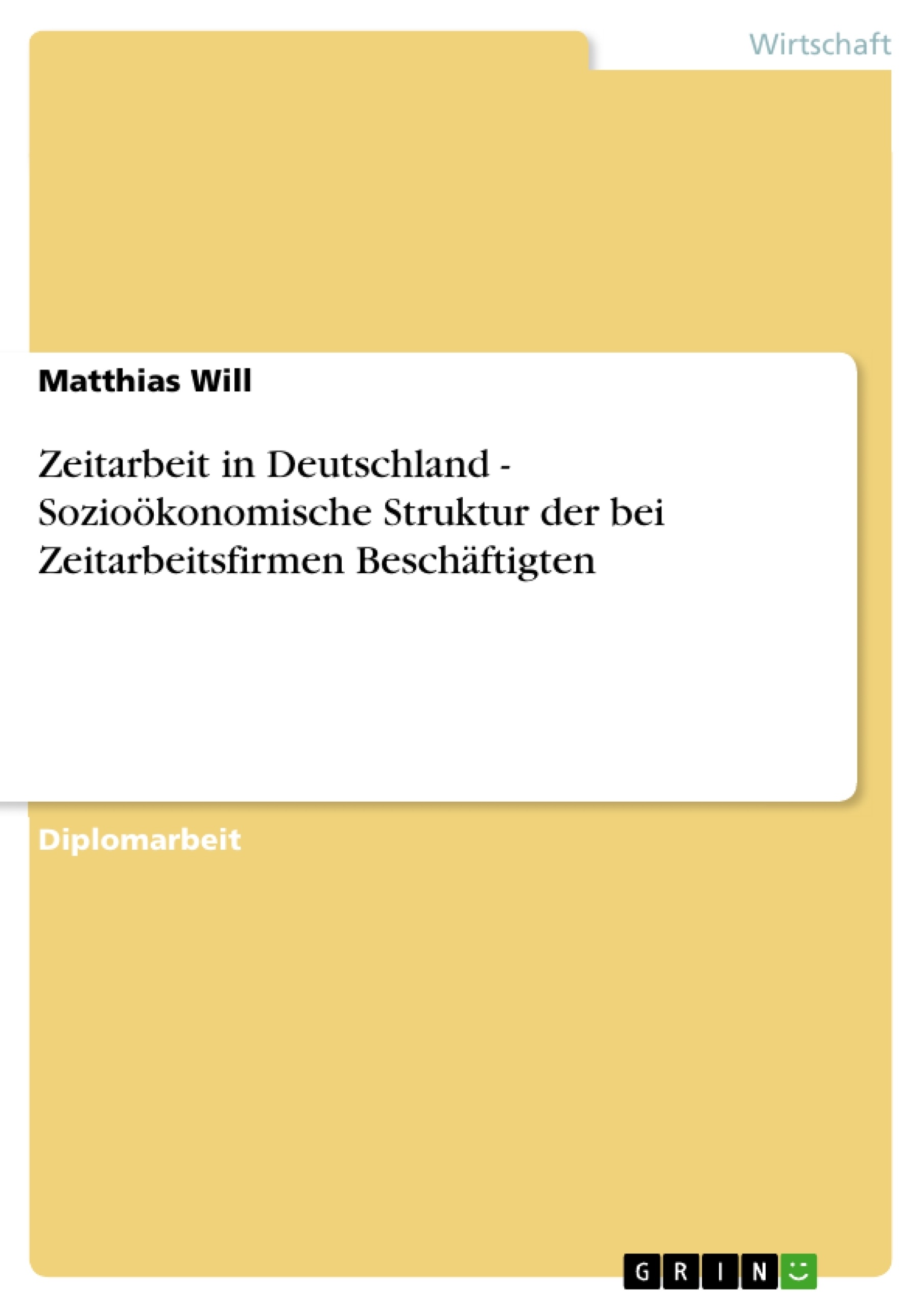Zeitarbeit hat am Arbeitsmarkt in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und trägt nicht unwesentlich zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes bei. Dieser Bereich ist aber noch mit vielen Vorurteilen besetzt und wird teilweise von kontroversen Diskussionen um Nutzen und Gefahren begleitet. Gerade in den letzten Jahren ist aber ein Imagewandel der Zeitarbeitsbranche erkennbar, der durch eine zunehmende Deregulierung der Branche begleitet wird.
Sind in der Fachliteratur viele theoretische Ansätze über Zeitarbeit vorhanden, fehlen häufig empirische Auswertungen zu dieser Thematik oder sind auf Grund der Dynamik und des Wachstums dieser Branche nicht mehr zeitgemäß. So wird in älteren Publikationen vorrangig auf technische Berufe mit niedrigen Qualifikationsanforderungen abgestellt. Dies ist zwar weiterhin ein Hauptbestandteil des Angebots von Verleihbetrieben, jedoch diversifiziert sich das Angebot mittlerweile sehr stark.
Zeitarbeit ist ein äußerst komplexes und vielschichtiges Thema, weshalb diese Arbeit sich einerseits mit der quantitativen Entwicklung der Branche auseinandersetzt und andererseits sozioökonomische Struktur und einige Bereiche der Lebenswirklichkeit von Leiharbeitnehmern untersucht. Ebenso wie bei den letzten beiden Teilbereichen der Arbeit steht bei der Analyse der quantitativen Entwicklung der Arbeitnehmer im Zentrum der Betrachtung und Verleiher, Entleiher, als auch rechtliche Rahmenbedingungen werden nur zur Erläuterung der Entwicklung herangezogen.
Datengrundlage dieser Arbeit ist neben der Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, die Personenbefragung des SOEP von 2006 und die Beschäftigtenstichprobe des IAB.
Der Umfang der Zeitarbeitsbranche ist mittlerweile in Deutschland mit anderen entwickelten Ländern vergleichbar, wobei es scheint, dass der Grad der Regulierung keinen Einfluss auf die Größe der Branche hat. Die Branche versorgt vor allem kurzfristig Unternehmen mit Arbeitskräften für Tätigkeiten im industriellen Sektor, für die eine geringe Qualifikation erforderlich ist. Zeitarbeitskräfte sind in der Regel jünger, teilweise aber sogar besser qualifiziert als vergleichbare Arbeitskräfte. Trotzdem verdienen Zeitarbeiter deutlich weniger, ihre persönlichen Zukunftsaussichten schätzen sie aber meist sogar positiver ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Zeitarbeit
- 2.2 Sozialstrukturanalyse und sozioökonomische Struktur
- 3. Zeitarbeit als dynamische Wachstumsbranche des Arbeitsmarktes
- 3.1 Regulierung der Zeitarbeitsbranche
- 3.2 Quantitative Entwicklung der Zeitarbeit
- 3.2.1 Saisonale Entwicklung der Zeitarbeit
- 3.2.2 Konjunkturelle Entwicklung der Zeitarbeit
- 3.2.3 Zeitarbeit als Wachstumsbranche
- 3.3 Strukturelle, tätigkeitsspezifische Entwicklung der Zeitarbeit unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung des Arbeitsmarktes
- 3.3.1 Strukturelle Unterschiede
- 3.3.2 Substitutionstendenzen bei regulärer Beschäftigung
- 3.3.2.1 Umfang der Substitution
- 3.3.2.2 Ursachen der Substitution
- 3.4 Dynamik und Fluktuation in der Zeitarbeitsbranche
- 4. Sozioökonomische Struktur von Leiharbeitnehmern
- 4.1 Rekrutierungspotential von Leiharbeitnehmern
- 4.2 Geschlechterspezifische Unterschiede
- 4.2.1 Frauenquote
- 4.2.2 Segregation nach Frauen- und Männerberufen
- 4.2.3 Saisonale Schwankungen
- 4.3 Nationalitäten
- 4.4 Stellung im Beruf
- 4.4.1 Begrifflichkeiten und Abgrenzungen
- 4.4.2 Vertikale Hierarchien bei Leiharbeitnehmern und regulär Beschäftigten
- 4.4.3 Befristete Arbeitsverhältnisse und berufliche Stellung
- 4.5 Qualifikation
- 4.6 Altersstruktur
- 4.7 Einkommen
- 4.7.1 Methodik
- 4.7.2 Einkommensunterschiede
- 4.8 Beschäftigungsdauer und soziodemographische Merkmale
- 5. Subjektive Lebenswirklichkeiten von Leiharbeitnehmern
- 5.1 Leiharbeitnehmer im Vergleich zu regulär Beschäftigten
- 5.2 Disparität zwischen Qualifikation und beruflicher Stellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Zeitarbeit in Deutschland. Ziel ist es, die sozioökonomische Struktur von Leiharbeitnehmern zu analysieren und deren subjektive Lebenswirklichkeiten zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet dabei die Entwicklung der Zeitarbeitsbranche, ihre Regulierung und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
- Entwicklung der Zeitarbeitsbranche in Deutschland
- Sozioökonomische Merkmale von Leiharbeitnehmern
- Vergleich von Leiharbeitnehmern und regulär Beschäftigten
- Auswirkungen der Zeitarbeit auf den Arbeitsmarkt
- Subjektive Erfahrungen von Leiharbeitnehmern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient als Einleitung. Kapitel 2 definiert den Begriff der Zeitarbeit und beschreibt die relevanten sozioökonomischen Strukturen. Kapitel 3 analysiert die Zeitarbeit als dynamische Wachstumsbranche, beleuchtet die Regulierung und die quantitative sowie strukturelle Entwicklung. Kapitel 4 untersucht die sozioökonomische Struktur der Leiharbeitnehmer, einschließlich Rekrutierung, Geschlechterverteilung, Nationalität, beruflicher Stellung, Qualifikation, Altersstruktur und Einkommen. Kapitel 5 befasst sich mit den subjektiven Lebenswirklichkeiten von Leiharbeitnehmern im Vergleich zu regulär Beschäftigten.
Schlüsselwörter
Zeitarbeit, Leiharbeitnehmer, Arbeitsmarkt, Sozioökonomie, Deutschland, Regulierung, Beschäftigung, Qualifikation, Einkommen, Subjektive Lebenswirklichkeit, Substitution, Geschlechterunterschiede.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Zeitarbeit in Deutschland entwickelt?
Zeitarbeit hat als Wachstumsbranche stark an Bedeutung gewonnen und trägt zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes bei, begleitet von einer zunehmenden Deregulierung.
Wer sind die typischen Leiharbeitnehmer?
Leiharbeitnehmer sind tendenziell jünger und oft im industriellen Sektor tätig. Interessanterweise sind sie teilweise sogar besser qualifiziert als vergleichbare reguläre Kräfte.
Verdienen Zeitarbeiter weniger als regulär Beschäftigte?
Ja, empirische Daten zeigen, dass Zeitarbeiter im Durchschnitt deutlich weniger verdienen, obwohl sie ihre persönlichen Zukunftsaussichten oft positiv einschätzen.
Ersetzt Zeitarbeit reguläre Beschäftigungsverhältnisse?
Die Arbeit untersucht sogenannte Substitutionstendenzen, also inwieweit Unternehmen Zeitarbeit nutzen, um Stammpersonal dauerhaft zu ersetzen.
Welche Rolle spielt die Qualifikation in der Zeitarbeit?
Obwohl viele einfache Tätigkeiten angeboten werden, diversifiziert sich die Branche zunehmend und fragt auch hochqualifizierte Fachkräfte nach.
- Citar trabajo
- Diplom-Verwaltungswirt (FH) Matthias Will (Autor), 2008, Zeitarbeit in Deutschland - Sozioökonomische Struktur der bei Zeitarbeitsfirmen Beschäftigten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124747